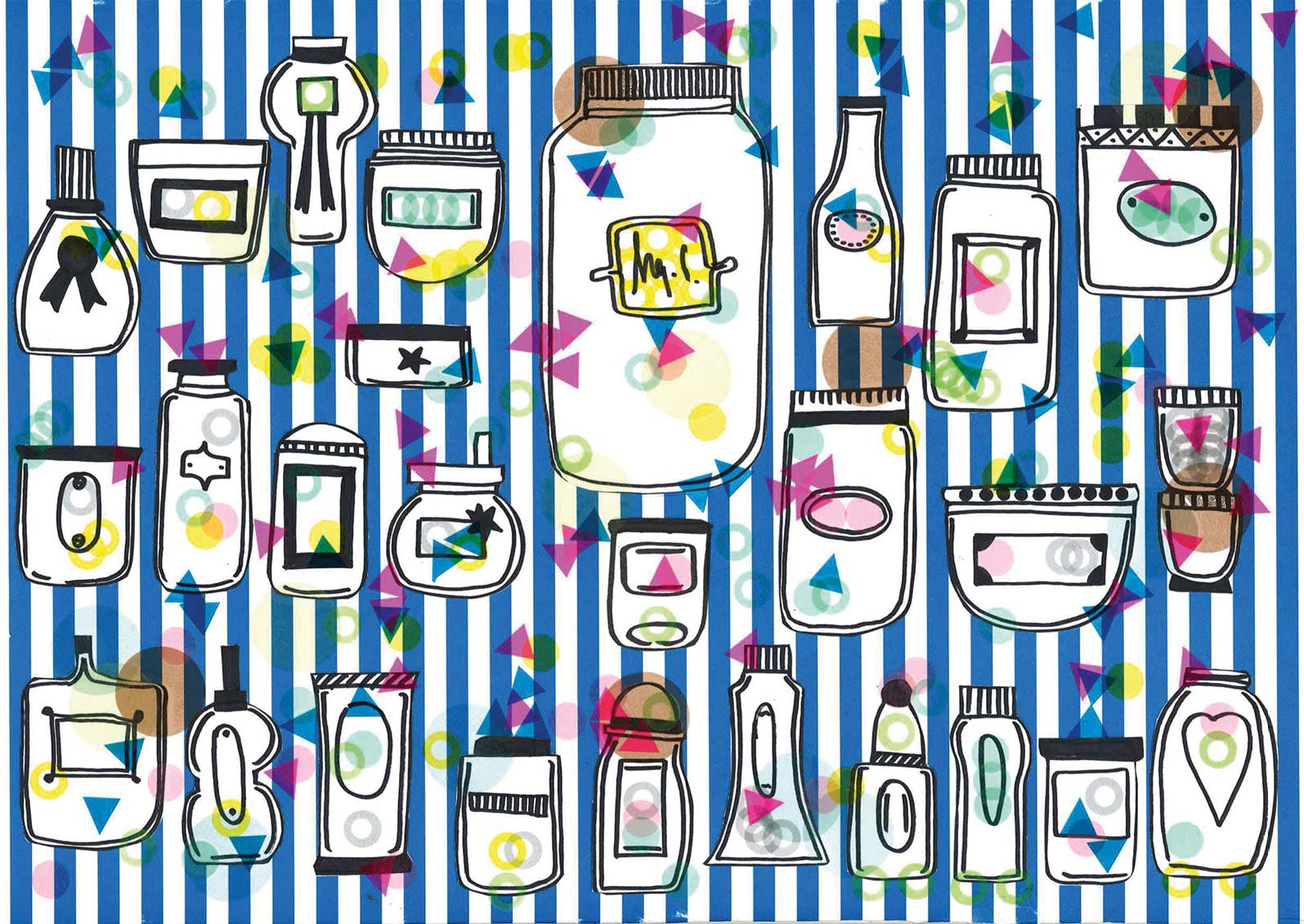Sascha Reske
Submission — Sascha Reske
Tretminen
27. Oktober 2013 — MYP No. 12 »Meine Stille« — Text: Sascha Reske, Foto: Jan Pfitzner
Vertrag‘ dich mit dir, denn du bist dein Freund in Nöten.
Viel mehr als ein Kind; schon bereit zu töten – zu hadern – zu zögern.
Weißt du nicht Bescheid, wer du bist; wer du bleibst?
Kennst du nicht dein reines, geflogenes Ich?
Unter Umständen trage ich dich in mir; doch nicht unter Diesen;
trete ich um mich; jedoch nicht mit fiesen…
Tritten.
Interpretierst du die Fassade, wenn du sie malst?
Ganz allein scheint sie zu verschwinden; auch wenn sie im Ruhigen liegt.
Außer ihr bleibt dir doch sowieso nichts…
vielleicht die Stille.
Sascha Reske ist 23 Jahre alt, Musiker und lebt in Halle an der Saale.
Lukas Leister
Submission — Lukas Leister
Pauls Erbe
27. Oktober 2013 — MYP No. 12 »Meine Stille« — Text & Foto: Lukas Leister
»Ja?«
Paul wohnte noch nicht allzu lange hier draußen. Drei Wochen war es jetzt her, dass er seine Einzimmerwohnung mit bester Lage an der Hauptverkehrsstraße Wanne-Eickels leergeräumt und schließlich mit einer halbvollen Sporttasche verlassen hatte. Aus Geld, das bemühte sich Paul meist sich selbst gegenüber möglichst lässig und unbeeindruckt zu betonen, machte er sich wirklich nicht viel. Als ihn dann jedoch vor zwei Monaten die Nachricht von seinem unerwarteten Erbe erreichte, überlegte Paul nicht lange. Die Dinge, die ihn hier noch hielten, hätte Paul sowieso an zwei Händen abzählen können – die Personen an einer.
»Hallo?«
Das Haus seiner Großtante – oder wie er die ihm unbekannte Schwester seiner ihm unbekannten Großmutter auch immer hätte bezeichnen müssen – stand abgelegen am Rande eines kleinen Mischwaldes, fünfhundert Meter hinter dem nächsten Ortsschild. Weit hatte er es also nicht, falls er sich mal etwas besorgen musste. Mit dem Fahrrad, dass er sich demnächst irgendwo kaufen wollte, bräuchte er keine zehn Minuten bis zum nächsten Supermarkt. Mit dem Geld von Großmutters Schwester würde er locker zwei Jahre über die Runden kommen. Paul war soweit zufrieden. Nur das ständige Brummen der Motoren, das Hupen der Autos und die Zischgeräusche des anhaltenden Linienbusses vor seinem Fenster, woran er sich während seiner Zeit an der Wanne-Eickeler Hauptstraße so sehr gewöhnt hatte, fehlte ihm.
Egal an welches seiner nun unzähligen Fenster er sich auch stellte, sah und hörte er nur ganz selten den ihm vertrauten Lärm eines vorbeifahrenden Autos.
»Wer ist da?«
Um der Stille, die ohne Verkehrsgeräusche unumgänglich schien, zu entkommen, hatte sich Paul angewöhnt, den Fernseher gar nicht mehr auszuschalten. Früher hatte er ihn wenigstens manchmal zum Schlafen abgestellt. Hier drehte er, wenn überhaupt, die Lautstärke minimal herunter.
Als Paul nun mit dem Hörer in der Hand dastand, schaltete er ihn zum ersten Mal seit zwei Wochen aus, um zu hören, ob da am anderen Ende der Leitung jemand sprach, nur eben leise. Doch Paul hörte nichts. Sowieso wunderte er sich, wie das Telefon hatte läuten können, das noch genau so im Wohnzimmer seiner Großtante stand, wie sie es hinterlassen haben musste. Er hatte sicherlich keinen Vertrag verlängert oder abgeschlossen und würde den Teufel tun, die nächste Rechnung dafür zu zahlen.
»Hallo? Idiot!«
Paul knallte den Hörer auf die Station, blieb vor dem Telefon stehen und wartete, ob es nochmal klingeln würde. Doch nichts klingelte oder läutete. Nichts brummte, hupte oder zischte.
Paul setze sich wieder in seinen geerbten Sessel, nahm die Fernbedienung, drückte auf On und schaute fern.
Lukas Leister ist 23 Jahre alt, Student, Fotokünstler und lebt in Wien.
Niklas Schader
Submission — Niklas Schader
Vielleicht glücklich
27. Oktober 2013 — MYP No. 12 »Meine Stille« — Text & Foto: Niklas Schader
Stille ist für mich manchmal Melancholie, manchmal aber auch ruhiges Glück, Zufriedenheit.
Wenn ich Personen komplett neu kennenlerne, sind sie mir immer unglaublich sympathisch, wenn man nicht die ganze Zeit reden muss, sondern einfach Minuten nebeneinander sitzen, Musik hören und gar nichts sagen kann, ohne dass die Situation unangenehm wirkt und man zusammen im Meer aus Bass versinken kann.
Am Bahnhof stehen, Kopfhörer auf, und das unbändige Bedürfnis haben, zu tanzen, während die Menschen am Bahnsteig traurig schauen und nicht miteinander reden, ist das richtige Stille? Wenn man nur das Rauschen des eigenen Blutes und das Pochen und Pumpen der unermüdlich arbeitenden Organe hört, ist es dann still?
In einem Bett liegen, halb auf einer geliebten Person, ihren Atem hören und versuchen, im gleichen Takt oder genau entgegengesetzt zu atmen, ist das Stille?
Für mich ist Stille etwas Inneres.
Es bringt mir nichts, im isoliertesten Raum der Welt zu sitzen, wenn es in mir brodelt und kocht, wütet und stürmt, Gedanken umherfliegen und wie Schallplatten an einer Wand in tausend kleine Teile zerbrechen und sich zu neuen Gedanken zusammenfügen.
Andersherum kann ich auch an der größten Straßenkreuzung oder im lautesten Technoclub der Welt sein und dort Stille empfinden, innere Stille, obwohl es um mich herum unglaublich laut ist und ich danach tagelang ein Piepen im Ohr habe.
In mir drin war es still, denn ich war zufrieden.
Vielleicht sogar glücklich.
Niklas Schader ist 17 Jahre alt, Schüler und lebt in Frankfurt am Main.
Alina Wichmann
Submission — Alina Wichmann
Innerlich laut
27. Oktober 2013 — MYP No. 12 »Meine Stille« — Text: Alina Wichmann, Foto: Lukas Leister
Meine Stille ist wie ein wild gewordenes Kind, das so laut schreit, bis es in ein Zimmer gesperrt wird, um sich zu beruhigen. Meine Stille hat keinen Boden und klettert manchmal die Wände hoch.
Meine Stille schweigt selten, und wenn sie es tut, reißt mich die blanke Panik hoch, um sich zu vergewissern, dass ich noch am Leben bin. Vielleicht ist das die Stille einer Mitt-Zwanzigerin und völlig normal? Oder sollte ich meine Mitte etwa schon gefunden haben?
Stille Menschen erscheinen mir so erhaben und weise. Sie trohnen über den kläffenden Schoßhündchen, die wieder zu irgendeinem Thema irgendeine belanglose Meinung ungefragt in den stillen Raum stellen. Meine Stille ist ein Schrei.
Meine Stille gleicht einem flachen Gewässer, in dem man ausrutschen könnte, um blöderweise zu ertrinken. In meiner Stille denke ich frei über all die Menschen, die mich umgeben. Ich sage ihnen Dinge, die ich mich sonst nie trauen würde. Was für eine große Nase ihr eh schon hässliches Gesicht entstellt oder dass ihr Eau de Toilette nach ranzigen Blumen stinkt. Meine Stille ist ein Dialog.
Meine Stille macht mir Angst. Wann denke ich eigentlich nicht? Ich rede im Schlaf, ich rede, während ich denke, ich rede, wenn ich spreche, und warum sollte ich dann still sein?
Stille ist eine Illusion. In meiner Stille sage ich dem Kerl, in den ich schon so lange heimlich verliebt bin, dass ich mir Kinder mit ihm vorstellen könnte.
In meiner Stille bin ich ungefiltert. Kennen meine Freunde mich still? Kennt mich überhaupt jemand? Vielleicht ist Schreiben ein Ausdruck meiner Stille. In meiner Stille bin ich mir nie sicher. Es gibt mindestens eine Trilliarde Möglichkeiten, über etwas nachzudenken — eine Perspektive zu wählen. Wie sollte man da denn still sein können?
Wenn ich still bin, bin ich tot. Ich glaube nicht an die Stille. Ich glaube ehrlich gesagt auch nicht daran, dass jemand, der meditiert, in dem Moment an nichts denkt. Vielleicht denkt er die ganze Zeit an: „Ich denke an nichts, ich denke an nichts, ich denke an nichts.“ Denkt er dann wirklich an nichts?
In meiner Stille gibt es keinen Sinn. Sonst hätte ich doch das Bedürfnis, den Sinn zu kommunizieren. Mit wem rede ich hier eigentlich? Ich bin immer häufiger für andere still — doch innerlich noch immer laut. Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen für eine Mitt-Zwanzigerin. Meine Stille nicht zu kennen, lässt mich nach ihr suchen und das heißt: Ich bin am Leben.
Alina Wichmann ist Sängerin/Songwriterin und lebt in Berlin.
www.alinamusik.de
www.facebook.com/alinaoffiziell
@alinaoffiziell
Tronje Thole van Ellen
Submission — Tronje Thole van Ellen
In Parkposition
27. Oktober 2013 — MYP No. 12 »Meine Stille« — Text & Illustration: Tronje Thole van Ellen
Es gibt einen wirklich stillen Moment in meinem Leben, nach einer langen Autofahrt mit Autobahn, überhohlen, Rasern, Audi, Fahrbahnmarkierungen, Fliegen auf der Windschutzscheibe, Sonnenstrahlen schräg von der Seite, Staubpartikeln in der Luft und klebrigen Händen am Lenkrad. Mit dem Rauschen der Klimaanlage und der sehr eintönigen, nervigen Musik Hamburger Radiosender aus schlechten Lautsprechern, der entspannten Coolness eines echten Mannes am Steuer, dem vibrierendem Handy in der Tasche und der tickenden Uhr am Arm und im Nacken sowie der ständigen Lebensgefahr, irgendwo hängen zu bleiben.
Nach diesem puren organisiertem Chaos — in Parkposition, Radio und Motor aus, dann die Klimaanlage —befinde ich mich in einem Vakuum mit mir selbst.
Ich bin mir selbst überlassen, mein Körper fährt völlig herunter, das ist wundervoll! Bis zu zehn Minuten harre ich in meiner persönlichen Parkposition aus.
Ich danke dem Lärm, der Autobahn, dem Teer, der Farbe Grau und der Geschwindigkeit — denn durch sie empfinde ich an manchen Tagen „meine Stille“.
Tronje Thole van Ellen ist 22 Jahre alt, Künstler und lebt in Hamburg.
Regina Pichler
Submission — Regina Pichler
Resario Malti hat die Ruhe weg
27. Oktober 2013 — MYP No. 12 »Meine Stille« — Text & Illustration: Regina Pichler
Das lisarische Dorf Ringalli liegt seit Jahrtausenden in einem kleinen Tal umgeben von seltenen Fanfarensträuchen, die jeden Frühling meterhoch in den lachsfarbenen Himmel wachsen.
Das Leben im Dorf ist einfach. Jeden Montag beginnt eine neue Woche: Bäcker backen morgens Lunazzis aus Hefeteig mit Mandelherzen. Lehrer spitzen ihre blitzblauen Hussarenkreiden, um damit in die Luft zu malen. Und eine Hutmacherin klopft ihre meterhohen Kopfbedeckungen vor dem Laden aus und steckt an jeden Hut eine frisch gepflückte Mamali-Blüte.
Auch der alte Resario Malti steht Montags Frühmorgens auf und öffnet sein Geschäft, das an der Avenia Passarena liegt. Dort verkauft er keine süßen Lunazzis, keine Hüte – und er malt auch keine Dinge in die Luft.
Resario verkauft Stille. Dazu wandert er das ganze Jahr durch Ringalli und die umliegenden Dörfer, um mit einem sehr eng geknüpften Schmetterlingsnetz und einem Glas im Rucksack die Ruhe einzufangen. Einmal die Stille gefunden, packt er sie in ein Marmeladenglas, dreht den Deckel sehr fest zu und beschriftet das Glas. In seinem Laden in der Avenia Passarena werden die Gläser fein säuberlich in ein hohes Regal gestellt und mit einem Preisschild aus Ropaccio-Papier versehen.
Wer zu Resario kommt, hat die größte Auswahl an Stillen, die man sich vorstellen kann: es gibt in kleinen Gläsern die Stille aus der arakenischen Kirche im Nachbardorf. Die Stille zweier Freunde, die auf dem rotgekachelten Bürgersteig Schulter an Schulter gehen, kommt in einem bauchigen Glas mit rotem Deckel. Resario bietet auch die Stille einer großen Schulklasse in Arassio, dem Nachbarort von Ringalli an! Die ist sehr selten.
Auch im Angebot: die Stille einer großen Menschenmenge, nachdem ein Politiker aus Arakenien um Ruhe für seine Rede gebeten hat. Die Stille nach einer guten Mahlzeit, die Stille nach einem Paukenkonzert in der Ringalli-Arena. Und die Stille eines Mannes, der das traditionelle und schwere Lamisio-Rätsel mit den Steinen legt.
Und natürlich auch die Haus-Spezialität: ein großes Glas Stille aus dem Laden Resario Maltis. Eingefangen an einem heißen Sonnabend im August, als alle übrigen Einwohner Ringallis am Badeteich waren. Diese Stille ist allerdings nicht ganz still: beim Sammeln machte Resarios alter Dielenboden ein knarzendes Geräusch. Deshalb kostet das große Glas auch ein bisschen weniger als andere.
Seit vielen Jahren kommen Menschen aus dem ganzen Land zu Resario, um in Ruhe ein schönes Glas Stille auszusuchen und zu Hause aufzustellen. Besonders beliebt sind seit Neuestem auch kleine Stillen für unterwegs, die perfekt in die Hosentasche passen. Resario geht mit der Zeit!
Auch wenn Resario seinen Laden nicht ewig führen kann, weiß er, dass er sein ganzes Leben leidenschaftlich der Stille gewidmet hat. Ein Geheimtipp für alle, die Resarios Ruhe auch finden wollen: Einfach den nächsten Zug Richtung Apercio nehmen, bei Mabasta auf den ersten Wagon der Rundbahn Richtung Ringalli aufspringen – geschafft.
Aber Psst!
Regina Pichler ist 34 Jahre alt, freie Texterin, Autorin und lebt in Hamburg.
Sina Brückmann
Submission — Sina Brückmann
Ohne Apfel-Z
27. Oktober 2013 — MYP No. 12 »Meine Stille« — Text, Illustration & Foto: Sina Brückmann
Stille findet sich an Orten, die man kaum erwartet.
“Papier ist geduldig”, heißt es im Volksmund. Doch auch das Arbeiten mit Papier erfordert Geduld. Mich selbst würde ich nicht unbedingt als extrem geduldig bezeichnen. Diverse Hobbyprojekte aus Fimo und Holz fanden so schon ihren Weg in die Mülltonne. Jedoch gibt es da eine Ausnahme.
Schon als Kind übten Papier und Origami eine unglaubliche Anziehungskraft auf mich aus. Nachdem ich einfache Muster wie Frösche und Wasserballons gemeistert hatte, wurden es Tetraeder, Feuerwerke und schließlich ganze Layouts aus Papier.
Das kreative Arbeiten ohne Apfel-Z entschleunigt mich und meinen herkömmlich hektischen Alltag am Computer. Meine Stille liegt in den Stunden vollkommener Konzentration.
Während ich Papier falze, verbiege oder klebe, vergesse ich alles um mich herum und die Gedanken in meinem Kopf werden ganz still.
Analoge Papierkunst ist für mich nicht nur ein kreatives Ventil, sondern auch ein meditativer Ruhepol. Jeglicher Lärm verschwindet in den Falzen des Papiers und was zurück bleibt, ist Stille.
Meine Stille ist ein Stück Papier.
Sina Brückmann ist 32 Jahre alt, Kommunikationsdesignerin und lebt in Berlin.
Tzimon Budai
Submission — Tzimon Budai
Der Mann ohne Lungen
27. Oktober 2013 — MYP No. 12 »Meine Stille« — Text: Tzimon Budai, Foto: Maximilian König
„Das Meer, junger Mann. Ich suche das Meer. Können Sie mir helfen, es zu finden?“ Es war Nacht. Ich war auf dem Weg nach Hause, der Mond stand schon hoch oben und wog die Straßen, Bäume und Wiesen in seinem stillem Netz aus Schlaf.
„Wieso denn das Meer?“, fragte ich ihn ganz verwundert. Bei genauerem Hinsehen erkannte ich einen hochgewachsenen, dürren Mann. Er schien recht nervös und unbeholfen, gar hilflos zu sein. Seine Augen rasten von links nach rechts, von oben nach unten, und er schaute sich immer wieder um, als ob er etwas suchte. „Na verstehen sie, junger Mann, ich möchte nach Hause. Ihre Welt ist mir zu laut.“
„Meine Welt? Zu laut?“, wollte ich wissen, während ich mich wieder ärgerte, an wen ich hier geraten war. „Ach, ihr seid ein Atmer, nicht wahr? Zeigt mir doch bitte den Weg zum Meer, ich erkläre es Ihnen unterwegs.“ – „Na gut, folge mir.“
Schweigend wanderten wir die ersten Straßenbiegungen entlang, der Mond über uns hielt Wache über sein Reich der Stille. Wir verließen nun das kleine Dorf, in dem ich wohnte, und das fahle Licht der Straßenlaternen verschwand immer mehr. Ich vermochte meinen Mitläufer kaum zu erkennen, sein Gesicht lag vollkommen im Schatten der vielen Bäume um uns herum. Wir liefen auf meinem eigenen Weg gen Meer. Den Weg, den ich immer benutzte, wenn mir alle anderen zu voll waren und ich meine Ruhe haben wollte. Plötzlich stieß der Mann neben mir einen seltsamen Laut aus, es klang wie Schluchzen und Seufzen vereint. „Hier ist schon besser. Viel ruhiger als in euren Städten und Dörfern. Nicht auszuhalten.“ – „Aber es ist doch überall so laut.“ „Nein. Nicht bei mir in meiner Heimat. Es gibt nur sehr wenige von uns. Ein Dutzend vielleicht. Wir leben in solch einer wunderbaren Stille, wie sie nie einer von euch Atmern erleben wird.“
„Moment mal,“ unterbrach ich ihn, „Atmer? Du atmest doch auch?“ – „Ihr ja! Aber wir nicht. Wir besitzen keine Lungen. Wir können wandern und ziehen, wohin wir wollen. In die tiefsten Tiefen des Meeres oder die höchsten Berge dieser Welt. Doch ziehen wir meist dorthin, wo es still ist. Eure ganze Welt voller Atmer ist so laut, dass ihr es gar nicht mehr mitbekommt. Eure Schiffe, Autos, Häuser: all das. Der Lärm legt sich über euch, erstickt eure Seele.“
Er hielt inne und blieb stehen. Nach diesen Worten konnte ich meinen Blick nicht von seinem Brustkorb lassen: Tatsächlich, er bewegte sich weder auf und ab. Keinen Millimeter. „Das kann doch nicht sein“, dachte ich.
„Die Menschen, wie ihr euch nennt, haben vergessen, wie wichtig Stille für sie ist. Dennoch fürchtet ihr sie sehr. Ihr fühlt euch verloren in ihr, aber irgendwie auch geborgen. Alle Laute und Töne regieren euch von ihrem Thron und ihr gehorcht widerstandslos. Ihr lebt in jedem Ort voller Lärm und voller Angst vor diesem Wort: Stille.
Doch ihr braucht sie. Denn sie nimmt euch die Brille ab, die euch den Blick in eure Seele verhindert. Nur in der Stille, alleine, begreifen Menschen, was sie lieben, fürchten, hassen oder wollen. Aber die meisten haben Angst, sich in diese Stille fallen zu lassen, da sie sich vor dem fürchten, was sie erblicken werden. Und so packt ihr eure Welt voller Lärm, um der Wahrheit über einen jeden von euch entgehen zu können. Wahre Stille bietet euch die Wahrheit über dich selbst! Sogar hier draußen ist es noch zu laut für uns. Das Summen der Lichter, Autos in der Ferne, Flugzeuge in der Luft. Es ist so unerträglich…“
Er schwieg. Ich schloss die Augen und versuchte, auf alles zu hören. Alles um mich herum. Doch ich hörte nichts, für mich war es totenstill hier draußen in der Nähe der Dünen. „Ich möchte sie nicht so lange stören, es ist ja schon spät. Ich kann das Meer schon riechen, wir sind nicht mehr weit weg.“ – „Nein, noch ein paar hundert Meter. Hier entlang.“ Wir schwiegen beide. Ich ging voraus, er hinter mir. Ich wusste nicht so ganz, ob ich begriff, was er mir erzählt hatte. Ich fragte mich die ganze Zeit, ob er denn Recht habe, dass unsere Welt zu laut geworden sei und uns das gar nicht mehr auffalle.
Die Bäume lichteten sich langsam und gaben den Blick frei auf das atmende Meer. Ein bezaubernder Anblick. Das monotone Auf und Ab der Wellen, wie sie sich am Strand das Wasser kräuseln und die Gischt das Mondlicht reflektiert. Ich drehte mich um und sah nun zum ersten Mal richtig meinen Begleiter. Sein Alter zu schätzen wäre unmöglich gewesen. Er war zwar groß und dürr, hatte aber kräftige, breite Schultern. Er war eher unscheinbar, doch seine Augen zogen mich in ihren Bann. Pechschwarz reflektierten sie das Mondlicht. Es waren alte Augen, aber in einem jungen Mann. Sie schienen eine Geschichte von dem erzählen zu wollen, was sie schon alles gesehen und erlebt hatten. Doch sie hatten auch etwas Einsames und Trauriges. Wie bei den Menschen, denen man auf der Straße begegnet, in deren Augen sich pure Einsamkeit spiegelt.
„Endlich. Mein geliebtes Zuhause.“ Seine Augen begannen noch viel mehr zu leuchten. Als er an mir vorbeikam, drehte sich der Mann ohne Lungen noch einmal um. „Vielen Dank, Fremder. Ich werde nun nach Hause gehen. Bleiben sie doch noch ein wenig hier an meiner Türschwelle und genießen sie die Ruhe und Stille, die in der Nacht so nah an meinem Zuhause herrscht.“
Er ging zwei, drei Schritte weiter und drehte sich noch ein letztes Mal um. „Ach, und haben Sie keine Angst mehr vor der Stille. Sie ist etwas so Wunderbares! Ihr Atmer solltet viel mehr von ihr kosten. Sie kann euch Wege zeigen, die euch keine Töne, Geräusche und Laute dieser Welt weisen könnten. Lebt wohl!“.
Er schritt voran. Sein Körper bäumte sich auf und ab, wie bei einem kleinen Kind, das sich freut, die Geburtstagskerzen auszupusten. Er hatte nun die Brandung erreicht und die Wellen streichelten seine Knöchel. Das Wasser verschluckte seine Knie und Beine nun fast vollständig. Er ging weiter. Es schien, als ob das Meer ihn mit seinen Wellen empfing, ihn in die Arme schloss wie einen alten Freund, den man schon sehnsüchtig erwartet hatte.
Tzimon Budai ist 18 Jahre alt und lebt in Berlin.
Dylan Köhler
Submission — Dylan Köhler
Lieber laut
27. Oktober 2013 — MYP No. 12 »Meine Stille« — Text: Dylan Köhler, Foto: Maximilian Motel
Früher war ich der kleine Skater von Nebenan, hatte Dreadlocks und kaum Sorgen. Ein paar Jahre später wurde aus dem kleinen Skater ein staatlich anerkannter Erzieher, der mittlerweile an fünf Tagen in der Woche in einer KiTa aushilft – zwar nur zwei Stunden pro Tag, aber das reicht schon für einen halbwegs geregelten Tagesablauf. Und es bietet mir genug Zeit, um mit mir selbst ein paar basale Fragen auszumachen: Wo möchte ich noch hin? Was will ich noch erreichen? Wie kann ich mich weiterbilden?
Das Geld ist leider knapp und ich muss zusehen, wie ich über die Runden komme.
Als DJ kann ich mir den ein oder anderen Euro dazu verdienen, aber eigentlich geht es mir gar nicht um das Geld: Es macht mich einfach glücklich, bestärkt mich in allen Lebenslagen und baut mich auf – besonders wenn ich sehe, wie ich mit meiner Musik die Leute auf der Tanzfläche beglücken kann.
Auf anstehende Auftritte in größeren Clubs freue ich mich ähnlich wie die kleinen Kinder in meiner KiTa auf ihren Geburtstag.
Und in den Momenten, in denen ich im Club der Musik und den tiefen Bässen ausgesetzt bin, fühlt sich in mir alles ganz anders an: Alles ist ruhig und idyllisch, die Beine zittern und es werden massenweise Endorphine ausgeschüttet. Mein Körper und ich durchleben die vollkommene Stille.
Diese Stille, in der ich mich selbst spüre und die mich überaus glücklich macht, ist gespickt mit guter House Musik, farbigen und flackernden Lichteffekten sowie einer Menge partyfreudiger Menschen, die toben und tanzen – und natürlich der Kreativität, der ich beim Zusammenmischen der verschiedenen Lieder freien Lauf gelassen lassen kann.
Seit gut zwei Jahren trete ich nun zusammen mit meinem Freund Timo in Münster auf. Unser DJ-Duo trägt den Namen „Lieber Laut“ – und so erleben wir die Stille beim Auflegen nicht alleine, sondern gemeinsam. Wir können uns aufeinander verlassen und helfen uns, wenn es mal Schwierigkeiten gibt. Irgendwie finden wir immer einen Ausweg – das gibt mir besonders viel Ruhe und Kraft, mich in meine ganz eigene Stille fallen zu lassen.
Ich finde es einfach toll, einen guten Freund an meiner Seite zu haben, mit dem ich diese Stille ein Stück weit teilen kann – und den ich vielleicht auch nur für einen kurzen Augenblick mit in meine Stille hineinziehen kann.
Dylan Köhler ist 22 Jahre alt, Erzieher und DJ und lebt in Münster.
Janis Michaelis
Submission — Janis Michaelis
Nach innen wie nach außen
27. Oktober 2013 — MYP No. 12 »Meine Stille« — Text: Janis Michaelis, Foto: Jannis Hell
Immer wenn ich in Norddeutschland das Rauschen der hereinrollenden Flut im Ohr hatte oder den kreischenden Möwen lauschte, die im Hafen einen heimkehrenden Fischkutter umkreisten, und immer wenn ich das Windgetöse an den Peitschenlampen am Fluss hörte, dann dachte ich nur an dieses eigene Stillsein, das abgekoppelt ist von dem, was es verursacht.
Tatsächlich findet sich meine Stille aber ganz anders ein. In geschlossenen Räumen, am eigenen Schreibtisch.
Diese Stille dokumentiert ein Ereignis, das Gestalter kennen, die auf Anhieb kreativ zu sein haben. Die Ideenlosigkeit, den Blackout, die Ratlosigkeit. Ähnlich der Maschinen in einer Druckerei: Ist es in deinem Atelier still, dann steht auch die Produktion still.
Sicher, ich kann jederzeit einen Dokumentennamen vergeben, den Fließtext in einer Meta setzen, Facebook checken, Auszeichnungen vornehmen, Postleitzahlen ausgleichen, speichern, am Farbregler spielen, nochmal Facebook checken.
Doch um etwas Raffiniertes zu gestalten, braucht man eine Idee. Mir wurde einmal gesagt, man müsse bei einer Idee aufpassen, dass sie kein Einfall ist, denn der würde schnell einfältig. Ich habe es so verstanden: Ideen kommen beim Arbeiten und nicht beim darüber Nachdenken. Aber ohne Eindruck kein Ausdruck, sagte das nicht einmal Godard?
Meistens kommen die wirklich guten Ideen in der U-Bahn, aufm Pott, bei nem Schnack. Kein Geistesblitz, eher eine mögliche Idee zur Lösung eines Problems oder einen Anfang dafür.
Leider können die meisten Gestalter nicht darauf hoffen, dass ihnen diese Erleuchtung Freitagabend zwischen Kotti und Moritzplatz heimsucht oder bei Mustafa in der Schlange.
Ein Auftrag ist mit immer näher rückender Deadline wie ein schlecht gelaunter Spiekermann mit Pumpgun in deinem Nacken. So sitzt man Dienstagsvormittag vor dem Rechner, hoffend, dass irgendein geniales Layout zusammen kommt.
Und plötzlich ist es da: das Raufen der Haare, das Nägelkauen, das verzweifelte Klicken der Maus und das Runzeln der Stirn: die Stille.
Mit der Aufmerksamkeitsspanne eines Fünftklässlers sitzt man nun da und durchscrallt jeden Blog, durchsucht die eigene Ordnerstruktur nach Rechtschreibfehlern und lauscht dem sanften Klackern der Festplatte.
Wie man es am Ende dann doch wie selbstverständlich schafft es zu wuppen, ist wie der Anfang einer langen Reise, an den man sich am Ende nicht mehr erinnert.
Es ist einfach passiert. Bezeugen kann dies am am Ende nur das Dokument.
Das war also die Zeit der Stille. Als hätte ich sie bloß überwunden, um sie schon wieder zu suchen, die Stille, in der ich fühle, dass ich höre – nach innen wie nach außen. Gehört einfach zu mir.
Janis Michaelis ist 27 Jahre alt, Grafikdesigner und lebt in Berlin.