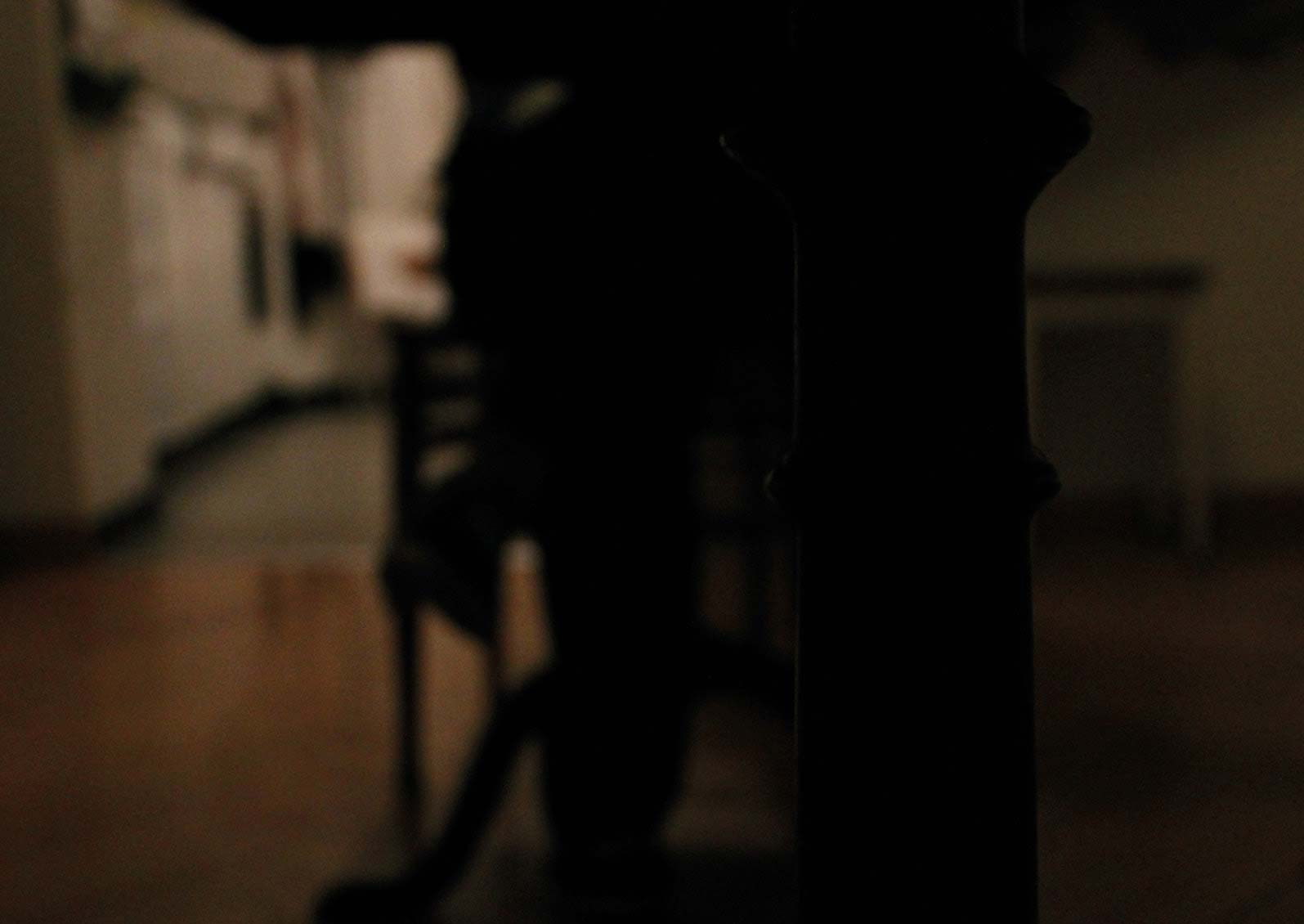Ben Ivory
Interview — Ben Ivory
Aus Elfenbein
Avantgardist Ben Ivory ist ein Stern am ansonsten eher casual daherkommenden Deutschpop-Himmel. Das meist elegant gekleidete Aushängeschild des 80er-Revivals verrät uns, warum er sich selbst eher mit einer Straßenköter-Ästhetik in Verbindung bringt.
27. Oktober 2013 — MYP No. 12 »Meine Stille« — Interview: Jonas Meyer, Fotos: Steven Lüdtke
Es gibt Orte in Berlin, die brauchen etwas Zeit, um herauszufinden, wer sie wirklich sind. Manche verändern sich dabei so stark, als führten sie ein neues Leben. Gewiss, das Ganze geht nicht ohne Mut. Doch sind sie einmal angekommen in ihrem neuen Ich und können sein, was sie sein wollen in der großen Stadt, strahlen sie oft heller, als man es je zuvor vermutet hätte.
Das „Prince Charles“ am Moritzplatz in Kreuzberg ist einer jener Orte. Dass der Club einmal ein öffentliches Schwimmbad war, daraus macht er keinen Hehl. Warum auch, schließlich sind die alten grünen Fliesen und das bunte Wasser-Mosaik Teil seiner ganz eigenen Identität. Sie geben ihm, woran es heutzutage doch so Vielem und so Vielen mangelt: einen eigenen Charakter.
Es ist Freitagabend, mitten im August, mitten im „Prince Charles“. Eine Menschentraube wächst auf der Tanzfläche zwischen Mischpult und der kleinen Bühne, die sich neben den Umkleidekabinen des ehemaligen Hallenbads aufbaut.
Immer mehr Leute drängen sich in den kleinen Club, die Menschentraube wächst und wächst. Über ihre erwartungsvollen Gesichter legt sich ein Teppich aus goldenem Licht, der aus unzähligen kleinen Lampen von der Decke herabschwebt.
Plötzlich wird es still, Spannung liegt in der Luft: Ein junger Mann hat die Bühne betreten. Mit einem Mal ist das goldene Deckenlicht dem Elfenbeinweiß seines futuristischen Kostüms gewichen und hat sich in die Dunkelheit des tiefen Raums zurückgezogen.
Die Musik startet, der junge Mann beginnt zu singen: „We are the rigtheous ones.“ Es ist das Release-Konzert seines neuen Albums.
Drei Wochen später.
Wir sind an den Ort zurückgekehrt, an dem sich an jenem Freitagabend so viele Menschen versammelten, um der Stimme des jungen Mannes zu lauschen. Doch bis auf uns und diesen jungen Mann, der sich Ben Ivory nennt, ist heute niemand hier.
Es herrscht eine seltsam-angenehme Stille. Wie vor drei Wochen ist das ehemalige Hallenbad auch diesmal von goldenem Licht erfüllt, das allerdings erst jetzt im menschenleeren Raum den vollen Charme des Ortes offenbart – erst jetzt, in der tiefen Stille.
Wir lassen uns auf einer kleinen Mauer nieder, die früher wohl als Beckenrand fungierte. Ben leistet uns Gesellschaft und lässt ein freundliches Lächeln über sein Gesicht wandern.
Jonas:
Du hattest bereits mit 14 Jahren deine eigene Band – ein gar nicht so ungewöhnliches Alter, wenn man auf die vielen jungen Talente schaut, die sich in Berlin tummeln. Liegt es alleine an dieser Stadt, dass man schon in jungen Jahren von dieser Kreativwelle mitgerissen wird?
Ben:
Berlin ist auf jeden Fall ein ideales und fruchtbares Pflaster, wenn man sich kreativ betätigen will. Man kommt hier mit so vielen unterschiedlichen Kulturen und künstlerischen Sichtweisen in Berührung, dass man früher oder später ganz automatisch in die Situation kommt, selbst aktiv zu werden und seiner Kreativität freien Lauf zu lassen.
Meine eigene künstlerische Entwicklung ist aber nur zur Hälfte auf dieses ganz besondere Berlingefühl zurückzuführen, für die anderen 50 Prozent ist meine Familie verantwortlich.
Da mein Vater Berufsmusiker war, meine Großmutter einen Chor leitete und meine Mutter sich intensiv mit Musik und Theater befasste, wurde ich bereits als Kind künstlerisch sehr geprägt. Mir wurde quasi das Bedürfnis in die Wiege gelegt, mich in dieser Welt auf eine kreative Art und Weise auszudrücken.
Musik war für mich eine eigene Welt, in die ich mich flüchten konnte, wenn ich die Realität mal nicht so prickelnd fand.
Jonas:
Das heißt, dir war als Kind schon klar, was du einmal werden willst?
Ben:
Ich wollte schon immer Musiker werden und die Menschen unterhalten – mit gerade einmal drei Jahren habe ich meiner Mutter gesagt, dass ich später einmal Entertainer werden will. Musik war für mich eine eigene Welt, in die ich mich flüchten konnte, wenn ich die Realität mal nicht so prickelnd fand. Michael Jackson, David Bowie und Madonna haben damals einen kompletten musikalischen Kosmos kreiert, in den man eintauchen und sich fallen lassen konnte. In diesem Kosmos spielten Musik und visuelle Darstellung gleichermaßen eine wichtige Rolle, diese Kombination hat mich sehr fasziniert und inspiriert.
Mein Ziel war immer total klar: Ich wollte ebenfalls eine derartige Welt erschaffen, in die sich andere Menschen zurückziehen können und die es ihnen ermöglicht, phantasievoller und feingeistiger zu sein, als es ihnen im normalen Leben gestattet ist.
Leider war mir der Weg zu meinem Ziel alles andere als klar. Zuhause musste ich die unschöne, aber wichtige Erfahrung machen, dass ein Leben als Künstler nicht immer leicht ist und man schnell in existenzielle Nöte geraten kann. Es gab manchmal Zeiten, in denen der Kühlschrank einfach leer blieb. Daher nahm ich mir vor, ganz verschiedene Kreativbereiche kennenzulernen und zu durchlaufen, um mir überall die Skills anzueignen, die ich brauche, um später als Künstler unabhängig und erfolgreich zu sein – und um meinen ganz eigenen Kosmos aus Musik und Visualität kreieren zu können.
Jonas:
War dies der Grund, warum du dich nach deinem Schulabschluss für eine klassische Fotografenausbildung entschieden hast?
Ben:
Ich habe eigentlich schon immer nebenbei fotografiert und mit 15 sogar den Deutschen Jugendfotopreis gewonnen. Ich wusste also, dass ich in dieser Disziplin über ein gewisses Talent verfüge, und habe mich daher entschlossen, beruflich in einem Kreativbereich zu starten, der für mich nicht ganz so unbekannt war.
Diese Etappe meines Lebens war für mich total wichtig, weil ich mich dadurch ein Stück weit unabhängig machen und von zuhause abnabeln konnte: Ich hatte meine erste eigene Wohnung und konnte mir mein erstes eigenes Musikinstrument leisten – eine Gitarre. Denn trotz meiner Ausbildung habe ich weiterhin Musik gemacht: Tagsüber wurde gearbeitet und nachts geprobt.
Jonas:
Und wie ging es nach der Ausbildung weiter?
Ben:
Ich habe vier Jahre in einem Fotolabor gearbeitet. Dort habe ich richtig viel gelernt und konnte wichtige Kontakte knüpfen, für die ich heute sehr dankbar bin. In diesem Fotolabor habe ich viele bekannte Fotografen kennengelernt, unter anderem auch Sven Marquardt. Zu ihm hat sich im Laufe der Jahre eine enge Freundschaft entwickelt, so hat er meinen Weg ein Stück weit begleitet.
Sven lebt wie ich dieses Berlingefühl: Er bringt es durch seine Fotografie und eigene Person ähnlich rüber wie ich durch meine Musik und meine Projekte.
Das Berghain hat für mich dabei ebenfalls eine besondere Bedeutung. Ich habe meine halbe Jugend dort verbracht, dieser Club hat mich total beeinflusst.
Daher spielt der Titel meines Albums „Neon Cathedral“ auch in gewisser Weise auf diesen außergewöhnlichen Ort an: Er drückt den Spirit aus, der dort gelebt und gefeiert wird.
Das Berghain hat im Vergleich zu anderen Clubs etwas ganz Besonderes: Es wirkt fast meditativ und spirituell.
Jonas:
Das Berghain ist ein Ort, der einerseits sehr an den Kräften zehren kann und andererseits gleichzeitig die Gabe besitzt, einen glücklich zu machen – jedenfalls für einige Stunden.
Ben:
Absolut – aber wie in jedem Club kommt es auch dort immer auf dich selbst beziehungsweise deine Einstellung an. Wenn du an einem Abend von vorneherein schon nicht so gut drauf bist, kann es sein, dass dir dort deine gesamte Energie gezogen wird.
Dennoch hat das Berghain im Vergleich zu anderen Clubs etwas ganz Besonderes: Es wirkt fast meditativ und spirituell. Du kannst dich dort wirklich frei machen von allem, wenn du mit einer positiven Motivation losziehst. Und wenn du wieder gehst, bist du entweder absolut beflügelt oder total leer.
Jonas:
Wie würdest du dieses Berlingefühl beschreiben, von dem du eben gesprochen hast?
Ben (lacht):
Als eine gewisse Straßenköter-Ästhetik. Berlin ist sehr roh und dirty, dabei ständig in Bewegung. Die Stadt kommt nie an und wird nie fertig, sie befindet sich in einem unaufhörlichen Entwicklungsprozess – und irgendwie fühle ich mich als Mensch und Künstler genauso.
Wir erheben uns vom Beckenrand und schlendern ein wenig durch das alte Hallenbad. Im Eingangsbereich wurde das frühere Schwimmbecken zur Bar umfunktioniert, die das stimmungsvolle Herz des Clubs bildet. Über die Wand im Eingangsbereich erstreckt sich ein riesiges Mosaik mit Wasser- und Fischmotiven. Schnell verlieren wir unseren Blick in den vielen bunten Mosaiksteinen und haben leise den Hall von Stimmen und das Plätschern des Wassers im Ohr.
Ben lässt sich auf der kleinen Bühne am Kopf der Tanzfläche nieder. Über ihm dreht sich langsam eine Discokugel und lässt die vielen kleinen Deckenlichter gemütlich durch den Raum tanzen.
Jonas:
Du hast dich im Laufe der Jahre mehr und mehr von deiner damaligen Band „SplinterX“ gelöst und dich zunehmend auf deine Karriere als Solokünstler konzentriert. Was hat dich zu dieser persönlichen Veränderung bewegt?
Ben:
Ich war insgesamt sieben Jahre lang Teil dieser Band, die eher rohe und düstere Musik mit Hardrock-, Dark- und Gothic-Einflüssen gemacht hat. Im Jahr 2007 – damals arbeitete ich noch im Fotolabor – haben wir sogar ein gemeinsames Album veröffentlicht.
In diesem Jahr fand in Berlin auch die erste „Mercedes-Benz Fashion Week“ statt. Ich erhielt die einmalige Chance, den Soundtrack für die Kollektion des jungen Berliner Modedesigners Kilian Kerner zu schreiben.
Diese Kooperation war so erfolgreich, dass wir das Ganze insgesamt fünfmal wiederholt haben.
Während dieser Zeit wurde der elektronische Einfluss auf meine Kompositionen immer größer, ich habe mich musikalisch sehr verändert. Ich konnte meinen eigenen Musikstil definieren und wurde künstlerisch zunehmend unabhängiger von „SplinterX“.
Im Jahr 2009 wurde ich bei einer Kilian Kerner Show von einem Major Label entdeckt, wodurch auch andere Labels plötzlich auf mich aufmerksam wurden und mir diverse Angebote unterbreiteten.
Und wie das im Leben so ist, entscheidet man sich nach reiflicher Überlegung für die insgesamt beste und sinnvollste Offerte.
Jonas:
Das heißt, du konntest dich nun voll und ganz auf deine Musik konzentrieren?
Ben:
Ganz genau! Wenige Monate später, Anfang 2010, starten schon die Aufnahmen zu meinem ersten eigenen Album.
Mit der Produktion waren wir insgesamt drei Jahre beschäftigt. Aufgenommen haben wir in Schweden, gemastert in New York und gemixt im Berliner Hansa Studio. In diesen drei Jahren sind insgesamt 70 Songs entstanden, von denen es letztendlich 13 auf die Platte geschafft haben.
Jetzt, wo das Soloalbum fertiggestellt und auf dem Markt ist, habe ich das Gefühl, an einem neuen Punkt meines Lebens angekommen zu sein. Eine weitere Etappe ist geschafft – und ich bin sehr gespannt, wohin mich mein weiterer Weg noch führen wird.
Jonas:
Auf deiner Website beschreibst du dich selbst mit dem Begriff „Saviour“. Was genau willst du damit ausdrücken?
Ben:
Man darf das nicht missverstehen: Ich als Newcomer will mich natürlich nicht als den großen musikalischen Heilsbringer darstellen, das soll der Begriff absolut nicht transportieren.
„Saviour“ ist vielmehr im Sinne von Bewahren und Fortführen zu verstehen. Man kann Popmusik ja generell nicht neu erfinden, sondern lediglich bei dem ansetzen, was andere einst erschaffen und kreiert haben. Ich liebe Popmusik sowie ihre großen Vertreter der 80er und 90er total und wollte daher ihre Ideen einfach weiterentwickeln.
Meiner Meinung nach gibt es in Deutschland leider nichts Vergleichbares. Die musikalische Landschaft hier wird dominiert von deutschsprachigen Singer/Songwritern. Die machen alle tolle Musik und haben daher auch ihre absolute Berechtigung, aber mir fehlt hier einfach dieses internationale Entertainment-Element eines klassischen Pops, der trotzdem Tiefgang hat und anknüpft an das, was sich in diesem Genre in den späten 70ern und frühen 80ern entwickelt hat. Ich glaube, dass man die Popmusik jener Zeit auch heute noch anbieten kann, wenn man sie nur zeitgemäß interpretiert.
Jonas:
Viele Menschen verbinden Popmusik nicht unbedingt mit inhaltlicher Tiefe. Diese Tiefe suchen sie eher beispielsweise im Indie-Bereich. Hat die heutige Popmusik deiner Meinung nach ihre Inhalte verloren?
Ben:
Ich würde sagen ja – auch wenn es sich dabei um eine sehr subjektive Einschätzung meinerseits handelt. Ich finde, die Popmusik ist insgesamt sehr flach geworden.
Ich mag zum Beispiel die neue Single von Lady Gaga sehr, das ist eine super Nummer. Der Song wirkt authentisch und transportiert sicherlich ihre Seele – dennoch gibt er inhaltlich für mich nicht wirklich viel her.
Mir ist es bei Ben Ivory wichtig, dass der Fokus viel stärker auf dem Inhalt bzw. den Lyrics liegt und dabei das unterstreicht, was neben dem musikalischen Part passiert.
Aber auch dieses Empfinden ist wieder total subjektiv: Es gibt bestimmt den ein oder anderen, der sagt, das alles sei absolut naiv, was ich mache, und klinge total wie Schlager. Man weiß ja nie, wie die Meinungen so sind. Damit muss man einfach leben.
Ich glaube trotzdem, dass ich mich auf dem richtigen Pfad befinde. In Deutschland wird so viel kopiert und Arbeit nach Plan verrichtet, dass man geradezu Musik vermisst, die neue Wege geht und auch einmal etwas riskiert – wie etwa neue Stile in der klassischen Popmusik auszuprobieren und zu etablieren. Bisher ist sie hier ja eher langweilig und klingt wie Plastik.
Mit „Neon Cathedral“ habe ich daher versucht, Elemente vieler verschiedener Musikrichtungen in den Popsound des Albums zu integrieren und eingängige Hooklines zu erzeugen. Ich hoffe, damit konnte ich der allgemeinen musikalischen Entwicklung in Deutschland ein wenig entgegenwirken und an die Popmusik von früher anknüpfen.
Jonas:
Dabei wirkt die Visualität von Ben Ivory ebenfalls wie eine Interpretation jener goldenen Zeit der Popikonen…
Ben:
Für mich war die Bühne immer schon mit Performance verbunden. Meine Großmutter, die nicht nur einen Chor leitete, sondern auch über einen gewissen Theaterbackground verfügte, hat mir früh bestimmte Skills mit auf den Weg gegeben. Sie sagte einmal zu mir: „Junge, du kannst nicht einfach nur auf die Bühne gehen und dein Liedchen runterrattern. Du musst den Leuten auch etwas bieten können und sie irgendwo abholen. Du hast Arme und Beine, also benutze sie!“
Sie hatte Recht, denn es ist tatsächlich so, dass man die Wirkung eines Songs durch Bewegung, Kostüm und Make-up wesentlich unterstreichen kann. Für meine Musik ist das umso wichtiger, da sie emotional ist und im besten Fall unter die Haut gehen soll.
Ben Ivory ist zu mir geworden und nicht umgekehrt.
Jonas:
Wie ist die Kunstfigur Ben Ivory entstanden, wie hat sie sich entwickelt?
Ben:
Diese Geschichte ist eigentlich etwas schizophren. Als Kind und Jugendlicher war ich immer sehr unsicher und wenig selbstbewusst. Ich fand mich selbst nie so toll, cool oder schön.
Die Figur Ben Ivory gab mir damals einfach die Möglichkeit, mir ein Alter Ego zuzulegen und dadurch zu mehr Selbstbewusstsein zu finden.
Wie Oscar Wild schon sagte: „Gib ihm eine Maske und er wird dir die Wahrheit sagen.“
Mittlerweile bin ich aber an einem ganz anderen Punkt angelangt. Ben Ivory ist zu mir geworden und nicht umgekehrt. Daher ist es auch keine Kunstfigur mehr, sondern ein Teil meiner selbst. Natürlich ist Ben Ivory vom Look her nach wie vor sehr artifiziell. Dennoch steht dahinter eine authentische, greifbare Person mit einer menschlichen Seele, die das, was sie sagt und singt, auch so meint – eine Show ohne Fassade.
Ben verlässt die kleine Bühne und lächelt zufrieden. Dabei spiegeln sich die vielen goldenen Deckenlichter in seinen Augen, die von der Discokugel zum Tanzen gebracht wurden.
Als wir uns von dem jungen Musiker verabschieden wollen, flackern hinter dem Mischpult aus der tiefen Dunkelheit drei rote Leuchtstoffröhren auf, die zu einer Herzform gebogen sind und nun im Sekundentakt pulsieren.
Es wirkt, als hätte Ben das Herz des alten Schwimmbads gewonnen, das sich äußerst wohl zu fühlen scheint in seinem neuen Leben als Club „Prince Charles“. Es gibt eben Orte in Berlin, die brauchen etwas Zeit, um herauszufinden, wer sie wirklich sind.
Doch sind sie einmal angekommen in ihrem neuen Ich und können sein, was sie sein wollen in der großen Stadt, strahlen sie oft heller, als man es je zuvor vermutet hätte – und mindestens so hell wie Elfenbein.
Ben Ivory ist Musiker und lebt in Berlin.
Alexander Sternberg
Submission — Juliane Müller
Sortierte Welt
27. Oktober 2013 — MYP No. 12 »Meine Stille« — Text: Alexander Sternberg, Foto: Uwe Tautenhahn
aus jetzt…
ja alles aus
kein Netz
keine Gedanken der Anderen
keine eigenen Gedanken
nicht nachgucken
ausmachen das Ganze
eine ganze lange Zeit
keine Botschaft
keine Entscheidung
Synapsen und Ätherfrei
keine App und kein Verdruss
bitte halt doch kurz deinen Mund
und in deiner Stille wäre ich ein anderer.
Alexander Sternberg ist 40 Jahre alt, Schauspieler und lebt in Berlin und Los Angeles.
Carina Mähler
Submission — Carina Mähler
Heimlich, schnell und laut
27. Oktober 2013 — MYP No. 12 »Meine Stille« — Text & Foto: Carina Mähler
Ich sitze im Auto auf dem Weg zu Opa. Es ist Juli und die Sonne scheint. Ich fahre um die 200 km/h und meine Playlist ist auf Zufallswiedergabe gestellt. Mein Handy hat mich eben schon gewarnt, dass bei dem zu lauten Hören von Musik bleibende Hörschäden entstehen können. Weiß ich, danke.
Ein neuer Track fängt an. Ich erkenne Bon Iver „Wolves (Act I & II)“ — mein „Oma-ist-gestorben-Song“. Und mir fällt auf, ich fahre zu Opa, nicht zu Euch. Nur zu Opa. Du wirst nicht da sein. Das hatte ich erfolgreich verdrängt. Dass du nicht mehr da bist, habe ich das letzte halbe Jahr wirklich gekonnt ignoriert.
Als ich das letzte mal bei euch war, war zu deiner Beerdigung. Es war Januar, kalt und grau. Ein perfektes Wetter zum Sterben.
Ich erinnere mich daran, dass ich mich von diesem kollektiven Trauern fern gehalten habe und so ziemlich als Erste wieder gefahren bin. Und vor allem, dass ich am wenigsten geweint habe. Ich frage mich gerade, wann ich das eigentlich verlernt habe. Weinen. Ich weiß nur, dass ich echt schlecht drin bin. Und erst recht vor anderen. Egal vor wem. Weinen vor anderen und trauern mit anderen. Kann ich nicht.
Mir kommen zwei Momente in den Kopf. Der erste, als Opa allein an der Haustür stand und mir gewunken hat, als ich gefahren bin. Sonst standest du da immer noch in seinen Armen neben ihm und hast mit deinem goldenen Lächeln auf Wiedersehen gesagt. Und der zweite, als Papa an deinem Sarg stand und gesagt hat: „Tschüss Mutter“.
Die Musik läuft und ich fahre schneller und ich weine. Oma, die Tränen laufen.
Mir fällt auf, dass ich es wirklich geschafft habe, in den letzten 184 Tagen nicht einen Moment lang zu verarbeiten. Und jetzt sechs Monate später sitze ich im Auto und weine.
Oma, ich liebe dich und ich glaube, ich habe gerade bei 200 km/h auf der linken Spur bei extrem lauter Musik Abschied von Dir genommen.
Heimlich, schnell und laut.
Carina Mähler ist 21 Jahre alt, Kommunikationsdesignerin, freie Autorin und lebt in Wiesbaden.
Hugo Ismael Ruiz
Submission — Hugo Ismael Ruiz
Between notes and chords
27. Oktober 2013 — MYP No. 12 »My Silence« — Text: Hugo Ismael Ruiz, Translation: Omar Stumpfs, Photo: Noe Britez
– Do you love me?
– … (sighs)
He grabs his stuff and walks away slowly.
Many times we underestimate the power of silence, we think it has no value and we demand ourselves to make noise, we yell and stomp to call for attention without considering that silence says more, the absence of words or sound also communicate and we can not take this into account in our creation process.
In cinema or any audiovisual material it’s an essential resource, this fake peace that is born before you see the evil guy hunting his prey, this empty spot that represents the main character’s loneliness, this calm moment after an action scene, the lover’s hesitation before answering a question, the almost soundproof sighs, the quietness representing a secret, whatever the situation is, in an almost anonymously way, silences has been the pillars below the narrative’s construction. In theaters, a fortiori, is inherent, is not just a resource, is one of its main features, besides the words and visual resources, the silence of the characters represent a feeling, something hidden, a truth that wishes to come out.
Also in music for example, a string orchestra. If we take a score, silence is put between notes and chords, in some parts all instruments play harmoniously and in other parts we silence the viola to give greater prominence to the cello or a violin solo; anyways, a generous and programmed silence after the final composition.
Af the time of creation it’s also the best ally, we load our minds with songs, sounds, images, landscapes, old movies or the last thing we watch on YouTube, looking for the perfect trigger for our ideas, but is not until we turn everything off and we deeply think about what we have collected that the silence is present, giving us what we need to process all the information, peace.
Let’s use silence, do not underestimate it, let it be present in every play and our process to create them, let’s remember every time that silence… counts.
Hugo Ismael Ruiz is a 23-year-old graphic and web designer living in Capiatá, Paraguay.
Sladek
Submission — Sladek
Kopfkino
27. Oktober 2013 — MYP No. 12 »Meine Stille« — Text: Sladek, Foto: bacoo-pix
Meine Stille ist ein Blick. Vom Dunkel ins Mondlicht. Ein Warten am geöffneten Fenster — nichts sagen, nur atmen.
Mich streift ein Nachtwind, umwebt mich kühl und leicht wie Nebel. Das Verlangen ihn zu fangen ist so groß! Warum kann ich nicht die Arme ausstrecken, ihn greifen und behalten?
Enttäuscht drehe ich mich weg und werfe mich auf’s Bett. Ich starre hoch, die Zimmerdecke wird zur Leinwand.
Kopfkino: Szenen reihen sich aneinander, kreisen und reißen ab. Ich schließe die Augen. Will ein Stein sein.
Meine Stille ist ein Wunsch. Ich kann nicht mehr warten. Ich rufe. Ich atme.
Sladek ist 23 Jahre alt, Songwriter und lebt in Köln.
Van Bo Le-Mentzel
Submission — Van Bo Le Mentzel
Ein Quadratmeter Stille
27. Oktober 2013 — MYP No. 12 »Meine Stille« — Text: Van Bo Le-Mentzel, Foto: Fritz Lorber
Ein Haus für Obdachlose? Was wurde nicht schon alles erfunden: Kisten aus Sperrholz, Rucksäcke zum Aufklappen, Häuser aus Pappe, Zelte in leuchtendem pink und Bushaltestellen, die sich nachts verwandeln. Viele Architekten haben sich die Zähne ausgebissen.
Auch ich habe mir mal Gedanken gemacht. So ist das One-Sqm-House entstanden, das kleinste Haus der Welt. Es hat nur einen Quadratmeter Grundfläche. Wenn man es auf die Seite kippt, kann man darin schlafen. Das Haus hat ein Spitzdach, ein Fenster und – das aller wichtigste – eine Tür.
Eine Tür bedeutet: frei sein zu entscheiden, wann ich für andere sichtbar bin und wann nicht. Still sein mit seinen Gedanken und Gefühlen. Dieser Quadratmeter gehört nur mir. Vielleicht der letzte Quadratmeter in dieser gerasterten Welt, wo meine Gedanken frei bleiben.
Viele Menschen haben das Haus an unterschiedlichen Ecken der Welt nachgebaut. In Chicago baute die Coalition for Homeless People zwei Häuser, im österreichischen Dorf namens Goldegg entstanden zwei Häuser direkt am Goldegger See.
Ich selbst habe mich mal mitten in Berlin auf die Mittelinsel einer stark befahrenen Hauptstraße in ein One-Sqm-House gelegt. Es war nicht wirklich still, aber ich fühlte mich in Ruhe gelassen. Ich habe es genossen und eine Viertelstunde gedöst. Ich war zufrieden und gleichzeitig sehr stolz, dass ich einen Raum geschaffen habe, der irgendwie heimelig war, obwohl er unheimlich klein war.
Ich fragte mal einen Obdachlosen, wie er das One-Sqm-House findet. Der hagere Mann mit dem unglaublich wachen Blick sagte, dass er sich nicht vorstellen könnte, darin zu schlafen. Menschen, die am Rand der Gesellschaft leben, wollen keine Sonderlösungen.
Und dann wurde mir bewusst, dass jeder Versuch, Obdachlosigkeit mit Obdach zu lösen, zum Scheitern verurteilt ist. Er sagte: „Wir wollen ein ganz normales Leben in einem stinknormalen Haus.“
Van Bo Le-Mentzel ist Architekt und selbst ernannter Karma Ökonom.
Bauplan auf: www.hartzivmoebel.com
Jonas Meyer
Submission — Jonas Meyer
Meeresrauschen
27. Oktober 2013 — MYP No. 12 »Meine Stille« — Text & Foto: Jonas Meyer
Wie lange ich hier schon stehe, das weiß ich nicht. Einige Minuten vielleicht. Oder eine Stunde – wen kümmert’s. Zeit ist ohnehin nicht existent an diesem wundervollen Ort.
Und so geht es gerade nur um mich, die Sonne und das Meer. Keinen einzigen Gedanken verschwende ich an jenes ständige Zuviel, das zuhause bereits hektisch mit den Hufen scharrt und zähnefletschend auf mich wartet.
Die Drohkulisse, die es aus der Ferne aufbaut, reicht einfach nicht an mich heran: Sie wird verschluckt vom Rauschen des Pazifiks und verschwindet irgendwo im Dunkelblau.
Während sich meine Augen in der Unendlichkeit des Horizonts verlieren, wächst langsam in mir die Frage nach dem Sinn – dem Sinn, zurückzukehren und mich jenem ständigen Zuviel zu unterwerfen, das nur darauf wartet, mich zu packen.
Plötzlich höre ich Stimmen hinter mir: Cris und Rem wollen in Santa Barbara sein, bevor es dunkel wird. Die Sonne, das Meer und ich schauen uns traurig an und fallen uns in die Arme: Es ist Zeit, sich zu verabschieden.
Als wir uns ein letztes Mal umarmen, streckt mir der Pazifik ein kleines Geschenk entgegen: „Das ist etwas von meinem Meeresrauschen, es beschützt dich vor dem Monster.“
Überglücklich packe ich das Geschenk in meine Tasche, laufe zur Straße und steige ins Auto. „See you soon!“, flüstere ich leise. Ich komme bald wieder.
Denn hier geht es nur um mich, die Sonne und das Meer.
Jonas Meyer ist freiberuflicher Art Director und Publizist und lebt in Berlin.
Olga Lakritz
Submission — Olga Lakritz
Wenn nichts passiert
27. Oktober 2013 — MYP No. 12 »Meine Stille« — Text & Foto: Olga Lakritz
Und du sitzt immer noch da
und schweigst
Und du sitzt immer noch da und
Und du sitzt immer noch da
Und du sitzt immer noch
Und du sitzt immer
Und du sitzt
Und du
Und
Nichts mehr.
Wir haben uns in den Tiefen unseres Gespräches verloren, weil wir vergessen haben, an die Oberfläche zu tauchen, um Mal nach Luft zu schnappen. Stattdessen sind wir immer tiefer gesunken, bis wir dann auf dem Boden saßen. Wir haben uns in der Dunkelheit verirrt, sind tausend Gänge entlang gerannt, aber haben dabei nichts kapiert.
Wir haben nur unsere Wut in Wörter gepackt und uns gegenseitig an den Kopf geworfen.
Bloß geplatzt sind nicht unsere Köpfe, sondern die Seifenblase um uns herum.
Ich weiß und du weißt, dass es nicht funktionieren wird, denn wir haben von allem ein bisschen zu viel — und doch zu wenig.
Wir haben zu viel Wut aufeinander, aber zu wenig Mut, um es auszusprechen. Wir haben zu viel Angst vor der Zukunft, aber zu wenig Zuversicht in uns selbst.
Gleichzeitig haben wir den Mut, wir selbst zu sein, aber spüren zu wenig Wut, um uns zu äußern. Wir haben zu viel Zuversicht in die Welt und deswegen zu wenig Angst, die uns zur Veränderung treiben würde. Es bleibt immer alles gleich.
Was bringt mir der neue Tag, wenn er sich wie jeder vergangene anfühlt?
So sassen wir irgendwann nur noch da und warteten. Wir warteten darauf, dass einer von uns endlich einen Schlussstrich zog und den anderen verliess. Wenn ich an die Zeit zurück denke, kommt es mir so vor, als wären wir Wochen, Monate nur da gesessen und hätten uns beim Atmen zugehört, dabei haben wir uns ständig gestritten, haben rumgeschrien.
Aber wenn ich zurück denke höre ich nur noch unsere Stille.
Und du sitzt immer noch da und schweigst
Und du sitzt immer noch da und
Und du sitzt immer noch da
Und du sitzt immer noch
Und du sitzt immer
Und du sitzt
Und du
Und
Jetzt wo du weg bist, da höre ich nur noch meine Stille.
Olga Lakritz ist 18 Jahre alt, Slam-Poetin und lebt in Zürich.
Cetywa Powell
Submission — Cetywa Powell
Moments Of Creation
27. Oktober 2013 — MYP No. 12 »My Silence« — Text & Photo: Cetywa Powell
It was before a concert and I was waiting… just waiting… there was time to spare. I was staring at this monumental structure across the street: the Walt Disney Concert Hall. So I crossed over to see it, explore it.
The building is majestic, creative, an invention of a master mind. There were few people; it was a weekday after all. And I could move at my own pace, through the curving walls.
I’ve only been able to appreciate Frank Gehry’s architectural designs through the lens of my camera:
seeing the curves he intended, the futuristic, spaceship feel.
Lost in the architectural silence, I think I got what his mind saw in those moments of creation. It felt like a window, really, into his genius.
Cetywa Powell is a filmmaker living in Los Angeles, California.
Chris Ratz
Submission — Chris Ratz
Ten Days Of Silence
27. Oktober 2013 — MYP No. 12 »My Silence« — Text: Chris Ratz, Photo: Samantha Ravenda
“Does it feel like you are taking me to some strange summer camp?” I asked, looking at the directions in my shaky hands. “Yes, kind of”, admitted my father. My parents had offered to drive me to the meditation retreat I was embarking upon. I think they were mildly nervous about it, and wanted to see where I would be spending the next ten days.
Though I had been talking about doing this for the past fourteen years, no one was as nervous as me. Ten days of waking up at four a.m. Ten days of intense meditation practice. Ten days of silence. “How are you going to go ten days without talking?” That is what I heard from everyone when I told what I was doing. It was a fair enough question, if mildly insulting. I’d never even meditated before.
To everyone around me it seemed I lived a pretty loud life. “I’m single. I actually spend most of my time in silence”. That said, get a couple of drinks in me and I would not stop vying for the center of attention, so I understood it. I often had more than a couple of drinks in me.
Mostly I was terrified of sitting for an entire hour at a time without moving. I’ve never had a desk job, and I chose films to watch based on which one was shorter. So, finding silence in my body was no small challenge. Finding silence in my mind was, even at the end of the course, nearly impossible.
The silence from not speaking to anyone turned out to be the easiest part of the whole thing, and to my surprise, a huge relief. It didn’t take me long to realize how much of my time was noisily spent trying to formulate and influence people’s opinion of me. Once the course started I was suddenly not allowed to concern myself with others’ thoughts.
Ten days later, when we broke our silence, I looked down at my hands. They were shaking like the day I arrived. It was incredibly strange to start speaking again, to look people in the eye. It didn’t take long for me to start rattling my mouth off again, but I came away with a very strong appreciation for silence. It has become a very important part of my life. Something I never knew how much I needed.
Chris Ratz is one of the main characters of the movie “The Mortal Instruments: City of Bones” and the TV series “Bitten”
Chris Ratz is a 31-year-old actor living in Toronto, Canada.