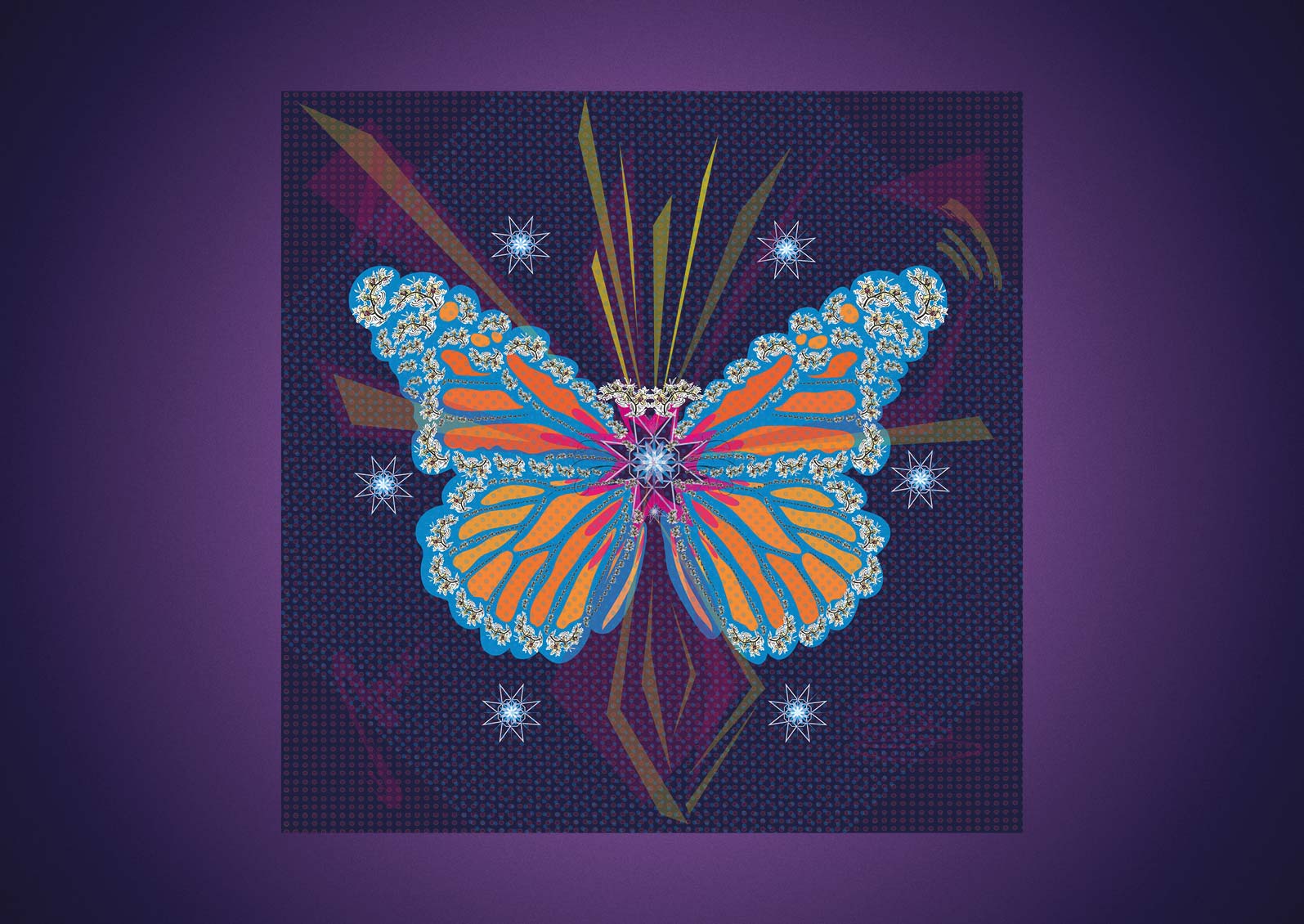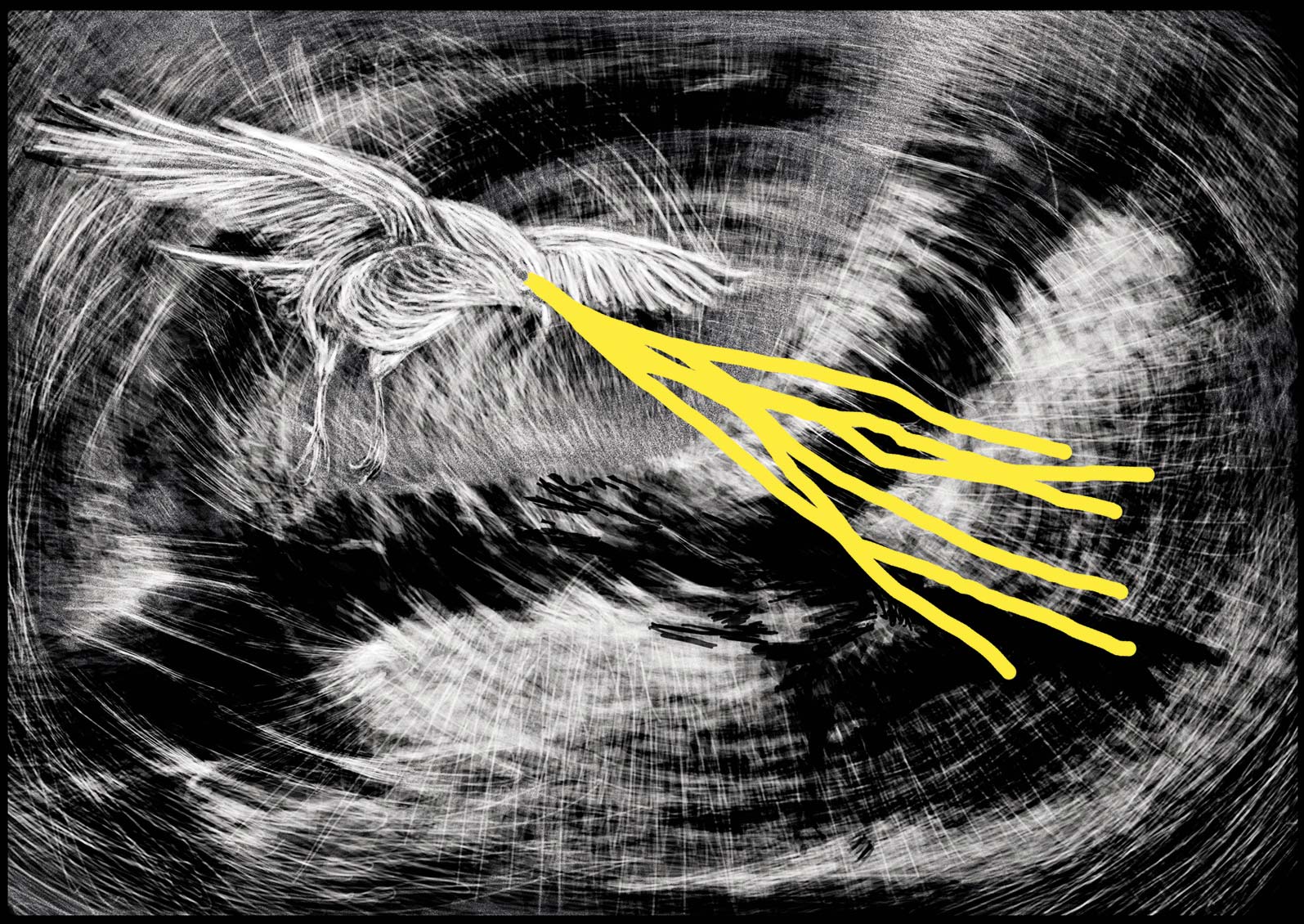Jonas Meyer
Submission — Jonas Meyer
Die Möwe
19. Januar 2014 — MYP No. 13 »Meine Sehnsucht« — Text & Foto: Jonas Meyer
In welchem Glück sie schwebt, das ahnt sie nicht. Nur wenige Male muss sie mit ihren Flügeln schlagen, um aus königlicher Höhe beobachten zu können, wie der Pazifik seine glitzernden Wellen auf die Küste rollt.
Hätte man einen Wunsch frei, man würde wohl ohne Zögern mit ihr tauschen: So könnte man fliegen, wohin man wollte. Und fliehen – jederzeit.
Man könnte sich tragen lassen vom kalifornischen Wind und seine Lungen fluten mit salziger Luft.
Mit der Sonne im Rücken und dem Meer vor Augen könnte man sich im Flug sein Glück erbeuten – und es teilen. Mit jemandem.
Dann würde man erkennen, dass das Besondere nicht im Fliegen liegt, sondern einzig und allein im Teilen – und dass es keine Flügel braucht, um königlich im Glück zu schweben.
Doch davon ahnt sie nichts, die Möwe.
Davon ahnt sie nichts.
Jonas Meyer ist Art Director, Herausgeber und lebt in Berlin.
Doris Schamp
Submission — Doris Schamp
Stadt der Engel
19. Januar 2014 — MYP No. 13 »Meine Sehnsucht« — Text & Kunstwerk: Doris Schamp „Fly like a Monarch in Big Sur“, 100 X 100 cm, Giclée print
Sie hat mich bis in die Stadt der Engel getragen, um neue Wege zu beschreiten und von Null anzufangen. Ich kam an mit einem Koffer in Los Angeles. Eine Sehnsucht hatte mich so weit von der Heimat fortgetrieben, wie der Wind ein Boot am Meer davontreiben kann. Keiner kannte meine Kunst hier, die wenigsten zu Hause verstanden meine Entscheidung, am Anfang war ich verloren, wie jeder hier. „Willkommen in der Stadt der Träume und Sehnsüchte.“
Ich wurde bald gefunden, entdeckt, von einer Galerie. Spürten die Leute hier etwa meine Sehnsucht, sodass Sie mir eine Chance geben wollten in der Stadt der many „Lost Angeles“?
Die Sehnsucht danach, mich künstlerisch auszudrücken hat mein Leben bisher geleitet und sie war ein guter Beschützer. Jeder Mensch hat diese Sehnsucht nach einer Freiheit…nach der Freiheit, endlich seine Träume zu verwirklichen. Manche verbringen ihr Leben damit, von diesen Träumen zu erzählen. Bei vielen bleibt es ein Traum, da die Sucht nach dem Sehnen nicht groß genug ist.
Ich bin süchtig nach dem Sehnen, nach dem Sehnen nach Kunst und nach dem Hinterlassens eines Werkes. Es ist meine Triebfeder für mein Schaffen, aus Linien und Farbflächen die lebendig auf dem Papier tanzen, bis sie Ihren Platz gefunden haben.
Doris Schamp ist 30 jahre alt, freischaffende Künstlerin, Cartoonistin und lebt in Los Angeles.
David Uzochukwu
Submission — David Uzochukwu
Nichts als grau
19. Januar 2014 — MYP No. 13 »Meine Sehnsucht« — Text & Foto: David Uzochukwu
„I adore these moments when everything is just right. Your thoughts stop running and it becomes clear that these are the moments we are living for. Perfectly peaceful and a bit eternal. These moments we will collect and remember. Smiling every time we reminisce.“ – Laura Zalenga
Ich lebe seit acht Jahren in Luxemburg. Hier ist es grau und verregnet, fast das ganze Jahr über. Luxemburg erinnert an Geisterstädte aus Westernfilmen: es ist tot und besteht aus kaum mehr als Fassaden.
Es ist ermüdend, jeden Tag nichts als Grau zu sehen. Es macht die Menschen apathisch. Man lässt alles an sich vorbeiströmen – es ist sowieso alles gleich.
Deshalb gibt es wenig, wonach ich mich mehr sehne, als richtig zu leben: dem Alltag zu entfliehen und mit leuchtenden Augen und leidenschaftlichen Menschen Erinnerungen zu schaffen. Tief einatmen und alles loslassen zu können.
Ich sehne mich nach diesem Funken in Menschen, nach Spontaneität und Abenteuer. Nach Momenten, an die wir uns erinnern können, wenn wir alt sind; nach Momenten, die einen wieder in ihren Bann ziehen, wenn man auf sie zurückblickt. Nach Momenten, die das Leben lebenswert machen.
David Uzochukwu ist 15 jahre alt, Schüler, Fotokünstler und lebt in Luxemburg.
Yannick Riemer
Submission — Yannick Riemer
Neue Wege finden
19. Januar 2014 — MYP No. 13 »Meine Sehnsucht« — Text & Foto: Yannick Riemer
Die große Bühne bleibt auf jeden Fall heute für mich verschlossen. Der Vorhang ist gefallen, ohne sich geöffnet zu haben.
Schon der Sicherheitsmann hat mich an der Eingangstür abgewiesen, obwohl das doch mein großer Tag werden sollte. Das dachte ich zumindest. Selbstbewusst und stark habe ich mich gefühlt, als ich heute Morgen den ersten Schluck von meinem schlechten Kaffee getrunken habe.
Sogar die Tatsache, dass ich wieder neben meinem Bettnachbarn wach geworden bin, weil ich mir im Moment nicht mehr leisten kann, haben daran nichts geändert!
„Fick, fick, fick das System!“ schallte es aus den Lautsprechern und wirkte plötzlich nur noch wie eine Erinnerung. Ich will nicht
mehr zerstören, nur noch bauen, dachte ich mir. Auch meine Bilder, die an den Wänden in unserem Zimmer hängen, deprimierten mich nicht mehr. Ich habe sie zum ersten Mal als das gesehen, was sie sind:
Abbildungen meiner eigenen Entwicklung, nicht besonders schlecht oder gut, nur Momente. Ob ich davon irgendwann mal leben kann? Das war mir egal. Ich wollte einfach nur vorwärts.
Und jetzt, wo ich hier vor dem großen verschlossenen Tor stehe, weiß ich plötzlich nicht mehr wo lang. Also hämmere ich an der Tür, trete, schreie und versuche, sie zu zerstören, aber sie ist zu stark für mich. Meine Hand pocht und ist angeschwollen. Sie lässt sich kaum noch bewegen, mein Herz schlägt mir bis zum Hals und ich zittere am ganzen Körper.
Ich kannte immer nur eine Richtung und die war vorwärts. Umkehren, Rückschritt, neue Wege finden, das alles war mir fremd. Bis jetzt. Und auf einmal bin ich mir gar nicht mehr sicher, was das überhaupt ist.
Ich brauche neue Türen, die ich einrennen kann. Wohin das dann führt, ist mir egal. Ich will mich einfach nur noch bewegen.
Yannick Riemer ist 23 Jahre alt, Grafikdesigner und lebt in Berlin.
David Schermann
Submission — David Schermann
L'appel du vide
19. Januar 2014 — MYP No. 13 »Meine Sehnsucht« — Text & Foto: David Schermann
Kennst du das Gefühl?
Du stehst an einem Abgrund, egal ob Klippe, egal ob Stiegenhaus. Vor dir geht es tief hinab. Plötzlich spürst du ein Gefühl. Was, wenn ich jetzt springe? Was würde passieren?
Es sind keine selbstvernichtenden Gedanken, es ist die einfache Neugier. Die Sehnsucht nach dem rauschenden Gefühl während des Sprunges. Im Französischen gibt es einen Ausdruck dafür: L‘appel du vide, der Ruf der Leere.
David Schermann ist 22 Jahre alt, Student, Fotokünstler und lebt in Wien.
MYP12 – Prolog "Meine Stille"
Editorial — MYP Magazine N° 12
Prolog »Meine Stille«
27. Oktober 2013 — David Peroz fotografiert von Osman Balkan
— David Peroz im Interview
David Peroz
Interview — David Peroz
Stiller Held
Vor einigen Wochen haben wir David Peroz kennengelernt – durch puren Zufall. Jetzt streift er mit uns durch den Norden Berlins, um uns an seine ganz persönlichen Orte der Stille zu führen. Ein Gespräch über Waghalsigkeit, Demut und den großen Nachteil von materiellem Besitz.
27. Oktober 2013 — MYP No. 12 »Meine Stille« — Interview: Jonas Meyer, Fotos: Osman Balkan
Es gibt Menschen, die behaupten, es gebe keine Zufälle im Leben. Alles sei vorherbestimmt und alles habe seinen Grund. Geschehen würde es, weil es so geschehen solle. Und das sei gut.
Es braucht ein wenig Mut, um sich einzulassen auf ein Spiel, das Zufall als reine Illusion versteht und dem Leben so etwas wie Bedeutung schenkt – wie etwa damals, an jenem Abend des 21. Juni 2013, als man im Nordosten Kreuzbergs die „Fête de la musique“ beging.
In einem kleinen Atelier am Schlesischen Tor tummelten sich wie überall die Menschen, um Station zu machen auf ihrer langen Reise durch die Nacht. Sie tanzten, rauchten, redeten und tranken. Und verließen die einen irgendwann den kleinen Raum, füllten neue Gesichter prompt die freien Plätze.
In der Mitte jenes Raumes stand zwischen all den Leuten fast regungslos ein junger Mann – tief in sich ruhend und völlig unbeeindruckt vom lauten bunten Chaos. Die Zeit raste, immer mehr Menschen kamen und gingen.
Der junge Mann stand weiter regungslos, atmete tief ein und schloss langsam seine dunklen Augen. Er lächelte – und für den Bruchteil einer Sekunde war etwas greifbar, das an ein wenig an Glückseligkeit erinnerte und gehalten war von purer Zuversicht.
Einige Wochen später.
Wir sind in den Norden Berlins gefahren, genauer gesagt in den beschaulichen Ort Waidmannslust. Wir sind mit David Peroz verabredet – jenem jungen Mann, der in dem kleinen Raum die Zeit angehalten hatte mit seinem Lächeln. Einfach so.
Es ist früher Nachmittag. Kaum haben wir uns begrüßt, schlägt David vor, uns bei einer kleinen Autofahrt die Gegend in und um das schöne Waidmannslust zu zeigen. Der junge Mann hat die meiste Zeit seiner Kindheit und Jugend hier verbracht und kennt sich demnach bestens aus. Nach einer etwa zwanzigminütigen Rundreise erreichen wir einen kleinen Parkplatz am Rande eines großen, dichten Waldes.
Dieses unberührte Stück Natur wirkt wie ein Schutzwall gegen das chronische Zuviel der Hauptstadt. Vor etlichen Jahren, so erzählt David, haben seine Eltern daher festgestellt, dass Waidmannslust genau der Ort ist, an dem sie leben und alt werden wollen. Also haben sie Charlottenburg den Rücken gekehrt und sind mit ihren zwei Söhnen in den Berliner Norden gezogen.
Davids Vater stammt aus Afghanistan und zog im Jahr 1978 von Kabul nach Westberlin, um dort Informatik zu studieren. Seine neue Bleibe sollte damals ein Studentenheim am Teufelsberg sein. Davids Mutter dagegen ist gebürtige Schwarzwälderin, die sich Ende der Siebziger bei der ZVS um einen Studienplatz in Zahnmedizin beworben hatte.
Die ZVS wies ihr einen Studienplatz in Berlin zu – doch was heute der Traum eines jeden Erstsemesters ist, war in der Zeit des Kalten Krieges so ziemlich das Letzte, was sich Eltern für ihre Kinder wünschten. Zu groß war die Bedrohung, zu mulmig das Gefühl im Bauch.
Dennoch trat sie wenig später dort ihr Studium an – und ihr Weg führte sie geradeaus in dasselbe Studentenwohnheim am Teufelsberg, in dem ein Jahr zuvor schon Davids Vater eingezogen war. Der war dort mittlerweile Ansprechpartner für die Erstsemester, weshalb sich beide bald begegneten. Ab dem ersten Moment, so erzählt David, habe sein Vater gewusst, dass dies die Frau ist, die er heiraten will – was er ein Jahr später auch tatsächlich tat.
Jonas:
Denkst du manchmal darüber nach, wie sich die Dinge wohl entwickelt hätten, wenn sich deine Eltern damals nicht am Teufelsberg begegnet wären?
David:
Früher habe ich mir darüber tatsächlich öfter mal Gedanken gemacht. Aber diese Gedankenspiele enden ja relativ schnell, weil man in jenem speziellen Fall gar nicht geboren worden wäre.
Es gibt zwar Menschen, die die Theorie vertreten, dass die Seele immer und unabhängig von einem Körper existiert und es unerheblich ist, wie und wann man geboren wird, aber ich persönlich glaube, dass mein Leben auch dann nicht genau so gewesen wäre, wie es bis jetzt gewesen ist. So ist das Einzige, was ich wirklich in mir trage, ein unbeschreibliches Gefühl von Glück – weil ich mein Leben wirklich mag.
Wenn ich Gefahren einschätzen soll, merke ich oft erst im Nachhinein, wie waghalsig ich eigentlich unterwegs war.
Jonas:
Als dein Vater damals zum ersten Mal vor deiner Mutter stand, wusste er instinktiv, dass sie die Richtige ist. Lässt du dich selbst auch weitgehend von deinem Instinkt leiten?
David:
Das kommt sehr auf die Situation an. Wenn es etwa darum geht, einen anderen Menschen einzuschätzen, kann ich mich ziemlich gut und recht schnell auf mein Bauchgefühl verlassen. Wenn ich allerdings Gefahren einschätzen soll, merke ich oft erst im Nachhinein, wie waghalsig ich eigentlich unterwegs war. Und ich stelle erstaunt fest, wie viel Glück ich letzten Endes immer wieder hatte, wenn ich beispielsweise von irgendeinem Felsen gesprungen bin oder auf dem Rennrad gesessen habe – und unzähligen Autotüren ausweichen musste.
In beruflichen Dingen neige ich eher dazu, mich auf meine Stärken zu verlassen als über meine Schwächen nachzudenken. Ich finde, es bringt dich einfach schneller zum Ziel, wenn du dort mit einer gewissen Selbstsicherheit auftrittst.
Wir betreten den Wald und folgen David entlang eines schmalen Pfades, vorbei an Bäumen und Gestrüpp. Es hat ein wenig geregnet, Nebel liegt über dem Boden. An Blättern und Nadeln bilden sich langsam Tropfen, die irgendwann zu Boden fallen.
David führt uns vorbei an einer kleinen Lichtung zu einer Waldquelle, die etwas abseits liegt. Die alten Nadelbäume stehen hier so dicht, dass man glaubt, es sei bereits die Dämmerung angebrochen. Nur ab und zu gelingt es einem Sonnenstrahl, die dunkelgrüne Mauer zu durchbrechen und das kühle Quellwasser zum Glitzern zu bringen.
Während wir uns an diesem verwunschen wirkenden Ort ein wenig umsehen, hebt David seinen Kopf, blickt zu den Baumwipfeln und atmet tief ein. Es wirkt, als wolle er mit seinen dunklen Augen das wenige Sonnenlicht auffangen, das sich seinen Weg durch die dichte Nadelwand bahnen konnte.
Für einige Minuten genießen wir die wundervolle Stille, bevor wir uns wieder auf den Weg machen. David führt uns immer tiefer in den Wald hinein. Plötzlich spüren wir unter unseren Füßen Sand, erst ein wenig, dann immer mehr. Der sandige Weg wird breiter, wächst zu einem kleinen Hügel an und baut sich schließlich vor uns zu einer großen Düne auf – mitten im Wald, mitten in Berlin!
Tief beeindruckt steigen wir hinauf und lassen uns auf dem sonnenwarmen Sand nieder. Noch so ein Ort, an dem nichts anderes als die Stille zählt. An dem man Freiheit atmet. Und Glückseligkeit fühlt.
Wir lassen unsere Rücken in den weichen Sand fallen und schließen unsere Augen. Wärme, Licht, Unendlichkeit. In einem einzigen Moment.
Jonas:
Ist dies dein Ort der Stille?
David:
Insgesamt ist der Wald in Waidmannslust mein Ort der Reinkarnation, mein persönliches Refugium vor der Hektik der Stadt. Ich bin total glücklich, an so einem friedlichen Stückchen Erde aufgewachsen zu sein und leben zu dürfen.
Hier im Wald kann ich vollkommen in meine Umgebung eintauchen und mich lösen von meinem sozialen Umfeld. Oft suche ich mir hier einen Platz, von dem aus ich die Umgebung am besten auf mich wirken lassen kann. Ich fixiere dann irgendeinen Punkt in der Ferne und lasse mich innerlich komplett fallen – die pure Entspannung!
Ich liebe es aber auch, mich hier in der Gegend abends auf mein Rennrad zu setzen oder einfach durch den Wald zu joggen, um die physische Energie rauszulassen, die sich am Tag an der Uni angestaut hat und für die es sonst kein Ventil gab.
Zu Beginn meines Studiums bin ich für ein Jahr nach Moabit gezogen, wo ich auch schon während meiner Schulzeit recht häufig unterwegs war. Viele meiner Freunde wohnen dort, daher fühle ich mich in Moabit ebenso heimisch wie in Waidmannslust – und dementsprechend gibt es auch dort den einen oder anderen Ort, der für mich eine besondere Bedeutung hat und an dem ich Stille finde, wenn ich sie suche.
Jonas:
Ist Stille für dich eine Form von Freiheit – und Freiheit in der Konsequenz ein ebenso wichtiges Thema in deinem Leben?
David:
In gewisser Weise bedeutet das Finden von Stille für mich schon eine gewisse Freiheit. Ich glaube aber, dass ich viel zu behütet aufgewachsen bin und viel zu frei erzogen wurde, weshalb ich mich nicht erdreisten würde, Freiheit als das zentrale Thema meines Lebens zu verstehen. Trotzdem kann ich sie natürlich in ihrer tiefen Bedeutung greifen und weiß um ihren enormen Wert. Sie ist mein ständiger Begleiter und für mich die absolute Grundvoraussetzung für ein glückliches und erfülltes Leben.
Dabei wäre es allerdings ziemlich heuchlerisch zu fordern, dass jeder Mensch nach der Maxime leben sollte, möglichst frei zu sein. Es ist leider auf der Welt viel zu vielen Menschen nicht vergönnt, ein Leben in Freiheit zu führen. Ich glaube, dass mich dieses Wissen darum auch dazu bringt, mein eigenes Leben möglichst gut zu strukturieren und die Freiheit, die mir geschenkt wurde, effektiv und verantwortungsvoll zu nutzen.
Um es konkret zu sagen: Ohne diese Einstellung hätte ich wahrscheinlich kaum so früh angefangen, Jura zu studieren. Für die einen bedeutet Freiheit, überall hingehen zu können und zu dürfen. Für mich heißt Freiheit vielmehr, in jungen Jahren alle beruflichen Chancen nutzen zu dürfen, um später mit meiner Familie und meinen Kindern ein glückliches und erfülltes Leben führen zu können.
Jonas:
Also ist Familie der zentrale Begriff deines Lebens.
David:
Ja, Familie ist der erste und wichtigste Bezugspunkt in meinem Leben. Sie ist die Konstante, auf die ich mich glücklicherweise immer verlassen kann und die mich auf den Boden der Tatsachen zurückholt.
Es bringt dir absolut gar nichts, wenn du nur Leute um dich herum hast, die dir ständig sagen, wie toll du vielleicht bist oder wie gut du etwas gemacht hast.
Jonas:
Neigst du dazu, gelegentlich den Boden der Tatsachen aus den Augen zu verlieren?
David:
Mein Vater hat mich immer einen Träumer genannt, weil ich früher wahnsinnig große Vorstellungen davon hatte, was ich alles einmal werden will und wie ich mein Leben gestalten will. Dabei habe ich aber nie wirklich darüber nachgedacht, wie der Weg zu diesem Ziel tatsächlich aussehen soll.
Daher versucht mein Vater auch, mich nie zu sehr zu loben, sondern mich eher mit konstruktiver Kritik zu unterstützen und mir seine wichtigsten Weisheiten des Lebens mit auf den Weg zu geben. Auch wenn man das als Kind vielleicht noch nicht so versteht: Je älter man aber wird, desto mehr erkennt man den Sinn dahinter. Es bringt dir absolut gar nichts, wenn du nur Leute um dich herum hast, die dir ständig sagen, wie toll du vielleicht bist oder wie gut du etwas gemacht hast.
Wieder einige Wochen später, es ist mittlerweile September.
Wir treffen David Peroz ein weiteres Mal, diesmal in Moabit, was ihm neben Waidmannslust und dem Schwarzwald ebenfalls ein Zuhause ist. In einem kleinen türkischen Imbiss kaufen wir frische Gözleme und wandern zur Spree, wo wir uns gegenüber des Bellevue Ufers auf einer Mauer niederlassen. Vor uns gleiten Ausflugsboote über das Wasser, im Hintergrund ist gelegentlich das Rattern der S-Bahn zu hören.
Es wird von Minute zu Minute dunkler, die Dämmerung schleicht sich langsam ein. Während wir den Ausblick auf das hell erleuchtete Schloss Bellevue genießen, erzählt David, dass dies ein weiterer jener Orte ist, an den es ihn zieht, wenn er seine Stille sucht oder Zeit mit seinen Freunden verbringen will.
Hungrig machen wir uns über die noch warmen Gözleme her und David erklärt, dass es in Afghanistan eine ganz ähnliche Spezialität gibt, die Bolani heißt: gefüllte Teigtaschen mit Kartoffeln oder Lauch.
Ich finde, man kann Dinge nur zu 100 Prozent wirklich beurteilen, wenn man selbst vor Ort war und sich sein eigenes Bild von den Umständen machen konnte.
Jonas:
Hast du daher das Gefühl, vieles aufholen zu müssen?
David:
Oh ja, das muss ich tatsächlich. Afghanistan kenne ich ja lediglich aus den Erzählungen meiner vielen Verwandten, die über die ganze Welt verstreut sind und zu größeren Familienfesten immer wieder zusammenkommen. Da erhält man natürlich einen gewissen Einblick in die Kultur, aber das ist einfach nicht dasselbe.
Ich glaube, dass ich darüber hinaus auch etwas aufzuholen habe, was die generelle Sicht auf die Dinge und das Land angeht. Man ist bei seiner Wahrnehmung von außen ja leider der selektiven Berichterstattung der Presse ausgesetzt. In Deutschland beziehungsweise Europa werden einem in den Medien nur kleine Ausschnitte serviert, die irgendeine Redaktion für wichtig erachtet hat und die meistens mit den kriegerischen Auseinandersetzung innerhalb Afghanistans zu tun haben. Dabei wird leider komplett ausgeblendet, dass es dort auch eine funktionierende Zivilgesellschaft gibt.
Ich finde, man kann Dinge nur zu 100 Prozent wirklich beurteilen, wenn man selbst vor Ort war und sich sein eigenes Bild von den Umständen machen konnte. Und genau das ist es auch, was ich mir von meinem allerersten Afghanistanbesuch erhoffe.
Jonas:
Das heißt, du stehst den Medien eher kritisch gegenüber?
David:
Ich finde, dass es uns die heutige Informationstechnologie generell viel zu leicht macht, Wissen auszulagern und nicht mehr zu hinterfragen. Das geht an manchen Stellen sogar so weit, dass es vielen daran mangelt zu wissen, wie man im Leben zurechtkommen würde, wenn man nicht in die Komfortzone eines wirtschaftlich gesunden und friedlichen Systems hineingeboren wäre.
Unsere Großeltern im Schwarzwald wussten zum Beispiel noch, wie man Obst und Gemüse anbaut – das sicherte ihnen das Überleben. Dieses Wissen ist heute nicht mehr relevant. Man gibt sich damit zufrieden, dass im Supermarkt alles verfügbar ist. Um das Wie und Wo macht man sich dabei nicht mehr wirklich viele Gedanken.
Jonas:
Hat dich die imposante Natur des Schwarzwalds sehr geprägt?
David:
Ja, total! Wenn ich mich in Berlin in den Zug setze und im Schwarzwald wieder aussteige, atme ich tief ein und bin wie euphorisiert von der frischen Luft. Ich liebe auch das Geräusch des plätschernden Wassers, das aus einem Brunnen in der Nähe des Hauses meiner Großeltern sprudelt. So etwas ist wundervoll und hat eine sehr beruhigende und tiefenentspannende Wirkung auf mich. Afghanistan soll übrigens ähnlich atemberaubende Landschaften haben, alleine deshalb bin ich sehr gespannt darauf, was mich dort erwartet.
Ich muss aber zugeben, dass ich nach spätestens einer Woche Schwarzwald irgendwie anfange, Berlin zu vermissen. Dann setze ich mich wieder in den Zug, fahre zurück und hole am Hauptbahnhof genauso tief Luft wie bei meiner Ankunft im Schwarzwald.
Wenn ich nach einer Woche im Süden Deutschlands wieder die Berliner Luft schnuppere, denke ich jedes Mal: Es ist so schön, hier zuhause zu sein.
Jonas:
Was ist für dich denn das Besondere an Berlin?
David:
Ich glaube, es ist diese Zwanglosigkeit und Vielfältigkeit der Stadt. Alleine die Tatsache, dass wir kein wirkliches Stadtzentrum, sondern viele verschiedene Stadtteilzentren haben, finde ich wahnsinnig toll. Es gibt in Berlin so viele Möglichkeiten, sich immer genau das auszusuchen, worauf man gerade Lust hat.
David lächelt. Er scheint gerade der zufriedenste Mensch auf Erden zu sein. Während wir auf der Ufermauer sitzen und unsere Blicke auf der Spree verlieren, spiegeln sich die Lichter der Ausflugsboote in seinen tiefen dunklen Augen.
David:
Ich finde Schiffe ja richtig toll, irgendwie war so etwas immer schon mein Traum! Stell’ dir vor, du hättest ein eigenes Boot und könntest an jedem Hafen der Welt anlegen — das wäre die absolute Freiheit!
Je weniger materielle Dinge man besitzt, desto weniger kann man auch vermissen.
Jonas:
Auf so einem Boot könntest Du aber nicht wirklich viel mitnehmen.
David:
Ach, das wäre gar nicht das Schlechteste. Je weniger materielle Dinge man besitzt, desto weniger kann man auch vermissen. Und das einzig Wichtige hätte man ja eh immer dabei: sein eigenes Zuhause.
Die Nacht hat sich mittlerweile über Berlin gelegt, die Spree wirkt wie ein schwarzer Spiegel. Wir entscheiden, noch einige Meter am Ufer entlangzuwandern. Schweigend schlendern wir über die kleine Lutherbrücke und spazieren auf der anderen Wasserseite zurück in Richtung S-Bahnstation.
Nach ein paar Minuten bleibt David plötzlich stehen und lächelt. Seine dunklen Augen funkeln so stark, als hätten die bunten Lichter der Spreeboote sie zu ihrem neuen Zuhause erklärt.
Der junge Mann schließt seine Lider, atmet tief ein und hält erneut die Zeit an – wie damals, am Abend des 21. Juni 2013 im Nordosten Kreuzbergs.
Es gibt Menschen, die behaupten, es gebe keine Zufälle im Leben. Alles sei vorherbestimmt und alles habe seinen Grund. Geschehen würde es, weil es so geschehen solle.
Und das sei gut.
David Peroz ist 24 Jahre alt, Student und lebt in Berlin.
Franziska Brandmeier
Interview — Franziska Brandmeier
Innere Stimme
Wie kommt man eigentlich ins Fernsehen? Wer sich nicht bei DSDS peinlich machen will, muss es wohl mit echtem Talent versuchen: Wir fragen bei Nachwuchsschauspielerin Franziska Brandmeier nach, wie sich der Weg auf die Bühne gestaltet.
27. Oktober 2013 — MYP N° 12 »Meine Stille« — Interview: Jonas Meyer, Fotos: Steven Lüdtke
Von manchen Ecken Deutschlands scheint die große weite Welt zum Greifen nah. Wer hier verweilt, den packt die Sehnsucht – und Abenteuerlust beflügelt den Verstand.
Der Grasbrookhafen im Herzen Hamburgs ist eine dieser Ecken. Hier an der Norderelbe wird der volle Blick auf das gelenkt, was so gern als Tor zur Welt bezeichnet wird: Dutzende Ozeanriesen aus aller Herren Länder legen an und übergeben ihre Fracht an ein Heer von Kränen, die flink wie Spinnen durch den Hafen krabbeln. Sind die Schiffe neu beladen, brechen sie auf in Richtung Ferne und verschwinden irgendwann am Horizont.
Vor der Ubahn-Station Baumwall nordöstlich der Hafencity treffen wir die junge Schauspielerin Franziska Brandmeier. Nach einem herzlichen Hallo schlendern wir gemeinsam durch die Speicherstadt, laufen vorbei an der Elbphilharmonie und zahlreichen Kreativagenturen, Restaurants und Cafés, die alle hier ihr hanseatisches Zuhause gefunden haben.
Nach einigen Minuten erreichen wir den Dalmannkai am Grasbrookhafen und lassen uns auf einer kleinen Aussichtsplattform direkt am Wasser nieder. Das Tor zur Welt ist gut besucht an diesem Sonntagnachmittag, und so genießen wir mit vielen anderen den Mix aus rauem Wind und warmer Sonne. Möwen kreischen, die Luft schmeckt salzig und nach Freiheit. Spätsommer in Hamburg – wie wunderschön!
Jonas:
Du hast vor wenigen Monaten dein Abitur gemacht. Stehen in deinem Leben jetzt alle Zeichen auf Schauspielerei?
Franziska:
Mit der Schule sind ziemlich viele Strukturen in meinem Leben weggefallen, jetzt muss ich mich erst einmal selbst finden.
Auf jeden Fall ist die Schauspielerei ein sehr wichtiger Teil von mir, ich liebe sie sehr. Sie stützt mich und ist eine Konstante in meinem Leben, die mir über die Schulzeit hinaus geblieben ist.
Es wird sich einfach zeigen, wie sich das Ganze im Laufe der nächsten Monate weiterentwickeln wird. Man selbst entwickelt sich ja auch mit jeder Rolle, die man spielt.
Jonas:
Dabei kommst du eigentlich aus einem ganz anderen Bereich: Seit du drei Jahre alt bist, tanzt du Ballett. Wurdest du diesbezüglich von deinen Eltern in irgendeiner Form beeinflusst?
Franziska:
Falls du damit auf diese berühmt-berüchtigten Eislaufmütter anspielen solltest: Meine Eltern waren das absolute Gegenteil davon und haben mir alle Freiheiten gegeben.
Das war für mich auch genau das Richtige, weil ich dadurch immer für mich ganz alleine herausfinden konnte, ob ich etwas wirklich mag und weiterverfolgen will. Tanzen war immer genau mein Ding, daher gehe ich nach wie vor regelmäßig zum Ballett-Training.
Jonas:
Und wie bist du vom Ballett zur Schauspielerei gekommen?
Franziska:
Das ist eine lustige Geschichte: Als ich etwa 14 Jahre alt war, fragte ein Filmproduktionsteam meine Eltern, ob sie einige Szenen auf dem Grundstück unseres Hauses drehen dürften. Meine Eltern hatten nichts dagegen und so wurde direkt vor unserer Haustür gefilmt. Das war alles total aufregend für mich.
Und da ich schon immer eine große Klappe hatte, habe ich bei diesen Leuten einfach mal nachgefragt, ob sie wüssten, wie man Schauspielerin wird, und ob sie mir da irgendwie weiterhelfen könnten – ich ahnte damals ja noch nicht, dass es dafür spezielle Agenturen oder Schulen gibt.
Mir wurde von den Leuten eine Kinderschauspielschule empfohlen, an die meine Frage weitergeleitet wurde. Dort wurde ich aufgenommen und wenig später auch zu meinem ersten Casting geschickt.
Es ging um eine kleine Rolle in der Hamburger Kinderkrimi-Serie „Die Pfefferkörner“, für die ich schließlich auch besetzt wurde. Damals haben wir unter anderem hier in der Speicherstadt gedreht. In meiner ersten Rolle musste ich zwar nicht so viel machen, aber es hat mir trotzdem total gefallen – und so hat alles angefangen.
Jonas:
Danach ging es für dich richtig los, du hast Rollen in bekannten TV-Produktionen wie „Die Kinder von Blankenese“, „Notruf Hafenkante“ oder „Soko“ übernommen.
Franziska:
Ja, das war toll. Vor allem der „Soko“-Dreh in München hat mir richtig viel Spaß gemacht. Dort durfte ich eine Ballett-Tänzerin spielen und konnte meine Rolle mit dem verbinden, was ich schon immer gemacht habe. Außerdem war es meine erste Produktion außerhalb Hamburgs und mir wurde allmählich klar, dass dieses Schauspielerding für mich nicht regional beschränkt sein muss.
Vor allem in meiner Anfangszeit hat mir das Ballett sehr geholfen, weil ich damals noch keinen Schauspielunterricht hatte und recht unerfahren war.
Jonas:
Hilft dir deine Ballett-Ausbildung auch bei anderen Rollen?
Franziska:
Ja, recht viel sogar. Ballett ist eine sehr körperliche Disziplin: Man muss lernen, seinen eigenen Körper zu kontrollieren und ihn trotzdem im Fluss zu halten, damit es natürlich wirkt.
Diese Fähigkeit ist in der Schauspielerei sehr hilfreich, weil es dort ebenfalls darum geht, den Körper unter Kontrolle zu halten und gleichzeitig nicht überkünstelt zu wirken.
Vor allem in meiner Anfangszeit hat mir das Ballett sehr geholfen, weil ich damals noch keinen Schauspielunterricht hatte und recht unerfahren war. Ich habe mich daher einfach auf mein Ballettwissen gestützt und meinen Körper als Instrument gesehen, mit dem ich die Rolle ausfüllen kann.
Dieser wundervolle Spätsommertag schreit förmlich nach einem guten, heißen Kaffee. Wir verlassen die wind- und sonnenerfüllte Aussichtsplattform und steuern ein nahegelegenes Café-Restaurant an, das sich „CARLS Brasserie“ nennt und uns mit seiner breiten Glasfront direkt am Wasser lockt. Am Eingang begrüßt uns ein freundlicher Herr und führt uns zu einem Tisch mit Blick über den gesamten Hafen.
Nur wenige Plätze im Inneren der Brasserie sind belegt. Die meisten Gäste haben sich für die Außenterrasse entschieden, um die warmen Sonnenstrahlen einzufangen. So umgibt uns eine angenehme Stille und ein Gefühl tiefer Entspannung stellt sich ein.
Wir lassen unsere Blicke durch den lichtdurchfluteten Raum wandern: Dunkles Holz, schwere Lederbänke in Aubergine und Kachelbilder über der offenen Küche kombinieren hanseatische Zurückhaltung mit französischem Flair, verbinden Heimat und die große weite Welt.
Jonas:
Würdest du behaupten, dass du von Beruf Schauspielerin bist?
Franziska:
Ich würde nicht so weit gehen und tatsächlich schon das als Beruf bezeichnen, was ich zur Zeit mache. Ich bin zwar mit dem Herzen voll dabei, habe viel Spaß und arbeite auch hart, wenn wir drehen oder ich mich auf eine Rolle vorbereite – dennoch gehe ich mit dem Wort Beruf eher vorsichtig um, da ich einen gehörigen Respekt vor Menschen habe, die in der Schauspielerei schon wirklich etwas erreicht haben.
Jonas:
Wie zum Beispiel Götz George, mit dem du vor kurzem eine „Schimanski“-Episode gedreht hast?
Franziska:
Oh ja, der gehört auf jeden Fall dazu. Oder Anna Loos, die ich ebenfalls bei dieser Produktion sehr schätzen gelernt habe. Beide sind äußerst herzliche Menschen, weshalb die Atmosphäre während unseres Drehs in Rotterdam auch richtig familiär war. Ich habe dort versucht, schauspielerisch alles aufzusaugen und zu verinnerlichen.
Anna hat mir beispielsweise geraten, in meinem Spiel noch mehr mit den Augen zu arbeiten, weil sie fand, dass ich einen guten Blick habe. Das hat mich sehr geehrt und mir geholfen, besser zu werden.
Eine ähnliche Erfahrung durfte ich während der Dreharbeiten zu „Arnes Nachlass“ machen: In einer Szene sollte mir Susanne von Borsody eine Ohrfeige geben. Wir hatten das Ganze im Vorfeld geprobt und genau besprochen, wie alles ablaufen soll. Als wir dann vor der Kamera standen, hat Susanne etwas komplett anderes gemacht. Ich war richtig erschrocken, aber das war auch ihr Ziel. Die Szene wirkte dadurch total authentisch. Ich weiß seitdem: Sollte ich im Laufe meines Schauspielerlebens auch mal jemandem in einer Szene eine Ohrfeige geben, werde ich es wohl genauso machen, wie ich es von Susanne gelernt habe.
Jonas:
Mit der Figur des Horst Schimanski, gespielt von Götz George, ist quasi eine ganze Generation deutscher Fernsehzuschauer aufgewachsen. Als Tatort-Kommissar ermittelte er von 1981 bis 1991 in der ARD, seine Geschichte wird seit 1997 im ZDF in der Reihe „Schimanski“ weitererzählt. Wusstest du um die Bedeutung dieser Figur, als du für eine Rolle in der Episode „Loverboy“ gecastest bzw. besetzt wurdest?
Franziska:
Nein, ehrlich gesagt kannte ich Horst Schimanski nicht wirklich und musste erst einmal googlen – er quittierte seinen Dienst als Tatort-Kommissar ja zwei Jahre, bevor ich geboren wurde. Aber ich habe relativ schnell gemerkt, was für eine Institution diese Figur im deutschen Fernsehen ist und mit welcher Ikone man es zu tun hat.
Umso überraschter war ich am Set, als ich sah, wie jung Götz George wirkt und wie frisch er mit seinen 75 Jahren spielt. Das hat mich sehr beeindruckt.
Jonas:
Ihr habt im Juli die Dreharbeiten zu „Loverboy“ abgeschlossen. Springst du jetzt in die nächste Produktion? Oder hast du andere Pläne für die nächsten Monate?
Franziska:
Ich bewerbe mich zur Zeit an mehreren Schauspielschulen in München und Berlin. Außerdem habe ich einige Projekte in der Pipeline und stecke mitten in Castingprozessen.
Ende des Jahres will ich noch verreisen, wahrscheinlich über Silvester als Bagpacker nach Bali. Diese Reisezeit ist ideal, weil da so gut wie keine Dreharbeiten stattfinden. Ich finde es total wichtig, die Welt kennenzulernen und mit anderen Kulturen in Berührung zu kommen, vor allem als Schauspieler. Was bringt es einem, wenn man im stillen Kämmerlein verstaubt?
Jonas:
Ist es dir wichtig, eher ernstere Rollen zu spielen? Oder es dir der Charakter der Figur eher egal, solange das Drehbuch gut ist?
Franziska:
Ich würde nicht sagen, dass mir das ganz egal ist. In den ernsteren Themen fühle ich mich schon sehr zuhause – obwohl man auch in einer Komödie ein ernstes Thema in den Vordergrund rücken kann. In letzter Zeit habe ich hauptsächlich düstere und ernste Rollen übernommen, daher würde ich mich freuen, wenn ich mal wieder eine total fröhliche Figur spielen könnte. Ich bin ja selbst auch ein eher fröhlicher Mensch.
Wenn man etwas spielt, das sehr viel mit einem selbst zu tun hat, berührt einen das unter Umständen viel mehr als ein anderes Rollenprofil.
Jonas:
Viele Schauspieler empfinden es als größere Herausforderung, eine Figur zu spielen, deren Charakter möglichst weit von ihnen entfernt ist. Wie siehst du das?
Franziska:
Wenn man etwas spielt, das sehr viel mit einem selbst zu tun hat, berührt einen das unter Umständen viel mehr als ein anderes Rollenprofil. Das merkt zwar der Zuschauer nicht, weil er im Allgemeinen nur die 90 Minuten eines Film kennt, trotzdem arbeitet man als Schauspieler im Vorfeld mit dieser Rolle sehr intensiv und versucht, sie aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten – und diesen professionellen, objektiven Blick von außen auf sich selbst empfinde ich als große Herausforderung.
Jonas:
Siehst du selbst gerne fern und gehst oft ins Kino?
Franziska:
Ich lande ehrlich gesagt so gut wie nie vor dem Fernseher, ich bin eher eine Leseratte. Ins Kino gehe ich zwar auch nicht so oft, aber wenn ich mich einmal dazu entscheide, muss es ein richtig tolles Kino sein. Ich liebe zum Beispiel das Passage-Kino hier in Hamburg, die Atmosphäre vor und nach den Vorstellungen erinnert mich immer ein wenig ans Theater.
Jonas:
Magst du das Theater?
Franziska:
Oh ja, sehr! Ich habe leider selbst noch kein Theater gespielt. Trotzdem fühle ich mich dem sehr verbunden – durch das Ballett ist mir die Bühne ja nicht fremd. Ich würde die Theaterwelt gerne besser kennenlernen und hoffe deshalb auch, dass ich an einer der Schauspielschulen in München oder Berlin angenommen werde.
Jonas:
Solltest du angenommen werden, müsstest du Hamburg verlassen. Würde dir das schwer fallen?
Franziska:
Ich komme ja nicht direkt aus Hamburg, sondern aus einem ruhigen Vorort – und dort war noch nie wirklich etwas los. Deshalb gibt es in mir einen enormen Erlebnisdrang, dem ich einfach nachgeben muss. Da ist eine Stimme, die ständig sagt: „Du musst raus, raus, raus!“
Hamburg selbst ist aber toll, ich hatte hier jahrelang Ballettunterricht und bin deshalb mehrmals pro Woche mit der Bahn in die Innenstadt gefahren. Es gibt hier viele Ecken, die ich sehr mag: Die Schanze zum Beispiel, aber auch die Colonnaden zwischen Gänsemarkt und Jungfernstieg. Dort habe ich mich nach dem Ballett oft mit einer Freundin auf einen Karamell-Macchiato getroffen, da hängen viele Erinnerungen dran. Trotzdem zieht es mich irgendwie hier weg – und ich glaube, wenn ich mich zwischen München und Berlin entscheiden müsste, würde die Wahl auf Berlin fallen. Diese Stadt scheint irgendwie so offen und so frei zu sein.
Ich weiß, dass ich immer zurück nach Hause kommen kann, wenn ich meine Stille suche.
Jonas:
Fühlst du dich hier dennoch zuhause?
Franziska:
Absolut. Ich bin ein sehr wasserbezogener Mensch, daher könnte ich auch nie in einer Stadt leben, in der es nicht viel Wasser gibt. Und ganz egal, wohin es mich verschlägt: Ich weiß, dass ich immer zurück nach Hause kommen kann, wenn ich meine Stille suche. Und das liebe ich sehr.
Langsam legt sich die Dämmerung über den Hafen, wir beenden unser Gespräch. Für eine Weile noch beobachten wir die unermüdlichen Containerkräne, die fleißig ihre Arbeit verrichten. Unzählige Scheinwerfer erleuchten jetzt die vielen Ozeanriesen, deren stählerne Bäuche im Akkord geleert und wieder befüllt werden. In Kürze werden sie wieder aufbrechen in die Ferne und irgendwann am Horizont verschwinden.
Ein freundliches Lächeln breitet sich über Franziskas Gesicht aus, ihre blaugrünen Augen wirken wach und entschlossen. Auch für sie scheint von dieser Ecke Deutschlands die große weite Welt zum Greifen nah.
Wen die Sehnsucht packt und wer von Abenteuerlust beflügelt wird, der sollte losziehen in die Ferne.
Man muss ja nicht am Horizont verschwinden wie die großen Schiffe.
Und zurückkommen kann man immer noch.
Franziska Brandmeier ist 20 Jahre alt, Schauspielerin und lebt in Hamburg.
Vladimir Burlakov
Interview — Vladimir Burlakov
Der leere Raum
Wer Vladimir Burlakov in einem Film gesehen hat, der denkt vermutlich an Persönlichkeiten mit einem doppelten Boden, die andere Menschen manipulieren, ja sogar böse sind. Wir gehen den Rollenvorlieben des Schauspielstars auf den Grund.
27. Oktober 2013 — MYP N° 12 »Meine Stille« — Interview: Jonas Meyer, Fotos: David Paprocki
Es heißt, man könne aus jedem leeren Raum eine nackte Bühne machen. Nur zwei Personen brauche man und habe damit alles, was für eine Theaterhandlung notwendig sei – vorausgesetzt die eine Person sei Rezipient und die andere Akteur.
Nun ist das mit den leeren Räumen so eine Sache in Berlin. In Zeiten knappen Wohnraums und steigender Mieten scheinen sie zu einer aussterbenden Gattung zu gehören. Doch wer in der Hauptstadt genau sucht, der findet sie noch, jene kleinen Oasen des Glücks, die genügend leeren Raum zu bieten haben, um als nackte Bühne akzeptiert zu werden.
Die Hausnummer 79 in der Berliner Kastanienallee ist einer dieser exponierten Orte. Vor 118 Jahren entstand hier ein weitflächiger Fabrikkomplex, der bald Geburtsstätte war für industriell gefertigte Holzleisten. Unaufhörlich dröhnten die Maschinen, Stunde für Stunde, Tag für Tag, Jahr für Jahr.
Es kamen zwei Weltkriege, eine Mauer wurde gebaut und 28 Jahre später wieder eingerissen. Nummer 79 überlebte und ließ sich 1994 von der Kunst erobern. Seitdem hört sie auf den Namen „Dock 11“ und gehört zu den wohl spannendsten und charismatischsten Zentren für Tanz und Theater in Berlin, das zudem mit seinen 790 Quadratmetern genügend Fläche zur Entfaltung bietet.
Das Raumproblem scheint also gelöst, eine Bühne wird sich leicht erschaffen lassen. Die Rezipientenrolle übernehmen wir, somit fehlt nur noch ein Akteur.
Daher haben wir uns heute mit dem jungen Schauspieler Vladimir Burlakov verabredet, der uns bereits am Eingang von „Dock 11“ erwartet.
Gemeinsam betreten wir das ehemalige Fabrikgelände, spazieren vorbei am großen Theatersaal und erreichen über eine Treppe den großen, lichtdurchfluteten Probenraum im ersten Stock. Angenehm still ist es hier, kein einziges Geräusch dringt von der belebten Kastanienallee nach innen.
Vladimir lässt sich auf einem Stuhl in der Mitte des Saals nieder und lächelt. Instinktiv hat er gerade die Bühne eröffnet. Wir sind gespannt, was passiert.
Vorhang auf!
Jonas:
Schon als kleines Kind wolltest du unbedingt Schauspieler werden? Erinnerst du dich noch, wie dieser Traum entstanden ist?
Vladimir:
Ich glaube, dafür gab es gar keinen konkreten Anlass. Dieser unbedingte Wunsch war eigentlich schon immer irgendwie präsent in meinem Leben. Interessanterweise hat meine Mutter ebenfalls in jungen Jahren angefangen, Schauspiel zu studieren. Sie musste dann aber leider ihr Studium abbrechen, weil sie mit mir und meiner Zwillingsschwester schwanger wurde. Deshalb sagt sie auch manchmal, dass ich ihren eigenen Traum weiterlebe, den sie selbst nie verwirklichen konnte – das ist wunderschön zu hören und trotzdem total traurig.
Dabei hat meine Mutter nie in irgendeiner Form versucht, mich in diese Richtung zu schieben. Ganz im Gegenteil: Egal was ich für meine Schauspielkarriere unternommen habe, das geschah immer aus ureigenem Antrieb – und erzählt habe ich davon zuhause auch immer erst im Nachhinein. Seit ich denken kann war für mich immer absolut klar, dass Schauspielerei meine Kunstform ist.
Jonas:
Also hast du konsequent deine Kunst zum Beruf gemacht und bist professioneller Schauspieler geworden.
Vladimir:
Ja, allerdings scheue ich mich, diese Kunst profan als „Arbeit“ zu bezeichnen, das würde meiner Leidenschaft dafür einfach nicht gerecht werden – obwohl man natürlich auch in diesem Beruf sehr viel arbeiten muss.
Jonas:
Du bist im Alter von neun Jahren mit deiner Familie von Moskau nach München gezogen. Hat dieser Umzug deinen großen Wunsch, Schauspieler zu werden, in irgendeiner Form geschmälert? Plötzlich warst du ja mit einer großen Sprachbarriere konfrontiert.
Vladimir:
Ehrlich gesagt war ich damals noch zu jung, um mir diese auch tatsächlich wichtige Frage zu stellen. Der Umzug selbst war für mich nicht problematisch. Wir hatten innerhalb der Familie immer ein so gutes und vertrauensvolles Verhältnis, dass ich nicht auf die Idee gekommen wäre, diese Entscheidung in irgendeiner Art in Frage zu stellen.
Daher habe ich auch keine negativen Erinnerungen an die Anfangszeit in Deutschland, als man natürlich noch nichts hatte und sich erst einmal alles aufbauen und erarbeiten musste. Und ich weiß noch ganz genau, dass mein Traum von alldem unberührt blieb – selbst die große Sprachbarriere war innerhalb weniger Jahre überwunden.
Jonas:
Du hast einige Jahre später noch während deiner Schulzeit einen Theaterkurs bei den Münchener Kammerspielen belegt – dein erster Schritt in die Schauspielerei. Welche Erfahrungen hast du dort gesammelt?
Vladimir:
Dieser Theaterkurs war für mich essenziell, weil dort Fragen behandelt wurden wie „Was ist überhaupt Theater?“. Ich weiß noch, wie ich gleich am ersten Tag zur Übung einen imaginären Schmetterling fangen musste – vor Publikum!
Ich habe so viel geschwitzt wie noch nie zuvor in meinem Leben, weil ich damals zum allerersten Mal auf einer Bühne vor anderen Menschen spielen durfte. Das war ein unvergleichliches Gefühl.
Im Laufe der Zeit habe ich gemerkt, wie sehr man sich doch auf der Bühne öffnet und wie viel man von seiner eigenen Seele preisgeben kann.
Jonas:
Würdest du sagen, dass dir das Theater die Chance eröffnet hat, dich selbst besser kennenzulernen?
Vladimir:
Ja, absolut. Im Laufe der Zeit habe ich gemerkt, wie sehr man sich doch auf der Bühne öffnet und wie viel man von seiner eigenen Seele preisgeben kann – auch wenn die verschiedenen Rollen jede Möglichkeit bieten, sich dahinter zu verstecken.
Jonas:
Nach deinem Schulabschluss im Jahr 2006 hast du insgesamt vier Jahre an der Otto-Falckenberg-Schule in München Schauspiel studiert. Wie würdest du deine Erfahrungen dort im Vergleich zum Theaterkurs beschreiben?
Vladimir:
Die Erfahrungen im Studium waren natürlich ungleich intensiver: Man hat sich quasi vier Jahre lang nur mit sich selbst beschäftigt. Und man hat Rollen gespielt, die man wahrscheinlich so nie wieder spielen wird, weil sie so extrem weit von einem weg sind. Als Schauspieler strebt man ja immer nach dem Ideal, alles spielen zu können – aber dort kam man bei einigen Rollen wirklich an seine Grenzen.
Irgendwann hatte ich aber das Gefühl, dass ich mich schauspielerisch immer mehr von dem entfernte, was ich eigentlich sein wollte – auch wenn ich mich durch das Studium nochmals besser kennenlernen konnte. Irgendwo in meinem Kopf gab es diesen Typus Schauspieler, der ich in Wirklichkeit nicht war.
Erst als ich mehr Film gemacht habe und weniger Theater, habe ich wieder zu mir selbst gefunden. Und als ich nach zwei, drei Filmrollen erneut auf der Bühne stand, habe ich plötzlich gemerkt, dass ich dort ganz natürlich eine solche Kraft und Präsenz entwickelte, die ich vorher noch mühsam künstlich herstellen musste.
Was mich außerdem am Schauspielstudium so beeindruckt hat, war die Tatsache, dass man sich mit so grundlegenden Fragen auseinandergesetzt hat wie „Was ist überhaupt Theater?“. Der englische Theaterregisseur Peter Brook hat dazu mal folgende These aufgestellt: „Ich kann jeden leeren Raum nehmen und ihn eine nackte Bühne nennen. Ein Mann geht durch den Raum, während ihm ein anderer zusieht; das ist alles, was zur Theaterhandlung notwendig ist.“
Vladimirs Stimme klingt sanft und unaufdringlich, wirkt aber gleichzeitig präzise und entschlossen. Seine Worte beziehen ihre Kraft aus dem Moment und hinterlassen dabei Fußspuren tiefer Überzeugung.
Wir unterbrechen unser Gespräch für einige Augenblicke und lassen die Stille des großen Saals auf uns wirken. Kaum vorstellbar, dass hier einst lärmende Maschinen standen.
Mit geschlossenen Augen versuchen wir, in unseren Gedanken das Bild jener Stahlgiganten nachzuzeichnen, die hier unaufhörlich im dieselgefütterten Takt ihre Arbeit verrichteten und die starken Mauern vibrieren ließen – doch nichts: Es will uns nicht gelingen.
Vielleicht liegt es an der Präsenz des jungen Schauspielers, dass man einfach glauben mag, dieser Raum hätte noch nie eine andere Aufgabe gehabt als ein Ort des Theaters zu sein.
Ich liebe Charaktere mit einem doppelten Boden, die andere Menschen manipulieren, ja sogar böse sind.
Jonas:
Gibt es Rollen, die du besonders gerne spielst?
Vladimir:
Ja, ich liebe Charaktere mit einem doppelten Boden, die andere Menschen manipulieren, ja sogar böse sind. Wenn man eine echte Schauspielausbildung absolviert hat, verfügt man über einen großen Vorteil: Man besitzt das notwendige Handwerkszeug, mit dem man sich einen Zugang zu Emotionen und Stimmungen verschaffen kann, die man im normalen Leben nie erleben und empfinden würde.
Das hilft enorm, wenn man beispielsweise einen Mörder oder Vergewaltiger spielen muss. Hier kann man nicht so einfach auf vergleichbare eigene Erfahrungen und Emotionen zurückgreifen – man hat ja selbst weder gemordet noch vergewaltigt.
Da ist es gut, über das entsprechende Wissen zu verfügen, das einen dazu befähigt, sich solch einer Rolle zu nähern und einen emotionalen Zugang zu einem derartigen Charakter zu finden.
Jonas:
Stellst du manchmal an dir selbst fest, wie du abseits von Film und Theater auch in alltäglichen Lebenssituationen spielst?
Vladimir:
Ja, das passiert in der Tat manchmal. Ich spiele dann zwar nicht unbedingt eine Rolle, aber ich reagiere trotzdem schauspielerisch auf andere Menschen.
Es gibt einen Satz der Autorin Juli Zeh, der es auf den Punkt bringt: „Wir kommen mit einem anderen Menschen in Berührung und dieser Mensch schlägt in uns einen ganz bestimmten Ton an.“ Ihrer Meinung nach fällt je nach Ton auch die Reaktion auf den Menschen ganz unterschiedlich aus. Diese Funktion ist bei mir ziemlich stark ausgeprägt.
Jonas:
Du hast nach deinem Studium fast nur noch als Filmschauspieler gearbeitet. Fehlt dir manchmal die Bühne?
Vladimir:
Ja, total! Meiner Meinung nach ist der Beruf des Theaterschauspielers auch fast ein ganz anderer – und dieser fehlt mir sehr. Nachdem ich mein Studium abgeschlossen hatte, erhielt ich zwar viele Angebote für Theaterengagements – allerdings von eher kleineren, regionaleren Häusern. Und ehrlicherweise muss ich zugeben, dass ich ganz gerne nach den Sternen greife und die größeren Häuser im Blick habe.
Außerdem ist mir extrem wichtig, in welcher Stadt ich arbeite und lebe – und da ist Berlin im Moment unschlagbar. Ich merke direkt, wie sehr es mir fehlt, wenn ich mal für längere Zeit nicht da bin.
Jonas:
Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass du von München nach Berlin gezogen bist?
Vladimir:
Nachdem wir 2012 in Marokko die Dreharbeiten zu „Eine mörderische Entscheidung“ abgeschlossen hatten, flogen alle Kollegen zurück nach Berlin. Ich war der Einzige, der einen Flug nach München hatte – mit Zwischenstopp in Paris. Während alle anderen schon in der Luft waren, saß ich ganz alleine am überfüllten Flughafen von Casablanca und wartete scheinbar endlos darauf, dass endlich der Schalter der Air France geöffnet wurde. Da es keine freien Stühle und Bänke gab, saß ich auf dem Boden. Und als ich da so saß, fragte ich mich, warum ich hier auf dem Boden sitzen muss, wenn alle anderen schon fast in Berlin sind.
Das war irgendwie ein Zeichen. Als ich zurück in München war, habe ich meine Sachen gepackt, meine Wohnung gekündigt und bin innerhalb einer Woche nach Berlin gezogen.
Jonas:
Der Film „Eine mörderische Entscheidung“, von dem du gerade gesprochen hast, basiert auf den Ereignissen der Nacht zum 4. September 2009, als auf Befehl eines deutschen Oberst bei Kunduz zwei Tanklastzüge bombardiert wurden und über 140 Menschen starben. Vor kurzem wurde dieses Dokudrama auf Arte und in der ARD zum ersten Mal gezeigt. Glaubst du, dass die Zuschauer sich mit so einen Film überhaupt ausreichend befassen? Schließlich sind sie schon seit Jahren durch die Medien mit dem Dauerthema Afghanistan-Krieg konfrontiert.
Vladimir:
Man muss total unpolitisch und auf den Kopf gefallen sein, wenn eine solche Geschichte spurlos an einem vorübergeht. Es ist einfach wichtig, dass man sich mit solchen Themen befasst, egal ob es jetzt speziell um diesen Film geht oder ganz allgemein um andere Dinge, die um einen herum passieren.
Ich selbst habe an mir festgestellt, dass ich innerhalb der letzten Jahre viel politischer und politikinteressierter geworden bin. Auch wenn ich seit 2008 keinen Fernseher mehr habe, nutze ich im Internet die Mediatheken, um hauptsächlich Politiksendungen zu schauen.
Ich habe mich übrigens sehr gefreut, als die Anfrage zu „Eine mörderische Entscheidung“ kam. Das würde ich allerdings nicht auf den politischen Aspekt zurückführen – es ging mir vielmehr um die spannende Rolle eines jungen deutschen Soldaten im Afghanistan-Krieg, der nicht weiß, was ihn erwartet. Außerdem fand ich es spannend, mit so wundervollen Kollegen wie Axel Milberg, Matthias Brandt oder Ludwig Trepte zusammenarbeiten zu dürfen.
Jonas:
Verändert die intensive Beschäftigung mit solch einem Thema ganz allgemein den Blick auf die Dinge?
Vladimir:
Wenn man in der Rolle steckt, setzt man sich natürlich intensiv mit dem Thema auseinander. Das ist während der Dreharbeiten ja auch dauerpräsent. Ist der Dreh abgeschlossen, streift man die Rolle aber wieder ab. Gerade für Schauspieler ist das ein wichtiger Schutzmechanismus, um im Kopf wieder frei zu sein für die nächste Rolle.
Auch wenn es sich dabei um einen etwas ungleichen Vergleich handelt: Würde ein Arzt das persönliche Schicksal eines jeden Patienten zu sehr an sich heranlassen, würde er wahrscheinlich nach kurzer Zeit auch nicht mehr in der Lage sein, seine Arbeit ordentlich zu verrichten. Dazu kommt, dass die Tragödie für den Schauspieler im Gegensatz zum Arzt etwas Tolles ist, weil sie eine besondere Anforderung an sein Spiel darstellt. Das beste Beispiel hierfür ist das Drama „Marco W.“: Die Verfilmung des persönlichen Schicksals dieses jungen Mannes war für mich als Schauspieler eine interessante Herausforderung.
Jonas:
Was war für dich das Besondere an dieser Rolle?
Vladimir:
„Marco W.“ war eine absolute Hauptrolle, bei der ich schauspielerisch die gesamte Entwicklung der Figur darstellen durfte und von Hoffnung über Resignation bis Verzweiflung einen großen Bogen spannen konnte. Bei kleineren Rollen, bei denen die persönliche Drehzeit oft auf sechs, sieben Drehtage beschränkt ist, ist so eine ausführliche Darstellung der Figur natürlich nicht möglich.
Außerdem waren mir bei dieser Figur die persönliche Situation und Emotionalität so nah, dass ich manchmal das Gefühl hatte, gar nicht wirklich spielen zu müssen. Trotzdem war es physisch und psychisch mit das Intensivste, was ich bisher gemacht habe.
Dazu kommt, dass von Marco in den Medien nur ein einziges Foto existierte, weshalb ich in meiner Interpretation der Rolle relativ frei war und keine Verantwortung für Mimik, Gestik und Habitus übernehmen musste. Dies wäre beispielsweise der Fall, wenn man so jemanden wie Romy Schneider spielen würde. Dafür war aber die Verantwortung gegenüber dem realen Marco umso größer, der am Set natürlich anwesend war und sicherstellte, richtig dargestellt zu werden.
Generell ist mir auch wichtig, dass mir eine Rolle ermöglicht, etwas Neues für mein Leben zu lernen oder durch eine Situation zu gehen, die ich vorher so noch nicht kannte.
Jonas:
Was treibt dich als Schauspieler an?
Vladimir:
Wahrscheinlich genau dasselbe, das jeden Menschen antreibt, nur in einem etwas anderen Aggregatszustand. Mich inspirieren zum Beispiel einige Kollegen sehr, allen voran Lars Eidinger, der ein großartiger Schauspieler ist. Ich schätze seine direkte und klare Art.
Generell ist mir auch wichtig, dass mir eine Rolle ermöglicht, etwas Neues für mein Leben zu lernen oder durch eine Situation zu gehen, die ich vorher so noch nicht kannte.
Das ist ja auch das Tolle an diesem Beruf: Man kann viele Leben leben, die man sonst nicht leben könnte. Manchmal passt die Rolle auch so gut, dass sie fast wie eine Therapie wirkt, weil man in ihr etwas ausdrücken kann, das man so niemals rauslassen würde.
Darüber hinaus liebe ich es, neue Menschen kennenzulernen und sie beim ersten Aufeinandertreffen bis ins Detail zu analysieren. Dann schwirrt mir nur diese eine Frage durch den Kopf: „Wer genau bist du, der mir da gerade gegenübersteht?“ Ich muss dieses Röntgen auch gar nicht aktiv betreiben, meine Umwelt fließt quasi in mich hinein.
Jonas:
Du hast bereits mit den größten Namen gedreht, die die deutsche Schauspielerlandschaft so zu bieten hat: Hannelore Elsner, Veronica Ferres, Joachim Król, Katja Riemann, Armin Rohde – um nur einige zu nennen. Vor kurzem hast du außerdem mit Götz George die Schimanski-Episode „Loverboy“ abgedreht, die in wenigen Wochen ausgestrahlt wird. Was nimmst du aus der gemeinsamen Arbeit mit diesen Persönlichkeiten mit?
Vladimir:
Das Schöne ist, dass ich bei vielen Kollegen immer wieder positive Überraschungen erlebe, die mir natürlich in Erinnerung bleiben. Außerdem merke ich, dass ich mich vor allem mit jenen Schauspielern identifiziere, bei denen ich große Übereinstimmungen mit mir selbst feststelle – sei es jetzt charakterlich oder was die Art und Weise angeht, wie sie spielen. Das gibt mir sehr viel Kraft.
Jonas:
Gibt es eine Figur, die du gerne einmal spielen würdest?
Vladimir:
Wie ich bereits erwähnt habe, sind die bösen Charaktere ja generell die spannenderen: Paranoide, Schizophrene, Psychopathen – da hat man beim Spielen einfach mehr Fläche. Aber eigentlich ist es viel schwieriger, absolute Normalos zu spielen, weil man da gar nichts greifen kann. Das ist eine echte Herausforderung.
Ich spiele eine so ähnliche Figur übrigens bei meinem aktuellen Projekt „Nachthelle“, einem Mystery-Thriller von Florian Gottschick, den wir gerade in Brandenburg drehen. Meine Figur des Stefan ist ein ganz normaler Typ, der nicht wirklich über seine Gefühle redet und insgesamt mehr beobachtet als agiert. Diese Rolle ist weitaus schwieriger zu spielen als beispielsweise die des Autisten Philipp von Nordeck in „Verbrechen nach Ferdinand von Schirach“, in die ich im letzten Jahr geschlüpft bin. Es gibt da einfach nichts in der Figur, hinter dem man sich verstecken könnte.
Wenn du Gott zum Lachen bringen willst, erzähl’ ihm von deinen Plänen.
Jonas:
Bist du auf eine gewisse Art und Weise gläubig?
Vladimir:
Ja, wahrscheinlich schon. Daher weiß ich auch nicht, was mir noch alles mit auf den Weg gegeben ist und wie mein großer Lebensplan letztendlich aussieht.
Es gibt ja den schönen Satz: Wenn du Gott zum Lachen bringen willst, erzähl’ ihm von deinen Plänen.
Eigentlich bin ich total glücklich mit allem, wie es ist. Denn ich weiß ganz genau, dass ich auf der Welt bin, um Schauspieler zu sein und zu spielen. Das ist der einzige Grund, warum es mich gibt.
Aus dem Innenhof dringen einige Stimmen in den ersten Stock. Wir öffnen ein Fenster und schauen nach unten: Vor dem großen Theatersaal im Erdgeschoss wurde gerade die Abendkasse geöffnet. Die ersten Zuschauer der heutigen Vorstellung sind eingetroffen und sammeln sich vor dem Eingang des Theaters.
Auf unseren Gesichtern liegt ein Lächeln. Wer hätte vor 118 Jahren wohl damit gerechnet, als dieser Raum geschaffen wurde?
Wir verlassen den Probenraum und schlendern zum Ausgang. Für einen Moment scheint es, als hätten sich die alten Fabrikmauern von ihren Plätzen erhoben und würden munter Beifall klatschen.
Dabei wirken sie zufrieden und erleichtert. Es braucht hier keine dröhnenden Maschinen mehr, um den leeren Raum zu füllen.
Nur einen guten Schauspieler.
Vladimir Burlakov ist 26 Jahre alt, Schauspieler und lebt in Berlin.
Tex
Interview — Tex
In Schwarzweiß
Ihr mochtet Mathematik in der Schule nie? Tex Drieschner kann das vielleicht ändern. Wir sprechen mit dem Gastgeber der Sendung „TV Noir“ über die Kreativität der Berechnung und die emotionale Relevanz der Traurigkeit.
27. Oktober 2013 — MYP No. 12 »Meine Stille« — Interview: Jonas Meyer, Fotos: Lukas Leister
Der Saalbau in Neukölln hat viel erlebt in seinen 140 Jahren. Geboren als Teil eines Dorfgasthauses in der Zeit, als die Gegend hier noch Rixdorf hieß, avancierte er schon bald zum Stadttheater und wurde später sogar UFA-Kino. Auf seinem Parkett feierten die Berliner jene goldenen Zwanziger und tanzten als gäbe es kein Morgen. Ein Ort für Kunst zu sein, das sagt der Saalbau heute, mache ihn am glücklichsten. Und es wirkt, als entweiche seinen alten Mauern ein kleines Lächeln, wenn er an seine unbeschwerte Jugend denkt.
Wenige Jahre später, als über Alle und Alles die dunkelste aller Zeiten hereinbrach, machten die Nationalsozialisten aus dem Saalbau Neukölln eine Sammelstelle für Güter jüdischer Bürger. Nachdem der Krieg ein Ende hatte und geschehen war, wofür es keine Worte gibt, wurde das Gebäude renoviert und umgebaut. Endlich durfte er wieder sein, was er am liebsten war, und strahlte nun als Zentrum für Konzert, Theater und Film.
Doch der Saalbau fiel Ende der Sechziger in einen Dornröschenschlaf, irgendwann drohte sogar der Abriss. Es musste erst das Jahr 1990 kommen, um ihn als Kulturstätte wiederzubeleben – und die ist er bis heute: Seit 2009 hat der Saalbau Neukölln einen Mitbewohner, das Volkstheater-Kollektiv „Heimathafen Neukölln“ fand hier sein neues Zuhause.
Er hat also viel erlebt in seinen 140 Jahren, doch irgendwie merkt man ihm das gar nicht an. Und so beobachtet er auch heute ganz gelassen und entspannt die Gäste des Café Rix, die in seinem Innenhof bei Kaffee und Kuchen die Stille genießen. Tapfer trotzt die kleine Oase dem Lärm der belebten Karl-Marx-Straße und wirkt dabei wie ein Schutzraum vor dem Alltag.
An diesem Zufluchtsort haben auch wir an diesem spätsommerlichen Nachmittag einen freien Tisch ergattert. Während unsere Augen etwas gedankenverloren den Bildern aus Licht und Schatten folgen, die die Sonne auf die hellen Mauern malt, radelt ein großgewachsener Mann im schwarzen Anzug in den Innenhof. Es ist Tex Drieschner, der Anfang 2010 mit seiner Sendung „TV Noir“ in den Heimathafen gezogen ist. Tex schließt sein Fahrrad ab, steuert lächelnd unseren Tisch an und setzt sich zu uns.
Jonas:
Du hast in deinem Leben schon in den unterschiedlichsten Berufen gearbeitet: Von Vorstandsmitglied über Weihnachtsmann bis Karikaturist war eigentlich alles dabei, was man sich so vorstellen kann. Wie kommt man zu einer so ausgefallenen Vita?
Tex:
Ich hatte nie einen bestimmten Plan, der mir vorschreibt, was in mein Leben passt. Ich mache immer das, was sich gerade anbietet und worauf ich Lust habe. Erst im Nachhinein und mit einem gewissen Abstand sehe ich dann die Gemeinsamkeiten meiner unterschiedlichen Tätigkeiten. Ich glaube, dass ich gerne einen Wald von Möglichkeiten auf mich wirken lasse und dann die spannendste Option verfolge.
Das ist in etwa vergleichbar mit der Beweisfindung in der Mathematik: Dort offenbart sich meistens auch ganz langsam im Dunkeln eine Struktur, die es dann auszuarbeiten und elegant zu machen gilt. Ich glaube, dieses Grundprinzip lässt sich auf ganz Vieles projizieren: etwa auf das Zeichnen von Cartoons, das Schreiben von Songs oder die Arbeit als Knowledge-Management-Berater.
Oft hat man einerseits eine Situation, die zunächst sehr komplex wirkt, und andererseits eine Vision davon, was man erreichen möchte – das Ziel wird dadurch mit einer positiven Emotion besetzt.
Also kann man sich auf die Jagd begeben und versuchen, im Wald aller Möglichkeiten genau diejenige zu finden, die der eigentlichen Vision am nächsten kommt. Das mag der Kern der vielen Begeisterungen sein, die mich im Laufe meines Lebens ergriffen haben.
Jonas:
Viele Menschen haben große Berührungsängste gegenüber der Mathematik. Kennen sie einfach diesen emotionalen Aspekt nicht?
Tex:
Viele Leute verbinden die Mathematik leider mit etwas Trockenem und Spaßlosen. Das liegt meiner Meinung nach daran, dass sie in der Schule immer etwas machen mussten, wovon sie sich bedroht fühlten. Wenn Menschen Angst empfinden oder das Gefühl haben, etwas nicht mehr schaffen zu können, machen bestimmte Inhibitoren das Gehirn einfach dicht. Verrichtet man dagegen Dinge in spielerischer Begeisterung, werden Stoffe ausgeschüttet, die das Gehirn für neue Vernetzungen öffnen.
In der Schule geht es darum, vorgefertigte Algorithmen auswendig zu lernen und wiederzugeben. Das ist natürlich total langweilig und würde selbst einen Mathematiker nicht bei der Stange halten – es kommt dabei ja absolut keine Begeisterung auf.
Diese Begeisterung kann aber entstehen, wenn man über Wochen instinktiv an einer Arbeit sitzt und ahnt, auf der richtigen Spur zu sein – und man plötzlich merkt, dass man das zu Zeigende auch zeigen kann. Hat man die Fährte zur Lösung einmal aufgenommen, geht es im zweiten Schritt darum, das Geschaffene zu schleifen, zu färben und eleganter zu machen – das ist immer ein sehr kreativer Prozess.
Wenn man seine Umgebung einfach als ein riesiges Angebot akzeptiert und immer das wählt, was gerade passt, kommt man automatisch irgendwann zum Meer.
Jonas:
Das hat fast etwas sehr Pfadfinderartiges…
Tex:
Absolut. Im Leben geht es ja oft darum, eine Lösung für Situationen zu finden, die äußerst schwierig und komplex erscheinen. Das ist, als würde man mitten in einem ungeliebten Gebirge stehen und nach einem Pfad suchen, der zum ersehnten Meer führt.
Doch die wenigsten Gebirge grenzen an ein Meer, der Weg dahin ist einfach nicht ersichtlich. Daher muss man für sich persönlich eine Strategie entwickeln, um angesichts der gegebenen Optionen das Beste aus der Situation zu machen: Man kann etwa im ersten Schritt einen Teilabschnitt wählen, auf dem man sich wohlfühlt. Und sollte es mal nicht mehr weitergehen, kann man auch einfach stehenbleiben und sich die Landschaft anschauen.
Diese Herangehensweise gibt einem eine gewisse Freiheit und nimmt diesen Druck, auf dem schnellsten Weg zum Meer kommen zu müssen: Man muss nämlich gar nichts.
Wenn man seine Umgebung einfach als ein riesiges Angebot akzeptiert und immer das wählt, was gerade passt, kommt man automatisch irgendwann zum Meer. Das ist eine wichtige Grundphilosophie des Alltags.
Jonas:
Ein treuer Begleiter auf deinem eigenen Pfad war immer die Musik. Weißt du noch, wann du zum ersten Mal gemerkt hast, dass sie eine essenzielle Komponente deines Lebens ist?
Tex:
Auf jeden Fall nicht in meiner Kindheit – ich bin förmlich zur Geige geprügelt worden. Meinen Eltern bin ich zwar heute dafür wahnsinnig dankbar, aber damals habe ich sie gehasst, weil ich dauernd üben musste. Mit der Geige konnte ich auch nicht so wirklich cool sein, das habe ich spätestens in der Pubertät gemerkt. In der Schule war ich sowieso ein ziemlicher Loser und nicht besonders beliebt in den ersten Schuljahren. Prägend für mich war das Skilager in der siebten Klasse: Ein entfernter Cousin saß mit seiner Gitarre einfach da und sang. Alle hatten sich um ihn versammelt, die Mädchen himmelten ihn an. Nur ich saß in der vorletzten Reihe und dachte: Wie toll wäre es, wenn ich selbst da vorne in der Mitte sitzen würde.
Diese Sehnsucht hat in mir den Drang genährt, ein ähnlich intensives Gefühl auch in anderen hervorrufen zu können – noch lange bevor ich selbst Musik gemacht habe. In der Pubertät vermischt sich das ja so schön: sich auf der einen Seite selbst profilieren zu wollen und sich ein neues Ich zu geben und auf der anderen Seite von der Sache selbst begeistert zu sein.
Jonas:
Trotzdem war diese Sehnsucht auch Grundstein für deine eigene musikalische Karriere: Im Laufe der Jahre hast du unter anderem in einer Münchener Fun-Punkband gespielt und warst Mitglied der Hamburger A Capella-Band „The Buddhas“. Wie hat sich aus alldem dein Soloprojekt „Tex“ entwickelt?
Tex:
Es gab für mich im Jahr 1992 ein Schlüsselerlebnis: Ich hatte mir nach einem Zeltlager mit viel Singen, noch mehr Wein und wenig Schlaf die Stimme total ruiniert. Damals habe ich noch in München gelebt und war Sänger in dieser Fun-Punkband. Leider konnte ich absolut nicht einschätzen, wann meine Stimme wieder voll belastbar sein würde. Nach ein paar Wochen dachte ich, ich probier’s mal wieder – vor 1.200 Leuten bei einem für uns ziemlich wichtigen Auftritt im „Theatron“. Alle wollten Party machen und warteten darauf, dass es endlich losgeht. Aber meine Stimme wollte nicht. Ich stand auf der Bühne und klang total widerlich: ein ganz und gar schlimmes Erlebnis.
Da meine Stimme wohl vorerst nicht mehr zu gebrauchen war, habe ich wenige Tage später in meiner Verzweiflung einige Sachen rausgesucht, die ich früher einmal geschrieben hatte. Die Songs waren eigentlich nie cool genug für diese Band, trotzdem habe ich mich mit dem Gitarristen zusammengesetzt und sie ihm gezeigt – wir konnten ja gerade eh nichts anderes machen.
Als wir anfingen, die Stücke auch mal zweistimmig zu spielen, fanden wir das irgendwie geil. Zwar haben wir das Ganze letztendlich nicht weiterverfolgt, aber ich hatte von nun an diesen Klang im Kopf. Und als ich 1993 nach einem kurzen Aufenthalt in den USA nach Hamburg zog, kramte ich allmählich meine Songs wieder aus.
Ich glaube, es war 1997, als es so langsam ernst wurde und ich mich dazu entschied, ganz und gar diese Musik zu machen – unter dem Namen „Tex“ und mit klaren deutschen Texten. Ich hatte plötzlich eine eindeutige Vision davon, wie sich das Projekt anfühlen soll, und veröffentlichte mit „Düster bist du schön“ die deutsche Version eines jener Stücke, die in München noch auf Englisch entstanden waren. Dieser Song gehört nach wie vor zu meinen absoluten Lieblingsliedern.
Texten ist qualvoll, aber gleichzeitig auch wahnsinnig erfüllend.
Jonas:
Hat Sprache für dich und deine Musik generell eine wichtige Bedeutung?
Tex:
Aus diesem Winkel hat sich die Frage für mich nie gestellt – und ich habe mich selbst dahingehend auch nie analysiert.
Ich weiß nur, dass ich von Anfang an bei meinen Musikprojekten die Texte selbst geschrieben habe, weil es mir irren Spaß macht, zu reimen und zu gestalten. Und das hat wiederum etwas mit diesem Prozess des Suchens und Findens zu tun.
Vielleicht ist Spaß aber auch nicht das richtige Wort. Wie vielen anderen geht es auch mir so, dass es oft sehr schmerzhaft sein kann, eigene Texte zu schreiben – eine schwere Geburt, bei der man viele Entscheidungen treffen und die sich bietenden Optionen reduzieren muss. Texten ist qualvoll, aber gleichzeitig auch wahnsinnig erfüllend – vorausgesetzt es kommt etwas dabei heraus, mit dem man selbst zufrieden ist.
Jonas:
Viele junge Musiker können kaum oder gar nicht von ihrer Kunst leben. Hattest du in all’ den Jahren selbst mit Existenzängsten zu kämpfen?
Tex:
Ich glaube, dass ich tatsächlich nie in einer finanziellen Notlage war. Ich hatte während meines gesamten Studiums zwar nicht sonderlich viel Geld, aber ich wurde eine ganze Weile von meinem Papa finanziert. Außerdem hatte ich schon als Kind damit begonnen, mit dem Computer rumzuexperimentieren, und da fanden sich natürlich immer gut bezahlte Jobs. So hatte ich nie wirklich existenzielle Probleme.
Manche Musiker sind aber auch sehr radikal in ihren Entscheidungen und lassen alles andere im Leben fallen, nur um sich voll und ganz auf ihre Kunst konzentrieren zu können. Diese Radikalität vermisse ich auch manchmal an mir selbst. Ich lasse mir einfach gerne verschiedene Optionen offen und arbeite zwischen den Gleisen.
Wahrscheinlich würde ich es auch gar nicht hinbekommen, eine einzige Sache so zu fokussieren. Allein mein kleines TV Noir-Projekt von damals ist mittlerweile so schwergewichtig geworden, dass ich nicht nur die Sendung moderiere, sondern mich auch um die ganze Firma drumherum kümmere. Da ist es fast unmöglich, sich die Zeit und Einsamkeit zu nehmen, die man so dringend braucht, wenn neue Songs entstehen sollen.
Ich schreibe zwar gerade an meinem nächsten Album, das tue ich allerdings sehr langsam. Es geht mir momentan auch wesentlich mehr um die Vorbereitung meiner Tour, die im November endlich startet. Ich kann mir zwar vorstellen, dass dabei auch einiges für das neue Album abfällt, trotzdem stehen die Liveshows jetzt erst einmal im Fokus.
Während Tex in tiefer Gelassenheit und mit freundlicher Stimme aus seinem ereignisreichen Leben erzählt, wirkt es fast, als würden ihm die alten Saalbau-Mauern heimlich lauschen.
Denn die Geschichte von TV Noir ist seit einiger Zeit auch ein Teil ihrer Geschichte: Seit Tex vor knapp vier Jahren mit der Sendung in den Heimathafen gezogen ist, empfängt er hier regelmäßig außergewöhnliche Musiker auf seiner Bühnencouch.
Eine besondere Form der Stille. Und ganz in Schwarzweiß.
Jonas:
TV Noir existiert mittlerweile seit fünf Jahren. Erinnerst du dich noch, wie alles angefangen hat?
Tex:
Gestartet sind wir im ersten Stock eines winzigen Cafés namens „Edelweiss“ im Görlitzer Park. Anfangs kam die Musik noch von mir selbst und zwei Bekannten, aber wir haben recht bald versucht, auch etwas größere Namen für uns gewinnen zu können. Viele fanden seltsam, was wir da machen: mit irgendwelchen Freunden komische Geschichten veranstalten. Aber ich hatte das Gefühl, dass es irgendwie funktioniert und genau das beinhaltet, was ich cool finde.
Ich hatte deshalb auch einen Freund gebeten, gleich die erste Show mit einer Kamera aufzuzeichnen – die hatte ich mir für 139 Euro bei Ebay ersteigert.
Zwar hat diese Kamera natürlich nicht viel hergegeben, trotzdem habe ich damals schon an der Gradationskurve geschraubt, den Gammawert etwas hochgezogen und das Ganze ins Netz gestellt. Ich war schon immer ziemlich stylebesessen – und es war mir von Anfang an wichtig, wie das wirkt, was wir da machen.
Mit einem Mal fand eine andere Art von Konzert statt.
Jonas:
Aus welcher Idee heraus ist TV Noir überhaupt entstanden?
Tex:
Es gab zwei wesentliche Treiber: Zum einen veranstaltete ein guter Freund namens Sebastian Block schon damals mit einer Songwriterclique ganz informelle Abende, die „Prima Platte-Abende“ hießen. Ich selbst hatte vorher eigentlich nie Kontakt zu anderen Musikern aus meinem Genre. Erst durch den Rio Reiser Songpreis bin ich mit dieser Clique in Berührung gekommen, zu der neben Sebastian auch Guillermo Morales und Simon Goldfein gehörten.
Bei diesen Abenden wurde reihum auf der Gitarre gespielt. Das hatte etwas unglaublich Intimes und Schönes, denn dadurch wurde ein kleiner Raum geschaffen, in dem jeder Platz für seine ganz eigenen Sachen hatte. Ich war davon so fasziniert, dass ich Lust bekam, da meinen eigenen Input beizusteuern: Ich dachte mir, es wäre schön, den Ablauf des Ganzen etwas zu straffen und genauer auf den Punkt zu bringen, weil sich die Veranstaltung zunächst immer etwas verlaufen hatte.
Der zweite Treiber war ein Konzert von Enno Bunger an einem kalten Winterabend, bei dem ich kurzfristig mitgespielt hatte. Enno war damals noch total unbekannt und so war ziemlich klar, dass unter den Voraussetzungen nicht viele Leute kommen würden. Daher haben wir relativ spontan entschieden, ein paar Lebkuchen und Glühwein zu kaufen, und machten aus der Veranstaltung eine ostfriesische Weinnacht. Dabei habe ich Enno spaßeshalber vor Publikum interviewt. Als er im Anschluss daran gespielt hat, habe ich gemerkt, dass das Publikum plötzlich ganz anders rezipiert hat. Mit einem Mal fand eine andere Art von Konzert statt. Das Publikum wirkte viel offener und interessierter, weil der Typ, der gerade noch von sich selbst erzählt hatte, jetzt noch zusätzlich tolle Songs spielte. Aus diesen beiden Treibern ist dann die Idee zu TV Noir entstanden.
Jonas:
Das Format hat in den letzten Jahren für viele Menschen eine enorme Relevanz entwickelt. Weißt du um diese emotionale Wirkung von TV Noir?
Tex:
Ja, das merke ich total. Das ist auch seit der ersten Folge der Grund, warum wir diese Sendung überhaupt produzieren. Dieses Gefühl zu erzeugen war und ist Teil unserer Vision. So waren auch recht frühe Sendungen etwa mit Bosse oder mit Philipp Poisel schon sehr berührend und gingen in die Tiefe, was mit der Größe des Projekts auch in erster Linie gar nichts zu tun hatte.
Im Innenhof ist es mittlerweile etwas schattig geworden, daher entscheiden wir, den Saalbau zu verlassen und der Sonne hinterher zu spazieren.
Wir überqueren die belebte Karl-Marx-Straße und schlendern zu einer parkähnlichen Grünanlage, die nur wenige Minuten entfernt liegt. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden hier auf zwei Hügeln die Trümmer der umliegenden Häuser zusammengetragen, die man später mit Erde aufgeschüttet und bepflanzt hat. Die beiden Hügel tragen seitdem die Namen „Lessinghöhe“ und „Thomashöhe“ und bilden mitten in Neukölln einen besonderen Hort der Stille – wie der Innenhof des Saalbaus, nur draußen im Grünen.
Jonas:
TV Noir scheint ein Indiz dafür zu sein, dass es tatsächlich noch ein Bedürfnis nach wahrhaftiger, authentischer Musik gibt. 2009 wurdet ihr für den Grimme Online Award nominiert, 2011 startete die Zusammenarbeit mit ZDF Kultur. Leider steht der Sender jetzt vor dem Aus. Wie geht’s bei euch weiter?
Tex:
Es wäre vor fünf Jahren wahrscheinlich nicht möglich gewesen, so eine Show in einem öffentlich-rechtlichen Sender zu platzieren. Die Kooperation konnte 2011 nur realisiert werden, weil es im TV immer wieder Trendwellen in die ein oder andere Richtung gibt. Daniel Fiedler, der kreative Vater von ZDF Kultur, hatte in dem Sender einfach eine tolle Vision umgesetzt und in kürzester Zeit eine Marke geschaffen, die funktioniert hat.
Dass so etwas jetzt ersatzlos eingestampft wird, zeugt schon von einer gehörigen Ignoranz. Dabei könnte das ZDF dringend eine Marke gebrauchen, die eine gewisse Coolness für junge Leute bietet und bei dieser Zielgruppe Relevanz erzeugt.
Dass es uns überhaupt in dieser Form gibt, verdanken wir in nicht unerheblichem Maße der Trash-Kultur auf YouTube. Darüber kann man einerseits wahnsinnig schimpfen, andererseits muss man sich aber eingestehen, dass diese Plattform die Grundlage dafür geschaffen hat, dass die TV Noir Inhalte allen zur Verfügung stehen.
An dieser Stelle sind wir auch wieder bei dem Gebirgsbild: Die Landschaft ändert sich und wir Pfadfinder müssen schauen, welche der neuen Pfade die besonders schönen und für uns wichtigen sind.
Das heißt, wir müssen herausfinden, welche Möglichkeiten sich für uns in dieser noch viel konvergenter gewordenen Welt zwischen klassischem Fernsehen und Webvideo auftun.
Man muss eben ständig auf der Suche sein nach neuen Wegen, die finanziell darstellbar sind und uns abseits des Mainstream ermöglichen, genau das zu machen, was uns Spaß macht.
Jonas:
In welche Richtung soll sich das TV Noir-Format denn generell entwickeln?
Tex:
Es ist ein wesentliches Prinzip unserer Arbeit, dass es wenige konkrete Vorgaben gibt, die wir zu erreichen haben – Pfadfinderei eben. Wir wissen, wie sich TV Noir anfühlen muss und überprüfen alles, was wir tun, auf dieses Gefühl hin.
Dabei versuchen wir, uns immer die Option offenzuhalten, wieder zurückrudern zu können, wenn es in einer Richtung mal nicht geklappt hat.
Als wir zum Beispiel die Kooperation mit dem ZDF gestartet haben, war es uns sehr wichtig, zuerst einen Testlauf zu fahren und dann auf Basis unseres Gefühls zu entscheiden, ob wir weitermachen.
Und als wir Ende 2009 aus dem Edelweiss in den Heimathafen gezogen sind, war das ebenfalls eine riesige Diskussion. Viele befürchteten, dass man das Format in einem so großen Theater nicht realisieren könnte, weil TV Noir vor allem von der intimen Atmosphäre lebt. Dann haben wir uns gesagt, dass wir es einfach ausprobieren wollen und es fortsetzen, wenn es sich gut anfühlt.
Jonas:
Du hast im Jahr 2005 den Song „Sie haben die Wahl“ veröffentlicht. Ist es dir wichtig, als Künstler auch politisch zu sein und über die Musik deinen Standpunkt klarzumachen?
Tex:
Die Frage trifft einen wunden Punkt. Früher war ich wirklich von einer politischen Leidenschaft durchdrungen. Ich liebe zum Beispiel die Autobiografie von Arthur Miller, wo auf jeder Seite durchschimmert, wie leidenschaftlich politisch er ist.
Momentan sehe ich aber einfach keine gute Möglichkeit, selbst politisch zu werden. Erstens muss ich sagen, dass ich das Politische mittlerweile weitaus weniger emotional betrachte als früher. Und zweitens finde ich es wahnsinnig schwer, überhaupt politisch zu schreiben – auch wenn ich tatsächlich mal von einer Sache bewegt bin wie etwa in letzter Zeit von dieser NSA-Geschichte.
Ich war mal ein wirklich leidenschaftlicher Chomsky-Vergötterer, habe viel gewusst und diskutiert Das ist aber mittlerweile total in den Hintergrund getreten. Gott sei Dank gibt es Künstler wie beispielsweise den fantastischen Maxim, den ich als einen wirklichen Glücksfall für die deutsche Schreiberlandschaft betrachte. Maxim schafft es, in seinen Songs genau das unterzubringen, was ihm wichtig ist – sehr berührend, aber ohne dass es komisch klingt.
Jonas:
Abgesehen von Maxim: Welche Musik berührt dich?
Tex:
Es gibt viel Musik, die für mich total relevant ist. Das hört man wahrscheinlich auch in meinen eigenen Songs. Zur Zeit befinde ich mich wieder in einer ausgedehnten Phase absoluter Verehrung für Leonard Cohen. Diese Musik steht momentan an erster Stelle.
Seit Jahren finde ich aber auch Radiohead ganz toll – und mein klassisches Idol ist Elvis Costello. Ich würde sagen, dass ich jedes zweite Mal einen Song von ihm spiele, wenn ich mich ans Klavier setze.
Wenn man sich in einem festgelegten Rahmen bewegt und genau weiß, was als Nächstes kommt, hat man auch die Möglichkeit, mal ungeplanten Scheiß zu machen.
Wir spazieren noch eine Weile über die Thomashöhe und bleiben irgendwann vor einem kleinen Pfad stehen, der zurück zur Straße führt. Tex atmet tief ein, verabschiedet sich und tritt den Rückweg an in Richtung Heimathafen.
Während unsere Blicke ein letztes Mal über die hügelige Fläche des Parks wandern, stellt sich in uns ein tiefes Gefühl der Freiheit ein.
Man sollte einfach öfter einen Ort der Stille suchen – oder selbst einen kreieren.
Mit viel Musik und in Schwarzweiß.
Jonas:
Hast du dir persönlich bestimmte Ziele gesetzt, die du in den nächsten Jahren erreichen willst? Gibt es einen Plan?
Tex:
Nein, also da bin ich tatsächlich dem treu, wovon ich eben schon gesprochen habe. Ich versuche einfach, für alles offen zu bleiben, um zu spüren, was der nächste sinnvolle Schritt ist.
Einige meiner alten Musikerfreunde haben damals aus reiner Intuition einen Lebensplan geschmiedet, der deckungsgleich war mit ihrer Vision. Musik machte ihnen Spaß, danach war alles ausgerichtet. Diesen Plan haben sie aber nie mehr hinterfragt. Jetzt fahren sie regelmäßig nach Mallorca und müssen dort etwas abliefern, was sie total kaputt macht. Nichts ist mehr übrig von ihrer Intuition und der Leidenschaft – aber sie folgen brav dem Plan. Insofern nein, ich habe keinen Plan.
Wenn man natürlich so eine Firma wie TV Noir betreibt, wo sieben Leute Vollzeit arbeiten und jeden Monat dreißig Leute zusammengetragen werden müssen, dann macht es schon auch Sinn, bestimmte Etappenpläne zu haben. Daher sind wir gerade auch intensiv damit beschäftigt, ein Projektmanagement zu etablieren, damit man Etappen sauber abschließen und sich zumindest mittelfristige Ziele setzen kann.
Wenn man bei einem Projekt auf der einen Seite für Stabilität und Klarheit sorgt, hat man auf der anderen Seite mehr Freiheitsgrade. Dieses Spiel erleben wir oft, gerade wenn wir wieder eine Show organisieren. Wenn man sich in einem festgelegten Rahmen bewegt und genau weiß, was als Nächstes kommt, hat man auch die Möglichkeit, mal ungeplanten Scheiß zu machen. Man fühlt sich durch die Regeln sicher und weiß, dass nichts schiefgehen kann.
Im Yoga gibt es dieses ganz wichtige Prinzip, dass man in der Peripherie Stabilität besitzen muss, damit man im Herzen umso freier und durchlässiger werden kann. Das ist wohl ein ganz schönes Bild dafür.
Tex Drieschner ist Musiker, Gastgeber von TV Noir und lebt in Berlin.