Marius Nitzbon
Interview — Marius Nitzbon
»Die Leute wollen Musik hören, die von einem menschlichen Wesen gemacht wird«
Mit seinen gefühlvollen und präzisen Klangwelten erschafft Marius Nitzbon eine Musik, die tief in unsere Seele greift. Dabei bewegt sich der 23-jährige Komponist und Pianist nicht nur virtuos zwischen Intimität und Lebendigkeit. Er verknüpft auch immer wieder klassische mit elektronischen Elementen – und manchmal sogar mit etwas Vogelgezwitscher. Ein Gespräch über Trost als Antrieb, einen engagierten Musiklehrer und die Frage, ob man für den Algorithmus einer Maschine Empathie empfinden kann.
11. Februar 2024 — Interview & Text: Jonas Meyer, Fotografie: Maximilian König

Wir wagen mal eine These: Es gibt auf der Welt kaum etwas Intimeres, als einem anderen Menschen Musik zu empfehlen. Nein, wir meinen damit nicht jenes inflationäre Hinausgeballere von Spotify-Jahresrückblicken auf Instagram und Co. Sondern die wohlüberlegte Entscheidung, einen bestimmten Song oder gar ein Album, von dem die eigene Seele tief ergriffen ist, einer anderen Person liebevoll ans Herz zu legen. Wie zum Beispiel „Little Human“ von Marius Nitzbon.
Mit diesem Album hat der 23-jährige Neoklassik-Künstler bereits im Juni letzten Jahres ein so wundervolles und wahrhaftiges Stück Musik in die Welt geworfen, dass wir gar nicht anders können, als Euch diese Platte zu empfehlen. In insgesamt elf Tracks nimmt uns Marius mit auf eine verträumt-melancholische Reise, die beim eher reduzierten Piano-Stück „B Town is Awakening“ beginnt und bei „Dyn“ endet – einem überaus markanten Track, der mit pointierten Elektronik-Elementen einen dystopisch wabernden Klangteppich erzeugt. Ganz so, als wäre er Teil eines Films wie „Blade Runner 2049“.
Dabei ist „Little Human“ bereits das zweite Album des jungen Komponisten und Pianisten, der in Bergedorf aufgewachsen ist und aktuell an der Uni Münster Musikproduktion studiert. Schon 2018 erschien mit „Colours for the Blind“ sein Debütalbum, auf dem er seine ersten öffentlichen Gehversuche bei der Kombination klassischer und elektronischer Elemente machte.
Aktuell arbeitet er an einem weiteren Album, das den verheißungsvollen Titel „Birds Are My Friends“ trägt. Für das Recording dieser Platte, die Mitte 2024 erscheinen soll, reiste Marius Ende Mai ins lettische Kuldīga. Zehn Tage lang hatte er sich dort im Studio des berühmten Klavierbauers David Klavins eingemietet, um seine neuen Songs auf dessen „Una Corda“ aufzunehmen – ein von Klavins und Nils Frahm entwickeltes Piano, das über nur eine Saite pro Ton verfügt und einen ganz besonderen Klang hat.
Die insgesamt 13 Tracks sind von gefühlvollen Melodien und Stimmungen getragen, die sich in ausbrechende Dynamiken weiterentwickeln. Dabei steht das zarte Klavierspiel immer wieder in Kontrast zur eher exzentrischen Virtuosität, wodurch Marius – ähnlich wie auf „Little Human“ – ein faszinierendes Spannungsfeld schafft. Dabei kreiert nicht nur das Klacken der Pianomechanik eine unverwechselbar lebendige und intime Atmosphäre – sondern auch der Gesang der Vögel, der ab und zu von draußen in den Saal eindringt.
Vor einigen Wochen haben wir Marius Nitzbon in Berlin zum Interview und Photoshoot getroffen. Dabei sind wir nicht darum herumgekommen, hier und da auch über Spotify zu sprechen. Es hat ja manchmal auch sein Gutes, hätte jemand wie Loriot dazu gesagt.

»Ich bin ein Mensch, der sehr viel in seinen Gedanken lebt.«
MYP Magazine:
Eine Deiner eigenen Spotify-Playlists trägt den Untertitel „Nostalgic longing in its most positive form.“ Was reizt Dich so an dem, was längst vergangen ist?
Marius Nitzbon:
Ich bin ein Mensch, der sehr viel in seinen Gedanken lebt. Oft entsteht dabei auch jene nostalgische Sehnsucht. Das hat nicht selten mit der Musik zu tun, die ich gerne höre – und die in der Playlist liegt mir ganz besonders am Herzen. Ich schätze, daher geht es auch in meinen eigenen Tracks immer wieder um Nostalgie, sei es in meinen Klavierstücken oder in den elektronischen Produktionen. Dabei habe ich Bilder einer Zeit vor Augen, die längst vergangen ist – und die ich selbst oft gar nicht erlebt habe.
»Meine Hoffnung war, der Familie ein kleines bisschen Halt zu geben in der schweren Zeit.«
MYP Magazine:
Eines Deiner meistgehörten Stücke ist der Song „Little Human“ aus dem gleichnamigen Album. Wie ist dieses Lied entstanden?
Marius Nitzbon:
Als ich mit 16 ein halbes Jahr auf Schüleraustausch in Kanada war, habe ich zwei Brüder kennengelernt, die ich sehr, sehr mochte. Wir haben wahnsinnig viel Zeit miteinander verbracht und waren nach meinem Kanada-Halbjahr sogar noch zusammen im Spanienurlaub. Wenige Monate später hat sich einer der Brüder das Leben genommen… sein Name war Chris. Als ich davon erfahren habe, hatte ich das tiefe Bedürfnis, für die Familie einen Song zu schreiben. Meine Hoffnung war, ihr damit ein kleines bisschen Halt zu geben in der schweren Zeit. Und so habe ich zuhause auf meinem Klavier den Song „For Chris“ aufgenommen und ihn 2020 veröffentlicht.
Leider war ich mit der Recording-Qualität überhaupt nicht glücklich. Mein Klavier klingt sehr gewöhnungsbedürftig, es macht im Hintergrund ständig irgendwelche Klack-Geräusche, daher war diese Aufnahme irgendwie nicht genug, wie ich dachte. Aber dann hatte ich den passenden Einfall: Ich wollte den Track in meiner Schule aufnehmen, denn dort gibt es einen ziemlich großen und toll klingenden Flügel. Da wir alle gerade mitten im Lockdown steckten, war die Schule absolut menschenleer, und so konnte ich dort in aller Ruhe recorden.
MYP Magazine:
Und wie ist daraus in der Folge Dein zweites Album entstanden?
Marius Nitzbon:
Auch wenn es ursprünglich nur mein Ziel war, „For Chris“ in einer besseren Qualität aufzunehmen, haben sich aus diesem einen Stück plötzlich immer weitere ergeben – alle aus dem bloßen Versuch heraus, dieses eine Stück schöner klingen zu lassen. Eine der ersten Variationen von „For Chris“ sollte „Little Human“ heißen. Am Ende hatte ich ein ganzes Album in der Hand, das ich ebenfalls „Little Human“ getauft habe… Ich glaube, der Titel ist ein bisschen selbsterklärend. Chris war 15 Jahre alt.

»Niemand aus dem Publikum kannte die tatsächliche Story hinter dem Album. So konnten alle zu meiner Musik ihre ganz eigene Geschichte entwickeln.«
MYP Magazine:
Interessanterweise hört sich das Album nicht wie ein Zufallsprodukt an, sondern wie etwas, in das sehr viel Konzeptarbeit geflossen ist: einerseits, weil es so eine emotionale Tiefe hat; andererseits, weil es im Kopf einen fiktionalen Plot erzeugt – ähnlich wie ein gutes Buch.
Marius Nitzbon: (lächelt)
Diese Assoziation höre ich immer wieder, zuletzt bei einem Festival in Hannover, auf dem ich gespielt habe – auch wenn ich den undankbarsten Slot überhaupt erhalten hatte: an einem Sonntagmittag um 13 Uhr. Um diese Zeit standen ganze zehn Leute vor der Bühne und ich dachte, dabei bleibt‘s. Aber dann kam immer mehr Laufpublikum, das stehengeblieben ist.
Nach dem Auftritt erzählten mir die Leute, dass sie bei meiner Musik die Augen geschlossen und irgendwelche Filme gesehen hätten. Für mich war das ein sehr besonderes Kompliment, denn niemand aus dem Publikum kannte die tatsächliche Story hinter dem Album. So konnten alle zu meiner Musik ihre ganz eigene Geschichte entwickeln. Das hat meine Intention am Ende völlig unwichtig gemacht – für mich war und ist das etwas Wunderschönes an der Musik ohne Text.

»Der Song gehört zu den vielen Dingen, mit denen sie versuchen, die Erinnerung an ihren Sohn hochzuhalten.«
MYP Magazine:
Hast Du Sorge, dass die Menschen das Album mit anderen Ohren hören, wenn sie wissen, welche Tragödie der Auslöser war?
Marius Nitzbon:
Definitiv – denn eigentlich will ich das nicht. Ich war mir nicht mal sicher, ob es überhaupt okay ist, öffentlich darüber zu sprechen. Daher habe ich im Vorfeld auch bei Chris‘ Familie nachgefragt…
MYP Magazine:
Und was war die Antwort?
Marius Nitzbon:
Dass ich die Geschichte auf jeden Fall erzählen soll – die von Chris genauso wie die der Entstehung des Songs. Sie haben mir gesagt, dass „Little Human“ zu den vielen Dingen gehört, mit denen sie versuchen, die Erinnerung an ihren Sohn hochzuhalten.
»Ich habe mich von dem Anspruch verabschiedet, dass das Album ein elektronisches Gesamtwerk sein muss.«
MYP Magazine:
Auch wenn das Album aus einem einzigen Song heraus entstanden ist, wirken die insgesamt elf Tracks sehr eigenständig und divers. Wie ist es Dir gelungen, Dich aus der Gefühlslage von „Little Human“ für die anderen zehn Songs zu lösen?
Marius Nitzbon:
Ich komme musikalisch stark von Nils Frahm, meinem großen Idol. Nils arbeitet in seiner Musik sehr viel mit Synthesizern, weshalb auch ich am Anfang versucht habe, eher elektronische Stücke aufzunehmen. Aber das ist eine ultrakomplexe Angelegenheit, mir ist es einfach nicht gelungen. „Dyn“, aber auch „Swell“ sind nichts anderes als die Überbleibsel aus elektronischen Tracks, bei denen ich am Ende nicht bereit war für diese enorme Komplexität an Soundelementen. Aus diesem Grund habe ich bei anderen Stücken immer öfter mal das Klavier sprechen lassen und mich von dem Anspruch verabschiedet, dass das Album ein elektronisches Gesamtwerk sein muss. Durch dieses Ausprobieren habe ich mich sukzessive von dem Gefühl gelöst, aus dem heraus „For Chris“ entstanden ist.

»Ich habe das Gefühl, dass man aus dem Klavier noch viel mehr herausholen kann, wenn man ein bisschen elektronisch denkt.«
MYP Magazine:
In Deiner Musik verbindest Du immer wieder klassische mit elektronischen Elementen – ein bisschen so, als würde man Erik Satie mit Kollektiv Turmstraße mischen. Was geben dir diese beiden musikalischen Welten?
Marius Nitzbon:
Ich finde klassische Musik superspannend, vor allem klassische Klaviermusik. Aber ich habe das Gefühl, dass man aus dem Klavier noch viel mehr rausholen kann, wenn man ein bisschen elektronisch denkt. Ein Beispiel: Ich sehe meine linke Handbegleitung oft als eine Art Synthesizer Pad. Um „Pad-mäßig“ zu spielen, versuche ich möglichst leise zu spielen, um dadurch weniger Obertöne aus den Saiten zu kitzeln. Dadurch haben die rechte Hand und ihre Melodien automatisch mehr Platz. Andersherum finde ich elektronische Musik erst dann besonders ansprechend, wenn darin akustische oder Live-Performance-Elemente stecken. Ich kann gar nicht anders, als diese beiden Welten immer zusammen zu denken.
»Das, was wirklich an einem zehrt, ist dieses stundenlange Aufnehmen.«
MYP Magazine:
Für dein kommendes Album „Birds Are My Friends“ bist du vor einigen Monaten für zehn Tage ins lettische Städtchen Kuldīga gereist, um dort auf dem „Una Corda“-Piano des Klavierbauers David Klavins Deine Songs aufzunehmen. Was genau ist das für ein Instrument?
Marius Nitzbon:
Das „Una Corda“ ist ein neuartiges Klavier, das David Klavins zusammen mit Nils Frahm entwickelt hat. Anders als normale Pianos hat es statt drei nur eine Saite pro Ton – auf Italienisch una corda. Für mich persönlich klingt dieses Instrument ein bisschen so wie ein E-Piano oder eine Harfe. Andere hören darin aber auch eine Gitarre – was natürlich Sinn macht, denn Gitarre und Harfe haben auch nur eine Saite pro Ton. Insgesamt hat das „Una Corda“ also einen ganz eigenem Klang, der ein bisschen klarer, heller und leichter ist als der eines normalen Pianos.
MYP Magazine:
Wie hast du die zehn Tage in Kuldīga empfunden?
Marius Nitzbon:
Das war mit die beste Zeit, die ich mit mir und meiner Musik verbracht habe! Aber auch die intensivste, weil ich nächtelang gespielt und aufgenommen habe. Man sagt ja, der nervigste Teil von sowas ist immer die Postproduktion. Aber das, was wirklich an einem zehrt, ist dieses stundenlange Aufnehmen. Man weiß: In zehn Tagen muss alles fertig sein, also arbeitet man extrem viel und schaut besonders selbstkritisch auf das, was man so fabriziert.

»Heutzutage kann Billie Eilish super leise in ihr Mikrofon singen und daraus wird ein Megahit. Und genauso super leise kann man auch Klaviermusik aufnehmen.«
MYP Magazine:
Du bist über Deinen ehemaligen Musiklehrer auf die Arbeit von Nils Frahm und David Klavins aufmerksam geworden. Welchen Einfluss hat dieser Lehrer auf Deinen persönlichen Werdegang?
Marius Nitzbon:
Einen riesigen! Ich erinnere mich noch gut daran, dass Herr Sieveking (schöne Grüße an der Stelle) mit uns mal in der 7. Klasse das Thema Minimal Music durchnahm. Dabei führte er uns auch an Künstler wie Philip Glass und Nils Frahm heran – und erzählte uns stolz, dass Nils Frahm auch mal Schüler auf unserer Schule in Bergedorf war. Verrückt, oder?
Als Herr Sieveking später mal von David Klavins und seinem „Una Corda“ berichtete, fand ich es richtig cool, wie jemand, der eigentlich ein klassischer Klavierbauer ist, einfach mal die Regeln bricht. Immerhin sind die Patente für Pianos um die 150 Jahre alt und haben sich nie geändert. Klaviere werden seit jeher nach dem gleichen Prinzip gebaut, sprich mit drei Saiten pro Ton. Die sind dazu da, um das Instrument möglichst laut klingen zu lassen, denn damals gab es noch keinen Verstärker. Heutzutage kann Billie Eilish super leise in ihr Mikrofon singen und daraus wird ein Megahit. Und genauso super leise kann man auch Klaviermusik aufnehmen, denn mittlerweile ist man nicht mehr angewiesen auf physische Gegebenheiten wie etwa eine Mindestlautstärke, da man eh alles elektronisch verstärkt – egal ob bei Konzerten oder auf unseren Kopfhörern. Diesem Zeitgeist ist auch David Klavins gefolgt und hat das Instrument völlig neu gedacht. Das finde ich nach wie vor extrem spannend.

»Ich habe meine Songs immer nur nachts aufgenommen, weil ich mir den regulären Tagestarif nicht leisten konnte.«
MYP Magazine:
Für Deine Aufnahme-Session in Lettland hast Du eigentlich absolute Stille gesucht – bekommen hast Du aber jede Menge Vogelgezwitscher…
Marius Nitzbon:
Stimmt. Das liegt daran, dass ich meine Songs immer nur nachts aufgenommen habe, weil ich mir den regulären Tagestarif nicht leisten konnte. Daher hat mir David Klavins erlaubt, sein Studio außerhalb der regulären Zeiten zu nutzen. Soll heißen: Sobald er und seine Kolleg*innen in der Pianowerkstatt Feierabend gemacht haben, konnte ich mit dem Recording anfangen. Das war meistens so gegen 19, 20 Uhr – und in den frühen Morgenstunden, nach acht, neun Stunden, sind dann die Vögel aufgewacht. Ganz am Anfang war das noch gegen vier Uhr morgens. Aber mit jedem weiteren Tag fing das Gezwitscher etwas früher an, weil es auch immer früher hell wurde. Am Ende konnte ich ziemlich genau vorhersagen, in wie vielen Minuten sich die ersten Vögel melden.

»In der Nachbearbeitung habe ich gemerkt, dass ich diesen atmosphärischen Vogelsound in gewisser Weise auch sehr schön finde.«
MYP Magazine:
War das für Dich nicht der absolute Albtraum? Immerhin hast Du für die Aufnahme doch Stille gebraucht…
Marius Nitzbon:
Am Anfang war das tatsächlich eher nervig. Doch in der Nachbearbeitung habe ich gemerkt, dass ich diesen atmosphärischen Vogelsound, der vor allem auf den Raum-Mikros liegt, in gewisser Weise auch sehr schön finde. Davon abgesehen bekommt man diese speziellen Geräusche in der Postproduktion nie ganz weg. Also habe ich sie einfach drin gelassen.
MYP Magazine:
Das heißt, der Albumtitel ist eine nachträgliche Geste der Versöhnung an die lettische Vogelwelt?
Marius Nitzbon: (lacht)
Das kann man so sagen, ja.
»Ich finde: Wenn man Musik zu glatt bügeln will, verliert sie ihre Magie.«
MYP Magazine:
Auch in der Vergangenheit hast Du in Deinen Stücken immer wieder mal mit mehr oder weniger subtilen Hintergrundgeräuschen gespielt. In Deinen „Forest Sessions“ etwa hast Du Naturgeräuschen eine sehr prominente Rolle gegeben. Was reizt Dich so an diesen nichtmusikalischen Elementen?
Marius Nitzbon:
Das Besondere daran ist, dass man beim Hören das Gefühl hat, an der Aufnahme zu partizipieren – als wäre man im selben Raum. Oder zumindest in demselben Ambiente. Das Gehirn scheint es zu schaffen, dass man diese Elemente nicht als Störgeräusche wahrnimmt, sondern als integralen Teil des Tracks. Das macht die Musik nach meinem Empfinden irgendwie nahbarer und persönlicher. Bei den „Forest Sessions“ hätte ich es auch eher langweilig gefunden, wenn das Ganze im Studio aufgenommen worden wäre. Die zwitschernden Vögel waren da ein essenzieller Teil des Konzepts. Ich finde: Wenn man Musik zu glatt bügeln will, verliert sie ihre Magie.

»Auf einem Live-Konzert ist es doch irgendwie netter, wenn auf der Bühne ein bisschen performt wird und man sich zur Musik auch bewegen kann.«
MYP Magazine:
Die Tracks auf „Birds Are My Friend“ wirken im Vergleich zur aktuellen Platte wesentlich rhythmischer und treibender – und geradezu tanzbar. Oder anders gesagt: Wenn einem diese Musik auf dem Soundtrack von „Babylon Berlin“ begegnen würde, würde man sich nicht wundern. Ist „Birds Are My Friend“ der Versuch einer Kernschmelze aus Klassik und Elektronik?
Marius Nitzbon:
Ja, das kann ich zumindest aus heutiger Perspektive sagen. Denn über die letzten Jahre gab es immer öfter den Impuls in mir, Tracks zu kreieren, die auch ein bisschen reinkicken, wenn man sie live spielt…
MYP Magazine:
Um beispielsweise die Leute am Sonntagmittag auf einem Festival aufzuwecken…
Marius Nitzbon: (lächelt)
Genau! Mit solchen Stücken ist es live vor Publikum wesentlich einfacher für mich… Aber was heißt schon einfach? Ich komme ja immer noch mit recht schwerer Musik an, die eher introspektiv und träumerisch ist, zumindest im Vergleich zu dem, was sonst auf solchen Festivals gespielt wird.
Wenn die Leute zuhause auf der Couch sitzen, ihre Kopfhörer aufhaben und in dem entsprechenden Mindset sind, „funktioniert“ meine Musik total gut. In so einem Setting entscheidet man sich ja auch bewusst dafür. Aber auf einem Live-Konzert ist es doch irgendwie netter, wenn auf der Bühne ein bisschen performt wird und man sich zur Musik auch bewegen kann. Und das geben die neuen Stücke definitiv her. Ich wollte im Vorfeld unbedingt ein Album machen, mit dem ich mehr auf die Bühne kommen kann – und ich glaube, das ist mir gelungen.

»In nur sechs Wochen habe ich Popmusik von wirklich allen Seiten kennengelernt.«
MYP Magazine:
Mitte 2023 hast Du unter dem Namen „Neon Valis“ ein zweites musikalisches Projekt gestartet, mit dem Du dich hauptsächlich im Electronic Dream Pop bewegst. Wie kam es dazu? Und was gibt Dir „Neon Valis“, was Du in „Marius Nitzbon“ nicht findest?
Marius Nitzbon:
Dazu muss ich ein wenig ausholen. Ich habe vor drei Jahren den Popkurs an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg belegt. Dieser Kurs ist ein sogenannter Kontaktstudiengang, bei dem jedes Jahr etwa 50 junge Musiker*innen in zwei Intensivkursen à drei Wochen gecoacht werden. Das Ganze findet immer im März und August statt, also in den Semesterferien. Für mich war das damals perfekt, da ich durch Empfehlungen von Teilnehmern schließlich zur Musikhochschule in Münster gefunden habe, wo ich immer noch studiere.
Wenn ich heute auf diesen Popkurs zurückblicke, muss ich sagen, dass das meine totale „Musik-Spielwiesen-Zeit“ war. Erstens, weil ich mich musikalisch austoben konnte wie noch nie zuvor in meinem Leben. Und zweitens, weil ich mit den absolut unterschiedlichsten Leuten spielen konnte – und manchmal auch musste. Denn bei uns im Kurs gab es nur drei Keyboarder. Und einer davon war ich. Wegen dieses akuten Keyboarder-Mangels durfte ich Jahr darauf erneut teilnehmen, wodurch ich unter anderem auch die Jungs meiner heutigen Band KARRERA kennengelernt habe. In diesen beiden Jahren habe ich über einen Zeitraum von insgesamt zwölf Wochen an unzähligen Sessions teilgenommen, Dutzende Konzerte gespielt und an über 50 Songs mitgewirkt. Auch wenn ich danach kurz vor dem Burnout war: Ich habe in dieser Zeit Popmusik von wirklich allen Seiten kennengelernt. Und ich bin auf vieles gestoßen, das ich mit „Marius Nitzbon“ künstlerisch nicht ausdrücken kann. All das versuche ich nun über „Neon Valis“ zu transportieren. Was genau das ist, kann ich aber selbst noch nicht in Worte fassen.

»Ich setze auf das Altbewährte: auf Künstler, bei denen ich weiß, dass es sich um echte Menschen mit einem musikalischen Anspruch handelt.«
MYP Magazine:
Im Mai hat die ARD eine Dokuserie mit dem Titel „Dirty Little Secrets“ veröffentlicht, die uns einen Blick hinter die Kulissen des schillernden Musikbusiness ermöglicht. Dabei geht es unter anderem um – teilweise von Spotify – bezahlte Fake-Interpret*innen, die in reichweitenstarken Playlists platziert werden. Wie blickst Du als Newcomer auf den Musikmarkt?
Marius Nitzbon:
Dieses Thema ist krass präsent in meinem Kopf. Ich selbst habe auch schon mehrere solcher Angebote erhalten – von irgendwelchen Leuten, die sich als Musiklabel ausgeben. Mittlerweile weiß ich, dass sich dahinter in der Regel Einzelpersonen verbergen, die mal ein paar tausend Euro in Playlist-Promotion gesteckt haben. Jetzt versprechen sie vollmundig, deine Musik zu pushen – gerne mit dem Hinweis, innerhalb von kürzester Zeit über eine Million Streams zu generieren.
Früher fand ich so etwas noch sehr verlockend, weil ich dachte, es könnte mir tatsächlich helfen, mich im Musikbusiness als glaubwürdigen Künstler zu etablieren. Aber dann musste ich mit Erschrecken feststellen, wie viele Leute sich in dem Bereich tummeln, die zehn Projekte gleichzeitig bedienen und den Markt mit Musik überschwemmen. Eine Musik, die teilweise so belanglos ist, dass ich selbst sie gar nicht hören will. Ich setze viel lieber auf das Altbewährte: auf Künstler wie Nils Frahm, Ólafur Arnalds oder Martin Kohlstedt, bei denen ich weiß, dass es sich um echte Menschen mit einem musikalischen Anspruch handelt; Menschen, die sich handwerklich und emotional wirklich mit dem auseinandersetzen, was sie tun.

»Man muss den Leuten zeigen: Ich bin ein echter Mensch.«
MYP Magazine:
Doch auch die Arbeit dieser großen Künstler gerät immer mehr in Gefahr. Denn für künstliche Intelligenzen ist es schon lange kein Problem mehr, eigene Songs zu schreiben. Und diese Fähigkeit wird von Tag zu Tag ein bisschen besser. Fühlst Du dich durch diese Entwicklung in Deiner Existenz bedroht? Oder positiv gefragt: Welchen Vorteil hast du nach wie vor als Mensch gegenüber der KI?
Marius Nitzbon:
Immer, wenn mir ein Argument dafür einfällt, denke ich im nächsten Moment, dass man auch das letztendlich programmieren kann. Daher glaube ich, dass es am Ende nur noch einen einzigen Vorteil geben wird: die Tatsache, dass die Musik von einem Mensch geschrieben wurde. Ich bin mir sicher, dass sich das nie ändern wird: Die Leute wollen Musik hören, die von einem menschlichen Wesen gemacht wird. Vielleicht nicht, wenn es sich um dudelige Hintergrundmusik im Supermarkt handelt. Aber immer dann, wenn man vor einer Bühne steht und sich zu dem bewegen will, was der Mensch da oben mit seiner Stimme und den Instrumenten erzeugt.
MYP Magazine:
Auch wenn es um 13 Uhr auf einem Festival ist.
Marius Nitzbon: (lacht)
Gerade dann! Sonst würde ja erst recht niemand kommen. Daher will ich mit dem neuen Album auch mehr auf die Bühne. Mir bleibt eh nichts anderes übrig. Wenn ich als Künstler bei meiner Klaviermusik bleiben will und mich weiterhin weigere, für zehn Spotify-Projekte gleichzeitig zu komponieren, muss ich konsequent den Weg der Live-Auftritte gehen. Man muss den Leuten zeigen: Ich bin ein echter Mensch.

»Für die Gefühlswelt eines Menschen können wir Empathie empfinden. Für den Algorithmus einer Maschine nicht.«
MYP Magazine:
Es ist ohnehin fraglich, ob eine KI die Empathie hätte, einer Familie, die um ihren verstorbenen Sohn trauert, einen Song zu schenken – nur, um ihr ein wenig Trost zu spenden.
Marius Nitzbon:
Aber kann man nicht auch so etwas programmieren? Ich befürchte, dass eine KI dazu ebenfalls bald in der Lage sein wird. Der einzige Unterschied bleibt die menschliche Intention. Für die Gefühlswelt eines Menschen können wir Empathie empfinden. Für den Algorithmus einer Maschine nicht.
MYP Magazine:
Der Mensch bleibt am Ende eben immer Mensch…
Marius Nitzbon:
Und er will Mensch! Gerade in einer Welt, die mehr und mehr von künstlichen Intelligenzen beherrscht wird. Der Mensch will einen anderen Menschen, der leibhaftig auf der Bühne steht, eine persönliche Message hat und dabei auch Fehler macht, immer und immer wieder. Das wird das nostalgic longing der Zukunft sein.
Mehr von und über Marius Nitzbon:
instagram.com/mariusnitzbon
mariusnitzbon.com
youtube.com/@MariusNitzbon
spotify.com
Interview & Text: Jonas Meyer
Fotografie: Maximilian König
instagram.com/studio.maximilian.koenig
maximilian-koenig.com
Sina Martens
Interview — Sina Martens
»In Resignation zu versinken ist nicht die Art, wie ich leben möchte«
Im Berliner Ensemble steht Schauspielerin Sina Martens seit zwei Jahren als Britney Spears auf der Bühne, für Amazon Prime hat sie nun die Rolle einer Rucksacktouristin übernommen, die entführt und in einen Kofferraum gesperrt wurde: zwei ungleiche Formate, zwischen denen es mehr Parallelen gibt, als man im ersten Moment vermuten würde. Ein Gespräch über männliche Gewalt, weiblichen Überlebenswillen und das Prinzip Hoffnung in Momenten, die absolut aussichtslos erscheinen.
24. Januar 2024 — Interview & Text: Jonas Meyer, Fotografie: Steven Lüdtke

„Der permanente Wunsch von Künstler*innen, bekannt zu sein, sowie der ebenso permanente Wunsch ihrer Fans, wirklich alles über sie zu wissen, ist ein geradezu vulgäres Zeichen unserer Zeit“, schrieb der Kulturjournalist Douglas Greenwood vor Kurzem in einem Artikel für das „i-D Magazine“. Und in der Tat: Spätestens seit Social Media scheint nichts mehr zu privat oder zu intim, um es mit der ganzen Welt zu teilen – oder zumindest mit der eigenen Followerschaft. Wer nicht liefert, muss mit Liebesentzug rechnen.
Doch nicht alle, die im Showgeschäft tätig sind, hegen diesen Wunsch. Vor allem nicht, wenn sie am eigenen Leib erlebt haben, wie es ist, nicht mehr als menschliches Wesen wahrgenommen zu werden, sondern nur noch als Ereignis. Wie zum Beispiel Britney Spears.
Bereits im Kindesalter wurde die heute 42-Jährige von ihrer Mutter zu diversen Castings und Talentshows geschleppt, ihre Jugend opferte sie einer TV-Sendung namens „Mickey Mouse Club“, vor den Augen eines Millionenpublikums. Doch das eigentliche Unglück ereignete sich erst Ende der Neunziger – als ihr Debütalbum „… Baby One More Time“ auf Platz 1 der US-Billboard-Charts schoss und sie ein Star wurde. Von nun an war Britney Spears als Privatperson passé und ihr Leben vollzog sich unter der ständigen Beobachtung – und Beurteilung – der Weltöffentlichkeit.
Vor allem das Jahr 2007 brannte sich dabei ins kollektive Gedächtnis. Nach dem Scheitern zweier Ehen rasierte sich die Künstlerin, von der viele gehofft hatten, dass sie auf immer und ewig das laszive Schulmädchen mit den blonden Zöpfe bliebe, die schönen Haare ab. Außerdem begab sie sich in eine Reha-Klinik für Suchtkranke. Und ihrem Exmann wurde das alleinige Sorgerecht für die gemeinsamen Kinder zugesprochen.
Spätestens nach diesem Jahr verfiel die Boulevard-Presse in Goldrausch. Angetrieben von einer schier unersättlichen Informationsgier der Weltöffentlichkeit, drehte sich das mediale Rad immer weiter – und wurde belohnt: Anfang 2008 wurde Britney Spears durch ein Gericht entmündigt und ihr Vater zum Vormund bestellt. Erst 13 Jahre später, nach einem fast biblischen Martyrium, wurde die Vormundschaft aufgehoben und Britney war wieder ein freier Mensch.
Doch wer ist dieser Mensch überhaupt?
Dieser Frage geht seit Januar 2022 das Theaterstück „It’s Britney, Bitch!“ am Berliner Ensemble nach. Entwickelt von Autorin Lena Brasch und Schauspielerin Sina Martens, wird dem Publikum hier eine Perspektive eröffnet, die so gar nichts mit dem Bild zu tun hat, das in der Presse – und damit in der Geschichte der Popkultur – über drei Jahrzehnte aufgebaut wurde. Es ist die Perspektive einer Frau, die nicht nur an ihrer Seele, sondern auch in ihrer Würde verletzt wurde. Und die nicht aufgegeben hat, sich zu behaupten – gegenüber der öffentlichen Meinung, den Gerichten und nicht zuletzt auch ihrer Familie.
Dargeboten wird das Solostück von Sina Martens, die auf der Bühne 75 Minuten lang nichts anderes tut, als diesem menschlichen Wesen namens Britney Spears ein kleines bisschen Würde zurückzugeben. Was für eine Leistung!
Die 35-Jährige, die in Leipzig Schauspiel studiert hat und seit der Spielzeit 2017/2018 Teil des Berliner Ensembles ist, liefert aber nicht nur auf der Theaterbühne ab. Seit vielen Jahren brilliert sie auch immer wieder vor der Kamera. Ab dem 26. Januar zum Beispiel ist sie in der Amazon-Produktion „Trunk – Locked In“ zu sehen, in der sie – ähnlich wie in „It’s Britney, Bitch!“ – fast 90 Minuten lang eine Solorolle übernimmt. In dem packenden Thriller verkörpert sie eine junge Rucksack-Touristin namens Malina, die entführt und in einem Kofferraum gesperrt wurde und nun versuchen muss, sich irgendwie aus dieser Misere zu befreien.
Wir treffen Sina Martens am Morgen nach einem Auftritt in der Kantine des Berliner Ensembles. Als wir das Gespräch beginnen, läuft im Hintergrund der Song „Rosa Luft“ von Das Paradies:
Du träumst nicht das, was wird
Du träumst nicht das, was war
Du träumst für uns
Von der Gegenwart
Besser hätte man die gestrige Vorstellung von „It’s Britney, Bitch!“ nicht zusammenfassen können.

»Das Thema Emanzipation ist keines, das ausschließlich der jungen Generation vorbehalten wäre.«
MYP Magazine:
Seit der Premiere Anfang 2022 hast Du auf der Bühne etliche Male den Popstar Britney Spears verkörpert. Welches Zwischenfazit ziehst Du nach knapp zwei Jahren „It’s Britney, Bitch“?
Sina Martens:
Schon als wir im Herbst 2021 mit den Proben begonnen haben, hatte ich die leise Hoffnung, dass es uns gelingen würde, mit unserer Geschichte den einen oder anderen Menschen zu berühren. Dabei meinte ich vor allem junge Frauen, immerhin geht es in dem Stück einerseits um eine schwierige Vater-Tochter-Beziehung und andererseits um den Umgang mit Frauen in der Öffentlichkeit. Aber bereits nach den ersten Vorstellungen wurde sichtbar, dass wir mit „It’s Britney, Bitch!“ ein Publikum über alle Geschlechter hinweg erreichen. Vor allem in der Eltern-Kind-Thematik finden sich auch viele Männer wieder. Und manche von ihnen hinterfragen sogar ihre eigene Position als Mann in der Gesellschaft, nachdem sie das Stück gesehen haben…
MYP Magazine:
… weil das Thema Emanzipation kein exklusiv weibliches ist?
Sina Martens:
Nicht nur das! Es ist auch keines, das ausschließlich der jungen Generation vorbehalten wäre. Klar, ich freue mich, dass vor allem junge und diverse Menschen in unser Stück kommen, immerhin ist das Publikum hier sonst eher ein älteres – und vor allem ein sehr weißes. Dennoch berührt es mich genauso sehr, wenn wir mit einem Theaterstück über Britney Spears auch die ältere Generation erreichen können. Erst gestern Abend hat mich nach der Vorstellung eine Dame um die 70 angesprochen, um mir zu sagen, wie wichtig sie es findet, dass wir auf der Bühne diese Themen behandeln.

»Es ist nach wie vor wichtig, diese besondere Geschichte zu erzählen.«
MYP Magazine:
Gibt es in Deinem Alltag – außerhalb des Theaters – Momente, in denen Du an den Mensch Britney Spears denken musst?
Sina Martens:
Die gibt es immer wieder. Zwar ist meine eigene Geschichte eine völlig andere als ihre, dennoch findet auch in mir eine ganz persönliche Auseinandersetzung mit diesen Themen statt. Da geht es mir nicht anders als den Menschen im Publikum. Ich denke da vor allem an das Ende des Stücks, wenn ich frage: „Wie soll man jemals lieben, wenn man so geliebt wurde?“ Hinter dieser Frage steht für mich eine grundsätzliche und universelle Auseinandersetzung mit dem eigenen Seelenleben, da ist Britney mir sehr nah.
Davon abgesehen muss ich an sie denken, wenn ich sehe, lese und erlebe, wie immer noch mit Frauen in der Öffentlichkeit umgegangen wird. Unser Stück bezieht sich zwar auf die Ereignisse von 2007 – und ein bisschen was hat sich seitdem auch verändert. Aber vieles auch nicht. Aus diesem Grund ist es nach wie vor wichtig, diese besondere Geschichte zu erzählen.

»Britney Spears war immer so etwas wie eine kollektive Erfahrung. Den Mensch dahinter hat so gut wie niemand gesehen.«
MYP Magazine:
In Eurem Stück geht es um die massenhaften Übergriffe auf das Leben, den Körper und die Seele eines einzelnen Menschen. Wie hast Du dir eine Figur erarbeitet, die in ihrem Leben ein so großes Maß an Unterdrückung erfahren hat? Eine Figur, die zwar entmündigt ist und handlungsunfähig scheint, aber gleichzeitig unermüdlich weiterarbeitet und riesige Konzerte spielt?
Sina Martens:
Für mich gab es hier zwei Ebenen der Erarbeitung. Auf der einen, der physischen, habe ich mich sehr intensiv mit Britneys Bühnenpräsenz und ihren Choreografien auseinandergesetzt. Sie ist nach wie vor eine fantastische Tänzerin und Sängerin, das hat mich ziemlich beeindruckt – und ich habe mit der Choreografin Brittany Young viele Stunden trainiert, um mir diesen besonderen Bewegungsstil anzueignen.
Daneben musste ich mir die Rolle aber auch emotional erarbeiten. Im Fall von Britney hieß das, sich mit der riesigen Einsamkeit einer Frau auseinanderzusetzen, von der fast alle glaubten, sie ganz genau zu kennen. Britney Spears war für die Leute immer so etwas wie eine kollektive Erfahrung. Den Mensch dahinter hat so gut wie niemand gesehen.

»Wir wollen uns mit dem Stück nicht anmaßen, diese Frau erklären zu wollen.«
MYP Magazine:
Zu Britney Spears schien um die Jahrtausendwende wirklich jede*r etwas zu sagen zu haben…
Sina Martens:
… und genau auf diesen Zug wollen wir nicht aufspringen! Wir wollen uns mit dem Stück nicht anmaßen, diese Frau erklären zu wollen. Wir können lediglich nach einzelnen Punkten in ihrer Biografie suchen, mit denen wir uns irgendwie verbinden können. Und das sind für uns die Themen Vater-Tochter-Beziehung, Frauen in der öffentlichen Wahrnehmung und emotionale Vereinsamung.
MYP Magazine:
In den ersten Minuten des Stücks hältst Du eine Kaffeetasse mit folgender Aufschrift in die Luft: „Britney survived 2007. You can handle today.“ („Britney hat 2007 überlebt, also schaffst du diesen Tag.“) Und tatsächlich: Diesen massenhaften seelischen Missbrauch zu überleben, ist eine Leistung.
Sina Martens:
Das sehe ich ganz genauso. Für mich ist es auch interessant zu beobachten, dass einige Popstars, die nach Britney Spears groß geworden sind, ihrem privaten Ich erst mal eine Kunstfigur vorangestellt haben. Lady Gaga zum Beispiel. Wer weiß, vielleicht kann so eine Kunstfigur einen besseren Schutz vor dem bieten, was Britney erleiden musste. Die war leider immer „nur“ die echte Britney Spears und keine Kunstfigur, dadurch konnte die ganze Welt ungefiltert an ihrem Privatleben partizipieren. Schon als Kind arbeitete sie hart im „Mickey Mouse Club“ – und bereits da gab es keinen Schutzraum für sie.

»Was, wenn 2007 ein Akt der Emanzipation war?«
MYP Magazine:
Weißt Du, wie es ihr heute geht?
Sina Martens:
In unserem Ankündigungstext zur Premiere haben wir vor zwei Jahren gefragt: „Was, wenn 2007 ein Akt der Emanzipation war?“ Denn uns war aufgefallen, dass es bei der Berichterstattung aus jener Zeit kein einziges Medium gab, das Britneys Handeln als einen emanzipatorischen, selbstermächtigen Akt gedeutet hatte. Überall ging es nur um den körperlichen und physischen Untergang eines Weltstars. Doch wenn man bei den Bildern von damals genau hinschaut, zum Beispiel in der Doku „Framing Britney Spears“, sieht Britney weder fertig noch völlig durch aus. Ganz im Gegenteil: Sie wirkt rebellisch und stark – übrigens auch durch die kurzen Haare, wofür die Presse sie damals für verrückt erklärt hatte.
In ihren Memoiren, die erst vor wenigen Monaten erschienen sind, beschreibt Britney Spears, dass sie sich zu jener Zeit von alten Rollenbildern befreien wollte. Ich weiß zwar nicht, wie es ihr heute geht, aber für mich ist dieses Buch zum allerersten Mal so etwas wie ihre eigene Stimme. Und das macht Mut.

»Eines der wichtigsten Leitmotive im Leben ist die Frage: Wie wird man zu Ende geliebt?«
MYP Magazine:
An einer Stelle des Stücks zitierst Du Goethe: „Und wenn ich dich liebe, was geht es dich an?“ Welche Bedeutung hat diese Frage im Britney-Spears-Kontext?
Sina Martens:
Ich mag dieses Zitat wahnsinnig gerne. Eines der wichtigsten Leitmotive im Leben ist doch die Frage: Wie wird man zu Ende geliebt? Dabei geht es um die große Hoffnung, dass die Person, der wir unsere Liebe gestehen, mit einem „Ich liebe dich auch“ antwortet. Tut sie das nicht, sind wir tief verletzt. Aus diesem Grund machen wir unsere Liebe oft gar nicht erst sichtbar, weil die Angst vor einer Abweisung viel zu groß und mit einer enormen Scham verbunden ist.
Goethe löst diese Abhängigkeit auf und gibt uns unsere Autonomie zurück. Er sagt nichts anderes als: Es kann sein, dass ich dich liebe. Aber das ist meine Sache und geht dich nichts an. Ob ich dir davon erzähle oder nicht, ist ganz allein meine Entscheidung.
In Bezug auf unser Stück verstehe ich das Zitat in einem erweiterten Kontext. Aus Sicht von Britney Spears meint es: Ich habe mich wund geliebt an der Welt. Ich habe ihr immer gesagt, dass ich sie liebhabe, und nie kam echte, aufrichtige Liebe zurück. Mit jedem Mal tat das ein bisschen mehr weh. Und irgendwann habe ich entschieden, meine Liebe für mich zu behalten. Sie geht die Welt da draußen nichts mehr an.

»Statt mit Würde abzutreten, fällt Thomas Gottschalk nichts anderes ein, als weiter eine Debatte um Cancel Culture anzuheizen und sich dabei ganz seltsam zum Opfer zu stilisieren.«
MYP Magazine:
In Euer Theaterstück habt ihr auch einige Audio-Ausschnitte von Interviews eingebunden, in denen Britney Spears die übergriffigsten Fragen gestellt werden – etwa zu Brustimplantaten oder ihrer Jungfräulichkeit. Dabei gibt es auch einen Ausschnitt aus einer „Wetten, dass..?“-Sendung von 2002, in dem es um Britneys Beziehungsstatus geht. 21 Jahre später scheint hier die Welt immer noch die Gleiche zu sein: Ende November begleitete Moderator Thomas Gottschalk in seiner letzten Sendung die Sängerin Cher mit den Worten von der Bühne: „I can still take you by the hand, because nowadays you‘re really afraid to touch a girl.“ („Ich kann dich immer noch an die Hand nehmen – heutzutage muss man ja richtig Angst haben, ein Mädchen zu berühren.“) Was machen solche Momente mit Dir?
Sina Martens:
Das macht mich erst mal fassungslos. (schweigt für einen Moment) In unserem Stück gibt es eine Stelle, an der ich über Journalismus spreche. Ich sage: „Journalismus ist niemals langweilig, dafür aber wahnsinnig anstrengend, unterliegt strengen Regeln und man gewinnt nie einen Beliebtheitswettbewerb.“ In der Sonntagsvorstellung nach der „Wetten, dass..?“-Sendung habe ich an dieser Stelle einen kleinen Gruß an Thomas Gottschalk eingebaut. Ich finde es unglaublich, wie sich dieser Mann verhält. Der Spruch gegenüber Cher war ja nicht der einzige. Zu der Rapperin Shirin David sagte er, sie sehe ja gar nicht aus wie eine Feministin oder Opernliebhaberin. Das ist doch irre! Ich hatte in dem Moment das Gefühl, ein fiktionales Format zu sehen, aber das war im besten Sinne Realsatire…
MYP Magazine:
… in gewisser Weise strombergig.
Sina Martens:
Ja, tatsächlich. Das Ende der Sendung hat mich aber noch fassungsloser gemacht. Thomas Gottschalk kann ja denken und reden, was er will. Was aber nicht geht: wenn sich so jemand an Millionen von Menschen richtet und es dabei nicht schafft, einen versöhnlichen Ton zu treffen. Denn statt mit Würde abzutreten, fällt ihm nichts anderes ein, als weiter eine Debatte um Cancel Culture anzuheizen und sich dabei ganz seltsam zum Opfer zu stilisieren.
Warum hat er diese besondere Gelegenheit nicht anders genutzt? Er hätte doch genauso gut Größe zeigen können, indem er sagt: Lasst uns mal wieder miteinander ins Gespräch kommen. Wir müssen ja nicht alle das Gleiche denken, aber wir können doch wieder anfangen, sachlich miteinander zu debattieren und uns auszutauschen. Dass er da aber so dagegen geht und die gesellschaftliche Spaltung noch mehr befördert, will mir einfach nicht in den Kopf. Und auch nicht, dass jemand, der seit Jahrzehnten eine Sendung zur besten Primetime mit Millionenpublikum moderiert, sich gleichzeitig über ein vermeintliches Rede- oder Meinungsverbot auslässt. Einfach unfassbar.

»Vielleicht reagieren viele Männer auch deshalb wie bissige Hunde, weil sie nicht bereit sind, eine gewisse Vorherrschaft aufzugeben und sich dem Offensichtlichen zu stellen.«
MYP Magazine:
Dass sich ältere Männer reflexartig in eine Opferrolle begeben, sobald ihnen Kritik entgegenschlägt, ist immer wieder zu beobachten – zuletzt etwa bei Hubert Aiwanger im Zuge der sogenannten Flugblattaffäre. Wie erklärst Du dir dieses Verhalten?
Sina Martens:
Ich kenne diese Menschen nicht persönlich, daher empfände ich es als anmaßend, für deren Verhalten eine Erklärung zu präsentieren. Ich kann nur sagen, wie es auf mich wirkt. Und bei Leuten wie Gottschalk und Aiwanger kommt mir das wie eine tiefe Kränkung vor. Im Fall von Gottschalk macht es zudem den Eindruck, dass er unfähig ist zu akzeptieren, dass eine jüngere Generation nachkommt, die die Dinge etwas anders sieht. Und dass Frauen keine Lust mehr haben, in diesen patriarchalen Strukturen zu leben und sich permanent mit überholten Rollenbildern zuschütten zu lassen.
Vielleicht reagieren viele Männer auch deshalb wie bissige Hunde, weil sie nicht bereit sind, eine gewisse Vorherrschaft aufzugeben und sich dem Offensichtlichen zu stellen. Denn wenn ich mich vor allem als weißer Cis-Mann ernsthaft mit dem Patriarchat auseinandersetzen will, werde ich sehr schnell begreifen, dass ich selbst ein Teil des Problems bin – und dass ich in den letzten Jahren, Jahrzehnten und Jahrhunderten allein deshalb die heftigsten Vorteile genossen habe, weil ich als Mann zur Welt gekommen bin. Wenn ich mich wirklich aufrichtig mit dem Thema beschäftige und zu dem Schluss komme, dass das alles ungerecht ist, werde ich feststellen, dass ich selbst deutliche Abstriche machen muss in meinem Leben. Denn nur dadurch kann ich das Leben für viele andere etwas besser und gerechter machen.

»Der Tonmann sagte mir, dass er es hören könne, wenn ich eine halbe Minute vor Dreh einer Szene sei – weil sich mein Herzschlag in dem Moment so heftig beschleunigt hat.«
MYP Magazine:
Ab dem 26. Januar bist Du im Film „Trunk – Locked In“ zu sehen. Dabei gibt es eine interessante Parallele zu Eurem Theaterstück: In beiden Fällen verkörperst Du in einer Solo-Rollo eine Frau, die Gewalt erfahren hat, dieser Gewalt über eine längere Zeit ausgesetzt ist und nun mit aller Kraft versucht, sich aus ihrem Gefängnis und einer scheinbar ausweglosen Situation zu befreien. Hattest Du ein Déjà-vue, als die Anfrage kam?
Sina Martens:
Ja, aber eher insofern, dass ich solche klaren Setzungen spannend finde. Und die Idee, einen Film nur in einem Kofferraum zu spielen, fand ich einfach unglaublich herausfordernd.
MYP Magazine:
Solche Filme mit starken Solo-Rollen gibt es verhältnismäßig selten. Man denkt zwar sofort and an „Cast Away“ mit Tom Hanks, „Der Marsianer“ mit Matt Damon, „Die Wand“ Martina Gedeck…
Sina Martens:
… oder „Buried“ mit Ryan Reynolds.
MYP Magazine:
Genau! Hier haben die Darsteller*innen aber immer sehr viel Raum zur Verfügung. In „Trunk“ spielst Du fast 90 Minuten lang im Liegen, und das in einem Kofferraum von knapp zwei Quadratmetern Fläche. Wie hast Du dich auf diese Rolle vorbereitet?
Sina Martens:
Ähnlich wie für „It’s Britney, Bitch!“: Einerseits musste ich körperlich fit sein, da ich in der Rolle sehr viel Kraft aufwenden musste. Andererseits habe ich auf viel mentales Training gesetzt, vor allem auf Meditation. Bei meiner Figur Malina ging es immer wieder darum, aus stressigen Situationen schnell in die Ruhe zu kommen und mich genauso schnell aus dieser Ruhe wieder hochzupushen. Das ist mir irgendwann so gut gelungen, dass mir der Tonmann sagte, dass er es hören könne, wenn ich eine halbe Minute vor Dreh einer Szene sei – weil sich mein Herzschlag in dem Moment so heftig beschleunigt hat.

»Uns war es wichtig, dass Malinas Stimmung am Ende kein Brei aus Todesangst wird.«
MYP Magazine:
Da der Film fast ausschließlich in einem Kofferraum spielt, muss er sich gehörig ins Zeug legen, um das Publikum 90 Minuten bei der Stange zu halten – ein besonderer Anspruch an Cast, Regie und Kamera. Wie habt Ihr euch dieser gemeinsamen Aufgabe genähert?
Sina Martens:
Regisseur Marc Schießer und mir war es wichtig, dass Malinas Stimmung am Ende kein Brei aus Todesangst wird, sondern die einzelnen emotionalen Stufen sichtbar werden, die sie durchlebt. Aus diesem Grund hatten wir vor den Dreharbeiten eine Art Psychogramm von ihr entwickelt und uns gefragt: In welchen Momenten ist sie hoffnungsvoll? Wo ist sie lethargisch? Wo wird sie wütend? Wo ist sie verzweifelt? Die Antworten darauf haben wir uns dann gemeinsam im Drehbuch erarbeitet und die entsprechenden Szenen an den jeweiligen Drehtagen auch ausführlich geprobt.

»Diese Sequenz war am Ende ein großes Ballett des ganzen Teams.«
MYP Magazine:
Und wie blickst Du auf die Zusammenarbeit mit Tobias Lohf und Daniel Ernst, die für die Kamera verantwortlich waren?
Sina Martens:
Die war genauso intensiv! Es gibt im Film zum Beispiel eine Sequenz, in der ich zehn Minuten am Stück im Kofferraum zu sehen bin und die Kamera immer wieder um mich herumfährt. Bei der Produktion standen uns drei oder vier verschiedene Kofferräume zur Verfügung, in dem wir die einzelnen Szenen gedreht haben. Einer war so präpariert, dass man jede Seite einzeln herausnehmen konnte, damit die Kamera von dort aus filmen konnte. Hat sich die Kamera aber bewegt, musste das Team nacheinander die einzelnen Seitenteile herausziehen oder zurückstecken – je nachdem, von wo und in welche Richtung gerade gefilmt wurde. Ich selbst musste dabei immer darauf achten, dass ich die Kamera, die ja permanent ihre Position verändert hat, nicht aus den Augen verliere. So war diese Sequenz am Ende ein großes Ballett des ganzen Teams.


»In existenziellen Notsituationen kommt man scheinbar an einen Punkt, an dem man einfach nur noch funktioniert und über sich hinauswächst.«
MYP Magazine:
Trotz ihrer entsetzlichen Situation gelingt es Malina, halbwegs ruhig, reflektiert und klar zu bleiben. War das emotionales Neuland für Dich? Oder konntest Du auf Erfahrungen aus eigenen Notsituationen zurückgreifen?
Sina Martens:
Nein, solche Extremsituationen gab es noch nicht in meinem Leben. Daher habe ich mich umso intensiver damit auseinandergesetzt, wie man einen so unbedingten Überlebenswillen entwickeln und schauspielerisch darstellen kann. Denn das will Malina ja am meisten: leben. Ich glaube, so ein Überlebenswille setzt in Menschen ungeahnte Kräfte frei. Es gibt die unglaublichsten Geschichten von Leuten, die irgendwie riesige Unglücke und Katastrophen überlebt haben. In existenziellen Notsituationen kommt man scheinbar an einen Punkt, an dem man einfach nur noch funktioniert und über sich hinauswächst. Über diesen Gedanken habe ich versucht, Malina möglichst nahezukommen.

»Es macht einfach etwas mit dem Körper und dem Geist, wenn man neun bis zehn Stunden pro Tag in so einem engen Kasten herumliegt.«
MYP Magazine:
In „Trunk“ geht es auch darum, dass sich ein sorgloses Leben innerhalb von Sekunden ändern kann und man plötzlich um sein Leben kämpfen muss. Gehst Du seit der Arbeit an dem Film anders durch den Alltag? Bist Du misstrauischer geworden?
Sina Martens:
Eigentlich nicht. Ich kann so etwas recht gut hinter mir lassen, das gehört schließlich zu meinem Beruf – auch wenn es bei diesem Film tatsächlich etwas länger gedauert hat. Immerhin habe ich während der Dreharbeiten sehr viel Zeit in diesem Kofferraum verbracht. Es macht einfach etwas mit dem Körper und dem Geist, wenn man neun bis zehn Stunden pro Tag in so einem engen Kasten herumliegt. Daher habe ich in den Wochen danach auch einige Osteopathie-Behandlungen gebraucht, um den einen oder anderen verkürzten Muskel wieder in die Länge zu ziehen. Außerdem habe ich bei Fahrstühlen gedacht, ich nehme lieber mal die Treppe – ich hätte jetzt absolut keine Lust, darin steckenzubleiben. (lacht)

»Für mich ist Gewalt im Film vor allem dann problematisch, wenn sie entweder inflationär stattfindet oder in einem eher unbedeutenden Nebenstrang erzählt wird.«
MYP Magazine:
Laut einer Studie kommt in rund einem Drittel der Sendungen, die in Deutschland ausgestrahlt werden, geschlechtsspezifische Gewalt vor. In den meisten Fällen handelt es sich dabei um explizite und schwere Gewalt gegen Frauen und Kinder – und nur in seltenen Fällen lässt man in den jeweiligen Sendungen die von Gewalt Betroffenen selbst zu Wort kommen. Wie ordnest Du euren Film in diesem Zusammenhang ein? Hattest Du im Vorfeld Sorge, mit Deinem Mitwirken an „Trunk“ diesen Umstand noch zu befördern?
Sina Martens: (überlegt kurz)
Für mich ist Gewalt im Film vor allem dann problematisch, wenn sie entweder inflationär stattfindet oder in einem eher unbedeutenden Nebenstrang erzählt wird – zum Beispiel, wenn irgendwo eine Frau entführt oder geschlagen wird und es am Ende doch nur um die männliche Hauptfigur geht. Daher hat mich übrigens auch Maria Schrader mit ihrem Film „She Said“ total beeindruckt. Sie verzichtet in ihrer Inszenierung komplett darauf, die Übergriffe zu zeigen, außerdem rückt die Kamera den Frauen nicht auf die Pelle. Das finde ich unglaublich interessant – und ist für mich eine ganz klare Setzung.
In unserem Film ist die Setzung genauso klar: Der Fokus liegt eindeutig auf einer starken Frauenfigur, die wir dabei verfolgen, auf engstem Raum zurechtzukommen und sich aktiv aus ihrem Gefängnis freizukämpfen. Das Drehbuch hat mich interessiert, weil sich hier eine starke Frau befreit; weil eine starke Frau hier Verantwortung übernimmt; weil diese starke Frau so viel mehr ist und macht als alle anderen in dem Film, die im Gegensatz zu ihr nicht in einem Kofferraum eingesperrt sind. Für mich ist das alles andere als eine Opfergeschichte. Es ist vielmehr die emanzipatorische Geschichte einer Frauenfigur, die sich gleich auf drei Ebenen befreien muss.
MYP Magazine:
Und welche Ebenen sind das?
Sina Martens: (grinst)
Das werde ich jetzt nicht spoilern! Wer das herausfinden will, muss sich den Film anschauen.

»Ich kann total verstehen, wenn eine Frau keine Lust mehr hat, Aufklärungsarbeit zu leisten.«
MYP Magazine:
Gewalt gegen Frauen ist – egal wo auf der Welt – in 99,9 Prozent der Fälle männliche Gewalt gegen Frauen. Und das wird sich nicht ändern, wenn sich nicht auf Seite der Männer etwas fundamental ändert. Die Autorin und Aktivistin Kristina Lunz sagte vor einigen Wochen in einer Gesprächsrunde zum Internationalen Tag zur Beseitigung der Gewalt gegen Frauen, sie habe den Versuch aufgegeben, irgendwelche Männer zu überzeugen. Bist Du an einem ähnlichen Punkt angelangt? Oder gibt es eine Botschaft, die Du diesbezüglich an Männer hast?
Sina Martens:
Ich kann total verstehen, wenn eine Frau keine Lust mehr hat, Aufklärungsarbeit zu leisten. Ich selbst bin aber noch nicht an diesem Punkt. Ich habe noch nicht aufgegeben, Männern unsere Perspektive zu erklären, und gehe immer wieder gerne in Diskussionen, in denen ich sage: Stopp mal! Aber habe ich eine konkrete Botschaft, die ich Männern mitgeben möchte? (überlegt einen Moment)
Ich würde Männer ermutigen, uns Fragen zu stellen: Fragt uns, wie sich etwas anfühlt oder wie etwas ist!


»Mit der Schauspielerei habe ich tatsächlich mehr gefunden als das, wonach ich nach dem Abi gesucht hatte.«
MYP Magazine:
Du wolltest nach dem Abitur eigentlich Psychologie studieren, bist dann aber Schauspielerin geworden. Ist die Aufgabe am Ende nicht eh dieselbe? Menschen in ihrem Innersten zu verstehen und zu versuchen, ihnen mit dem eigenen Wirken zu helfen?
Sina Martens:
Mit der Schauspielerei habe ich tatsächlich mehr gefunden als das, wonach ich nach dem Abi gesucht hatte, denn in meinem Beruf gibt es ja noch diesen schönen Zusatz der Kunst. Ich habe hier nicht nur die Möglichkeit, Figuren zu verstehen – oder besser gesagt: mich auf die Suche danach zu machen, sie verstehen zu wollen. Sondern auch, einen künstlerischen Umgang mit dieser Suche zu finden und im besten Fall andere Menschen damit zu erreichen, zu berühren und sie zum Nachdenken zu bringen.

»Das Berliner Ensemble ist ein Ort, an dem schon viel gedacht, versucht und gescheitert wurde.«
MYP Magazine:
Seit mittlerweile sechs Jahren bist Du ein Teil des Berliner Ensemble. Was bedeutet Dir dieser Ort hier?
Sina Martens: (lacht)
Dieser Ort hier? Da muss ich an einen Satz von Wolfram Lotz denken, einem deutschen Dramatiker: „Das Theater ist ein Ort.“
Für mich persönlich ist Theater ein sehr wichtiger Ort – und das Berliner Ensemble ist unter all den Theatern ein ganz besonders wichtiger Ort für mich. Ich würde ihn zwar nicht als mein Zuhause bezeichnen, das Wort wäre mir an der Stelle zu groß, aber dennoch hat mich dieses Haus ungemein geprägt. Ich durfte hier nicht nur sehr viel lernen, sondern habe hier auch etliche Menschen getroffen, die heute einen wichtigen Teil meines Lebens ausmachen.
Und zu all dem kommt ja noch das kleine Detail, dass das hier das Brecht-Theater ist – also ein Ort, an dem schon viel gedacht, versucht und gescheitert wurde; und an dem man in so einer Art Tradition steht, fleißig weiter zu denken, weiter zu versuchen und weiter zu scheitern.

»Ich möchte mit großer Hoffnung leben, auch wenn es oft Momente gibt, in denen ich denke, dass der Mensch hoffnungslos verloren ist.«
MYP Magazine:
Ich komme zum Schluss noch mal auf „It’s Britney, Bitch!“ zurück. An einer Stelle zitiert Ihr den Refrain des Lieds „Der letzte Song“ von Felix Kummer und Fred Rabe, der sich zwischen Hoffnung und Resignation bewegt:
Alles wird gut / Die Menschen sind schlecht und die Welt ist am Arsch
Aber alles wird gut / Das System ist defekt, die Gesellschaft versagt
Aber alles wird gut / Dein Leben liegt in Scherben und das Haus steht in Flammen
Aber alles wird gut / Fühlt sich nicht danach an, aber alles wird gut
Wie blickst Du selbst auf die Zukunft. Bist Du eher resignativ oder hoffnungsvoll?
Sina Martens:
In mir steckt definitiv mehr Hoffnung als Resignation, auch weil Hoffnung für mich ein Antrieb ist. Natürlich habe auch ich große Sorgen, wenn ich an die Zukunft unserer Gesellschaft und unserer Welt denke. Aber in Resignation zu versinken ist nicht die Art, wie ich leben möchte. Ich möchte mit großer Hoffnung leben, auch wenn es oft Momente gibt, in denen ich denke, dass der Mensch hoffnungslos verloren ist. Das ändert aber nichts daran, dass ich weiter an bestimmte Werte glaube. Ich glaube an die Liebe, ich glaube an die Freundschaft, ich glaube an den Dialog, ich glaube an die Verantwortung. Was kann mir mehr Hoffnung geben?

»It’s Britney, Bitch!« ist aktuell zu sehen im Berliner Ensemble.
»Trunk – Locked In« startet am 26. Januar auf Amazon Prime Video.
Mehr über Sina Martens:
Interview und Text: Jonas Meyer
Fotografie: Steven Lüdtke
Milos Miskovic
Interview — Milos Miskovic
»Es ist keine langfristige Lösung, seine Gefühle zu verstecken«
Er gilt als der Udo Walz von Budapest: Milos Miskovic wuchs als schwuler Junge in Serbien auf, überlebte den Balkankrieg und avancierte in Ungarn zu einem berühmten Damenfriseur. Eine beeindruckende Biografie aus einer Generation, die bei uns in Westeuropa gleich mehrfach um Sichtbarkeit ringt.
8. Januar 2024 — Interview & Text: Katharina Viktoria Weiß, Fotografie: David Ajkai


Mitte der Achtziger im serbischen Dorf Ostojićevo. Wenige Tage vor einem Handballturnier wird Teenager Milos Miskovic von seinem Trainer aufgefordert, sich einen anständigen Haarschnitt zuzulegen. Also schaut er im einzigen Friseurladen der kleinen Gemeinde vorbei und verhandelt: Wenn er Friseurmeisterin Éva bei der Arbeit zur Hand geht, erhält er einen Last-Minute-Termin für sein wildes Haupthaar.
Als Milos aus nächster Nähe erlebt, wie Éva ihre Kund*innen verwandelt, findet er prompt seine Berufung – und verärgert ebenso prompt seine Eltern. Denn die sind ganz und gar nicht erfreut, dass der Filius plötzlich Damenfriseur werden will. Und nicht Anwalt, wie ursprünglich geplant und erhofft. Denn in einem serbischen Dorf wie Ostojićevo gilt es für einen Mann damals als peinlich, diesen Beruf auszuüben. Doch Milos setzt sich durch und eröffnet 1989, da ist er gerade mal 17 Jahre alt, seinen ersten Salon im Erdgeschoss des Elternhauses.
Heute, gut drei Dekaden später, lebt er in Ungarn und ist einer der bekanntesten Hair-Stylisten des Landes. Manche seiner Kundinnen fliegen sogar aus ganz Europa ein, einige kommen von noch weiter. Sein exklusives Studio, das den Namen „MMhair“ trägt, liegt im Zentrum Budapests und ist nur wenige Gehminuten von der berühmten St.-Stephans-Basilika entfernt. Eine edle Adresse. Dennoch ist Milos Miskovic in all den Jahren ein bodenständiger Handwerker der Schönheit geblieben: ein kerniger Typ, dessen Gestik wie eine einzige Umarmung an die Welt anmutet.
Seine große Empathie ist dabei auch ein Resultat seiner ganz eigenen Geschichte, die er in seiner kürzlich erschienenen Biografie niedergeschrieben hat. „Fear of myself“ erzählt von einem jungen, schwulen Mann in Jugoslawien und im späteren Serbien, der im politischen Chaos der neunziger Jahre in eine ungewöhnliche Karriere stürzt. Eine Karriere, die ihm hilft, der großen Einsamkeit zu entkommen, die mit dem Anderssein einhergeht.
In dem Buch erzählt Milos auch, wie der Umgang mit dem Tod seines Vaters und die Krankheit seiner Mutter ihren Tribut forderten. Aber er beschreibt auch, wie er bei einem Urlaub in Spanien seine erste Begegnung mit der Liebe machte: Es ist nur eine flüchtige Romanze, die ihm aber die Tür zu einer Welt öffnet, von der er wusste, dass er zu ihr gehört – obwohl er sie nie zuvor betreten hatte.
Milos, der heute mit seinem langjährigen Partner Simon zusammenlebt, schafft mit seinem Buch ein wichtiges Dokument queeren Lebens in Mittel- und Osteuropa und zeichnet darin Lebenswege einer LGBTQIA*-Generation nach, die bisher kaum sichtbar war. Eine Generation, die schon wieder in großer Sorge lebt angesichts des politischen Rechtsrucks vieler europäischer Staaten – und die, uns alle mahnend, den Zeigefinger hebt.

»Wenn jemand mit einem bestimmten Stil auftrat, fiel er sofort auf.«
MYP Magazine:
Nimm uns mit auf eine Zeitreise: Wie fühlte sich in Deiner Jugend das Leben in Jugoslawien an – einem Staat, den es heute nicht mehr gibt?
Milos Miskovic:
Die Region Vojvodina, in der ich aufgewachsen bin, lag damals im landwirtschaftlichen Teil Jugoslawiens, nahe der ungarischen und rumänischen Grenze. Die Bevölkerung war multikulturell: Serben, Ungarn, Tschechen, Polen und andere. Fast jede Familie besaß ein Stück Land. Fast alle Häuser hatten das gleiche Format – mit einem kleinen Garten neben dem Haus und dahinter ein oder zwei größere Flächen, um Hühner und andere Kleintiere zu halten, sowie einen Gemüsegarten. Jede Familie besaß Obstbäume: Pflaumen, Aprikosen, Äpfel und Birnen. Nut etwa 30 Prozent der Frauen arbeiteten, meistens in Fabriken, die anderen waren Hausfrauen. Modische Kleidung war keine Priorität. Wenn jemand mit einem bestimmten Stil auftrat, fiel er sofort auf. Nur einige hochgebildete Leute sowie ein paar Teenager tanzten modisch aus der Reihe.


»Gleichheit und Brüderlichkeit waren das Motto in Jugoslawien – dennoch waren wir nicht gleichgestellt.«
MYP Magazine:
Welche Erinnerungen hast Du allgemein an die späten Achtziger im heutigen Serbien?
Milos Miskovic:
Die achtziger Jahre waren echt schön. Jugoslawien war zu dieser Zeit ein reiches Land. Die Menschen hatten normale Gehälter und konnten von dem, was sie verdienten, etwas sparen. Auf dem Land produzierten wir alles zu Hause, so dass unsere Gemeinde ein schönes Leben und genug Geld für einen komfortablen Lebensstil hatten. Gleichheit und Brüderlichkeit waren das Motto in Jugoslawien – dennoch waren wir nicht gleichgestellt mit anderen Familien, denen es besser ging. Und so wurde mir klar, dass ich mich anstrengen muss, um etwas aus meinem Leben zu machen. In der Schule hatte ich manchmal Probleme, weil es in meiner Familie orthodoxe Priester gab. Andererseits: Das Bildungssystem war sehr gut und bot viele Möglichkeiten für kluge Kinder, unabhängig von ihrem familiären Hintergrund.
MYP Magazine:
„Ich hoffe, dass er aus diesem Wahnsinn herauswächst“, zitierst Du deinen Vater und seine Sicht auf Deinen Berufswunsch. War das eher seine persönliche Meinung? Oder spiegelt der Satz eher die generelle kulturelle Sichtweise auf Männlichkeit zu dieser Zeit wider?
Milos Miskovic:
Ich denke, das war beides gleichermaßen. Ich war ein ungewöhnliches Kind: sehr kultiviert, sensibel, aber auch schlau. Mein Vater sagte mir, dass ich meine guten Noten im Gymnasium beibehalten müsse, sonst würde er mir nicht erlauben, in einem Haarstudio zu lernen. Meine Noten waren immer sehr gut, also konnte er sich nicht beschweren.

»Mein Highlight war es zu versuchen, bis zum nächsten Tag zu überleben.«
MYP Magazine:
Bereits 1989 hast Du deinen ersten Salon eröffnen – das hatte auch mit einer Inflation von unglaublichen 2.700 Prozent zu tun. Was ist da passiert?
Milos Miskovic:
Zu dieser Zeit dachte niemand daran, dass es in Jugoslawien eine Hyperinflation geben würde. Für mich war das ein echtes Glück, denn ich nahm davor einen Kredit bei der Bank in Dinar auf – und als die Hyperinflation einsetzte, wurde die monatliche Rate zu einem Witz. So konnte ich den Kredit ganz einfach zurückzahlen.
MYP Magazine:
In den folgenden Jahren hast Du unter anderem in einem renommierten Spa in Belgrad gearbeitet und bist gelegentlich nach London oder nach Paris gefahren, zum ersten Mal im Jahr 1997. Dennoch schreibst Du in Deinem Buch: „Nach meinem Arbeitstag ging ich zurück in meinen goldenen Käfig. Allein, um mich auszuruhen und Energie und Kraft für einen neuen Tag zu sammeln.“ Du warst damals ein junger Mann. Wie war das mit dem Ausgehen und Daten in dieser Phase Deines Lebens?
Milos Miskovic:
Ich habe zu jener Zeit auch eine Weile im Friseursalon eines Rehabilitations-Zentrums in Kanjiza gearbeitet, in der Nähe meiner Heimatstadt. Ich konnte nicht daten, weil ich wusste, dass ich schwul bin. Und wenn man mich in einer Stadt oder sogar weiter weg mit einem Mann gesehen hätte, hätten es alle herausgefunden. Also ging ich nach der Arbeit nach Hause. Mein Highlight war es, ein schönes Abendessen zu kochen und zu versuchen, bis zum nächsten Tag zu überleben. In dieser Zeit fühlte ich mich nur im Studio gut aufgehoben.


»Wir wussten nicht, wo die Bomben als nächstes fallen.«
MYP Magazine:
1999 begann die Bombardierung Deiner Heimat. Wie erinnerst Du dich an den Krieg?
Milos Miskovic:
Ich hätte nie gedacht, dass unser Land bombardiert werden würde. Für mich war das irgendwie absurd: Das ganze Volk sollte wegen der Entscheidung der Regierung bestraft werden. Zu diesem Zeitpunkt war das Land bereits von Milošević übernommen worden und die Bevölkerung hatte so gut wie keine Kontrolle über das, was die Regierung tat. Es war eine schreckliche Zeit. Wir alle hatten Angst, denn wir wussten nicht, was morgen passieren wird – und wo die Bomben als nächstes fallen.
MYP Magazine:
Wenn du heute über Kriege in der Ukraine oder im Nahen Osten liest: Hast Du einen besonderen Bezug zu den Betroffenen?
Milos Miskovic:
Wenn ich heute etwas über einen Krieg lese, tun mir die Opfer wirklich leid. Die Menschen, die keinen Krieg erlebt haben, können nicht verstehen, was für ein Druck das ist – und was für eine furchtbare Erfahrung. Sie können es sich einfach nicht vorstellen.

»Er brauchte seine Freiheit – aber ich brauchte jemanden wie ihn, der mich in das schwule Leben einführte.«
MYP Magazine:
„In dem Moment, in dem ich den Garten betrat, sah ich einen atemberaubend schönen jungen Mann an einem Pool liegen. Ein Blick auf seinen perfekten Körper ließ meinen Magen verkrampfen. Ich schaute schnell weg.“ Im Jahr 2000 hast Du auf Ibiza einen besonderen Mann kennen gelernt. Er hat Dir die Frage gestellt: „Bist du schwul?“ War das das erste Mal in Deinem Leben, dass Dich jemand nach Deiner Sexualität hat?
Milos Miskovic:
Ja, das allererste Mal. Ich war schockiert, dass er den Mut hatte, mich so etwas zu fragen. Gleichzeitig war ich auch von seiner enormen Schönheit schockiert – eine doppelte Verwirrung.
MYP Magazine:
Wie hast Du reagiert?
Milos Miskovic:
Ich habe erkannt, dass er tief im schwulen Lifestyle steckte. Außerdem war er in einer Lebensphase, in der er sich fragte: „Wo will ich hin und was will ich vom Leben?“ Und ich war da, um ihm zuzuhören. Ich hatte damals keine Ahnung von schwulen Communitys. Er leitete mich und versuchte, mich über alles aufzuklären, worauf ich achten musste. Wir beide waren zwei starke Menschen, die sich zur richtigen Zeit gefunden hatten. Dennoch wusste ich früh, dass er nicht in der Lage war, einer Person gegenüber loyal zu sein. Er brauchte seine Freiheit – aber ich brauchte jemanden wie ihn, der mich in das schwule Leben einführte.

»Wenn man seinen Beruf ernst nimmt, kann man nicht jeden Monat den Partner wechseln, das ist nicht seriös.«
MYP Magazine:
Dein Coming-out-Prozess hat sich über mehrere Jahre hingezogen. Wie hat Budapest Dein Leben als schwuler Mann verändert?
Milos Miskovic:
Das Beste war, dass ich dort frei war. Dennoch wurde mir schnell klar, dass die jungen Männer in Budapest keine ernsthafte Beziehung wollen und eher auf Sex aus sind – aber ich wollte unbedingt etwas Festes. Es war nicht leicht, jemanden zu finden, der es ernst meint mit mir; jemanden, der mich versteht und mit dem ich mein Leben gestalten will. Ich fing an zu erkennen, welche Art von Person die richtige für mich ist, und habe mich auf die Suche nach einem Partner gemacht…
MYP Magazine:
… und hast schließlich das Glück gefunden. Mit Deinem Partner Simon bist Du seit mittlerweile 17 Jahren liiert. Wie hat die ungarische Gesellschaft in den fast zwei Jahrzehnten auf Eure öffentlichen Auftritte reagiert?
Milos Miskovic:
Für mich ist es sehr wichtig, dass ich eine stabile Beziehung habe. Wenn man seinen Beruf ernst nimmt, kann man nicht jeden Monat den Partner wechseln, das ist nicht seriös. Die Gesellschaft in Serbien und auch in Ungarn betrachtet uns als normales, erfolgreiches Paar, das sich liebt. Als wir in Serbien das erste Mal zusammen gesehen wurden, wurden dort garantiert ein paar Augenbrauen hochgezogen. Aber da ich schon damals recht berühmt war und einige Leute meine Sexualität sicherlich schon länger in Frage gestellt hatten, war es keine große Überraschung, als ich eines Tages mit einem Mann aufgetaucht bin. Und dass wir von Menschen mit einer gewissen gesellschaftlichen Bedeutung akzeptiert wurden, die uns als Paar zu Partys und Hochzeiten einluden, hat uns ebenfalls den Weg geebnet.


»Es ist sehr besorgniserregend, welche repressiven Maßnahmen aktuell in Ungarn gegen die Queer- und Transgender-Community ergriffen werden.«
MYP Magazine:
Heute ist das queere Leben in Ungarn wieder bedroht: Was beunruhigt Dich, wenn Du auf die junge Generation blickst?
Milos Miskovic:
Man muss verstehen, dass Budapest mehr oder weniger eine Bubble ist und man das schwule Leben hier nicht mit dem im Rest des Landes vergleichen kann. Gleichzeitig ist es sehr besorgniserregend, welche repressiven Maßnahmen aktuell in Ungarn gegen die Queer- und Transgender-Community ergriffen werden – Maßnahmen, von denen wir alle wissen, dass sie aus rein politischen Gründen erfolgen. Das ist absolut nicht gut für das Selbstwertgefühl sowie das Selbstvertrauen junger queerer Menschen.

»Mein Leben wäre weniger einsam gewesen, wenn ich in der Lage gewesen wäre, mit einigen ausgewählten Vertrauten etwas offener zu sein.«
MYP Magazine:
Vor allem älteren Queers wird immer wieder folgende Frage gestellt: „Was würdest du deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben, wenn du es heute treffen würdest?“ Was würdest Du deinem sagen?
Milos Miskovic:
Meinem jüngeren Ich würde ich raten, Gruppen und Orte aufzusuchen, an denen sich aufgeschlossenere Menschen versammeln – einfach, um ein soziales Sicherheitsnetz um sich herum aufzubauen. Außerdem würde ich ihm sagen, dass es keine langfristige Lösung ist, seine Gefühle zu verstecken und zu unterdrücken. Die Rechnung kommt immer am Ende. Und ich würde meinem jüngeren Ich empfehlen, vor allem seinen engsten Freunden mehr zu vertrauen und mit ihnen offen über seine Gefühle zu sprechen. So sehr wir alle versuchen, unsere wahre Natur zu verbergen, am Ende kommt sie doch zum Vorschein.
Das Interessante dabei ist, dass es den meisten intelligenten und emotional entwickelten Menschen egal ist, wer wie fühlt und wer wen liebt. Ich selbst durfte das leider erst relativ spät lernen. Ich bin ziemlich sicher: Mein Leben wäre einfacher und weniger einsam gewesen, wenn ich in der Lage gewesen wäre, mit einigen ausgewählten Vertrauten etwas offener zu sein.

Mehr von und über Milos Miskovic:
Interview & Text: Katharina Viktoria Weiß
Fotografie: David Ajkai
Romain Berger
Fotoserie — Romain Berger
Für Frankreich zu vulgär
Mit seinen Bildern feiert der queere Fotograf Romain Berger seit Jahren ein rauschendes Fest der Farben, Körper und Begierden: eine Freizügigkeit, die immer wieder mal mit den Moralvorstellungen von Instagram & Co. kollidiert – und die ihm auch in der analogen Welt das Leben schwer macht, zumindest in seiner Heimat. Denn den meisten französischen Galerien sind seine Arbeiten zu vulgär. »Une opportunité ratée«, wie wir finden – eine verpasste Chance.
21. Dezember 2023 — Fotografie: Romain Berger, Text: Jonas Meyer

»Dass Künstler*innen wie ich auf Instagram gesperrt werden, ist für mich schon lange nichts Neues mehr.«
„Dass Künstler*innen wie ich auf Instagram gesperrt oder einzelne Inhalte gelöscht werden, ist für mich schon lange nichts Neues mehr“, erzählt Romain Berger, als er sich nach knapp drei Jahren wieder mit einer Fotostrecke an uns wendet. Der queere Fotograf aus Rennes, der Ende der Achtziger im ländlich-konservativen Nordwesten Frankreichs geboren wurde und auch dort aufgewachsen ist – ganz ähnlich übrigens wie der berühmte Schriftsteller Édouard Louis („Das Ende von Eddy“) – beschrieb bereits im März 2021 im Rahmen einer Veröffentlichung einiger seiner Arbeiten in unserem Magazin, mit welchen seltsamen Moralvorstellungen er es immer wieder auf Social-Media-Plattformen zu tun hat.


Damals schrieben wir: Die Community-Politik von Facebook ist etwas, über das sich leidenschaftlich streiten lässt. Während auf den einzelnen Plattformen des US-Konzerns immer noch Autokraten und ihre radikalisierte Gefolgschaft fast ungehemmt ihre menschenfeindlichen Botschaften in alle Welt verbreiten dürfen, während Verunglimpfungen und Shitstorms wie die Axt im Walde wüten, während Falschnachrichten mehr schlecht als recht bekämpft und demokratische Systeme sukzessiv unterwandert werden, tut sich an ganz anderer Stelle ein bizarres Verständnis von Moral auf: bei der Abbildung des menschlichen Körpers.

»Wenn sexuell aufgeladener Content aus der heteronormativen Ecke kommt, scheint Instagram damit viel weniger ein Problem zu haben.«
Zum Verhängnis wurde Romain damals (wie heute) immer wieder die Darstellung von zu viel Schambehaarung in seinen Bildern. Man könnte laut loslachen, wenn es nicht so traurig und absurd wäre.
Die kürzlich aktualisierten Nutzungsbedingungen des Meta-Konzerns hätten die Situation für ihn dabei nur noch verschärft, erzählt der 35-Jährige: „Für queere Künstler*innen wie mich wird es auf Instagram immer schwieriger, unsere Inhalte sichtbar zu machen und dafür Reichweite zu generieren. Wenn sexuell aufgeladener Content dagegen aus der heteronormativen Ecke kommt, scheint die Plattform damit viel weniger ein Problem zu haben.“
Immer wieder müsse er erleben, wie er dem sogenannten shadow banning zum Opfer falle: dem Sperren von spezifischen Inhalten, über das die betroffenen User*innen aber nicht informiert werden. Stattdessen verhindert das soziale Netzwerk einfach, dass andere User*innen die Inhalte zu sehen bekommen.

»Die französischen Galerien erachten meine Arbeiten als zu vulgär für eine Ausstellung.«
Doch mit dieser Quasi-Zensur hat Romain nicht nur in der digitalen Welt zu kämpfen, sondern auch in der analogen – vor allem in seiner Heimat.
„Während es im Ausland verhältnismäßig leicht ist, Galerien für meine Bilder zu finden, ist das hier in Frankreich immer noch ein großes Problem“, schildert er seine Situation. „Die französischen Galerien erachten meine Arbeiten als zu vulgär für eine Ausstellung. Die einzige Galerie, die sich dazu mal mit viel Optimismus bereiterklärt hatte, musste am Ende resigniert feststellen, dass auch ihr es nicht möglich war, die Köpfe und Herzen der Menschen zu öffnen.“
Chez nous, tu seras toujours accueilli à bras ouverts, cher Romain!









Fotografie: Romain Berger
Text: Jonas Meyer
Christian Ruess
Interview — Christian Ruess
»Ich akzeptiere den Status quo nicht«
Mit seiner Plattform »Container Love« kämpft Christian Ruess seit 2013 für mehr Akzeptanz und Sichtbarkeit queeren Lebens. Zum zehnjährigen Jubiläum treffen wir den Creative Director in seinem Berliner Studio. Ein Gespräch über Pinkwashing, Selbstfürsorge und schwierige Millennials; über die Popkultur der DDR und queere Menschen in Uganda; und über eine rührende Geschichte von einer Hamburger Mami und dem Nagellack ihres Sohnes.
10. November 2023 — Interview & Text: Jonas Meyer, Fotografie: Sven Serkis (Portraits) & Milena Zara (Event)

Tausendvierhundertzweiundzwanzig. So viele Straftaten zählt der Kriminalpolizeiliche Meldedienst in Deutschland für das Jahr 2022, wenn es um Hassdelikte im Zusammenhang mit den Themenfeldern „Sexuelle Orientierung“ und „Geschlechtsbezogene Diversität“ geht.
1.422 Gewalttaten, Beleidigungen, Volksverhetzungen und andere Abscheulichkeiten gegenüber Personen, die sich als lesbisch, schwul, bisexuell, trans*, inter* und/oder queer bezeichnen. 1.422 Menschen, die im letzten Jahr allein deshalb angegriffen wurden, weil sie irgendwie von einer vermeintlichen Norm abweichen.
Dabei gehen Expert*innen davon aus, dass etwa 90 Prozent der Vorfälle in Deutschland nicht gemeldet werden.
Die Situation ist auch deshalb alarmierend, weil sich die Zahlen der erfassten Straftaten seit 2018 um fast 200 Prozent erhöht haben. Allein in Berlin erreichte die Menge queerfeindlicher Fälle bereits Ende August 2023 das Niveau des Vorjahres.
Was also tun?

Leider gibt es nicht die eine große Antwort oder die eine große Strategie, um das Leben queerer Menschen erträglicher zu machen und sie vor Hass zu schützen, weder in Deutschland noch anderswo.
Umso wichtiger ist es, dass man sich für queere Menschen engagiert. So wie Christian Ruess. Der Berliner Creative Director hat es sich mit seiner Plattform „Container Love“ zur Aufgabe gemacht, queeres Leben sichtbarer zu machen – in all seinen Facetten, mit all seinen Themen und auch mit all seinen Widersprüchen. Und das seit vielen Jahren.
„Wissen bedeutet weniger Angst – und keine Angst bedeutet Freiheit“, sagt Christian auf der Website von „Container Love“. Dieses Wissen vermitteln er und sein Team dort mit Hilfe sorgfältig kuratierter Arbeiten, darunter Fotostrecken, Filme, Texte und andere Werke spannender Künstler*innen: ein digitaler safe space für queere Kultur.
Eines der aktuellen Highlights zum Beispiel ist der Kurzfilm „The Hidden Dimension“, ein Portrait des queeren polnischen Fotografen Leo Maki. Der gut vierminütige Streifen, den Christian im letzten Jahr mit seiner Crew produziert hatte, erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter etwa den „Silver Screen“ beim „Young Director Award 2023“ in Cannes.
Doch „Container Love“ findet nicht nur im digitalen Raum statt, sondern einmal im Jahr auch im analogen – wie zum Beispiel im August am Berliner Kurfürstendamm. Unter dem Titel „Visible Love“ waren dort diverse Foto- und Videoarbeiten zu bewundern, die queeres Leben in all seiner Schönheit und Vielfalt zeigen. Daneben gab es Liveshows, Podiumsdiskussionen und Artist Talks – kostenlos und zugänglich für alle. Diese Chance ergriffen am Ende über 2.500 Besucher*innen.
Bei dieser Gelegenheit wurde auch das zehnjährige Bestehen der „Container Love“ gefeiert: Im Sommer 2013 hatte Christian seine erste Fotoausstellung auf dem „MS Dockville“ in Hamburg – das beliebte Kunst- und Musikfestival hatte er zehn Jahre lang mitgestaltet. Als Ausstellungsraum diente damals, man ahnt es, ein alter Schiffscontainer.
Neben seiner karitativen Tätigkeit berät Christian seit vielen Jahren große Marken und hilft ihnen dabei, in ihrer Kommunikation diverser zu werden – und auch damit mehr Sichtbarkeit queeren Lebens in der Öffentlichkeit herzustellen. Dabei zieht es ihn persönlich eher in die zweite Reihe statt ins Rampenlicht, wie er uns vor dem Interview verrät.
Bei Kaffee und Donuts treffen wir ihn in seinem gemütlichen Studio in der Neuköllner Hobrechtstraße.

»Wir öffnen unsere Tür für alle. Ob man durch sie hindurchgehen will oder nicht, muss man ganz allein entscheiden.«
MYP Magazine:
Die „Visible Love 2023“ liegt bereits einige Wochen zurück. Wie blickst Du mit etwas Abstand auf die Ausstellung?
Christian Ruess:
Bei unseren Veranstaltungen treffen sich immer viele interessante Leute, die Lust haben, etwas zu bewegen und zu verändern. Das war auch diesmal so. Aus diesem Grund bin ich nach wie vor unendlich dankbar für das, was dort stattgefunden hat. Das gibt mir das Gefühl, dass wir mit unserer Arbeit etwas Richtiges tun. Und dass es wichtig ist, dass wir da sind.
Da die „Visible Love“ diesmal am Ku’damm stattfand – also einem Ort, der touristisch etwas überladen ist – haben sich auch immer wieder Leute in unsere Ausstellung verirrt, die nach 30 Sekunden wieder draußen waren. Ohne ein Hallo, ohne ein Tschüss. Dabei würde ich mir wünschen, dass gerade diese Menschen viel neugieriger und offener sind für die Geschichten, die wir präsentieren. Aber ihre Reaktionen zeigen mir, dass es noch viel zu tun gibt, wenn es um die Sichtbarkeit und Akzeptanz queeren Lebens geht. Gleichzeitig möchte ich aber niemanden zwingen. Wir öffnen unsere Tür für alle. Ob man durch sie hindurchgehen will oder nicht, muss man ganz allein entscheiden.

»Wenn euer Sohn das Gefühl hat, sich mit Nagellack äußern zu wollen, dann ist das toll. Damit könnt ihr arbeiten.«
MYP Magazine:
Welche Reaktionen von Besucher*innen sind Dir in besonderer Erinnerung geblieben?
Christian Ruess: (überlegt)
Es gibt aus den letzten Jahren zwei Geschichten, die ich gerne erzählen möchte. Die erste geht so: Bei unserer letzten großen Ausstellung vor Corona – das war während des Reeperbahn-Festivals in Hamburg – kam eines Nachmittags eine dreiköpfige Familie herein und schaute sich die vielen Bilder an, die wie immer sehr viel zu zeigen hatten. Da gab es keinen Raum für Interpretation. Wir stehen auf dem Standpunkt: Die Vielfalt ist nun mal da, queer heißt viel, also schaut gefälligst hin!
Diese Familie jedenfalls schaute sich erst die Bilder und dann mich völlig ratlos an. Plötzlich erzählte mir die Mutter etwas besorgt von ihrem Sohn, der gerade 14 geworden war und angefangen hate, sich die Nägel zu lackieren. Ich versuchte, ihr die Angst zu nehmen, dass irgendetwas mit dem Sohn nicht stimmen könnte, und sagte: Schaut euch doch um, das alles hier ist wunderschön! Und wenn euer Sohn das Gefühl hat, sich mit Nagellack äußern zu wollen, dann ist das toll. Damit könnt ihr arbeiten, das ist ein Zeichen, geht damit um!
Das Lustige war: Normalerweise trage ich selbst auf all meinen Veranstaltungen Nagellack, nur diesmal hatte ich es vor lauter Stress vergessen. Zwei Stunden nach unserem Gespräch kam die Mutter zurück und brachte mir den Nagellack ihres Sohnes. Zu Hause hatte sie ihm von uns erzählt, er kannte „Container Love“ bereits und sagte zu seiner Mami: „Schenk dem Typen mal meinen Nagellack.“ Das hat mich an dem Abend zu Tränen gerührt.
MYP Magazine:
Und die zweite Geschichte?
Christian Ruess:
Bei unserer diesjährigen „Visible Love“ im Pop Ku’damm gab es eine ähnliche Situation. In unsere Ausstellung schlich eine bayerische Familie, bei der man auf den ersten Blick erkennen konnte, wer sie an diesen Ort gelockt hatte: der Sohn. Nachdem alle schweigend durch den Raum gelaufen waren, warf mir der Sohn beim Gehen ein Lächeln zu. Ich dachte mir nur: Du musst nichts sagen, wir haben es alle verstanden. Und mir war klar: Für solche Momente mache ich das alles.

»Queere Menschen haben unendlich viel zu erzählen.«
MYP Magazine:
Wissen die Menschen, die auf den Fotos zu sehen sind, um ihre Mut machende Wirkung? Ist ihnen bewusst, dass sie nicht nur Models, sondern vor allem role models sind?
Christian Ruess:
Ja, weil unser gesamtes Magazin so konzipiert ist. Ich wollte immer ein Format schaffen, das einerseits queeren Lifestyle zeigt und sich andererseits auch tatsächlich mit den Menschen dahinter auseinandersetzt. Die meisten Hochglanzmagazine, die man seit 100 Jahren auf der Couch liegen hat, können und wollen das gar nicht leisten. Dabei haben queere Menschen unendlich viel zu erzählen, jede*r von uns hat eine Geschichte. Und diesen Geschichten wollte ich eine Plattform geben – eine, die auch außerhalb des pride month, außerhalb queerer Kampagnen und außerhalb der bekannten Social-Media-Kanäle funktioniert. Eine Plattform in Form eines Magazins, die leicht ist, Spaß macht und dabei trotzdem Themen wie Diversität oder body positivity behandelt. Und die trotzdem nicht mit dem erhobenen Zeigefinger durch die Gegend läuft.

»Ich bin kein großer Fan davon, immer alles gleich zu labeln.«
MYP Magazine:
Die „Visible Love 2023“ war in einem luftigen, modernen Gebäude beheimatet, das so wirkte, als hätte es sich zwischen zwei alte Betonklötze geschoben und dort seinen Platz beansprucht – ein schönes Symbolbild, das man auch auf die queere Community übertragen könnte. Muss man sich manchmal mit Nachdruck irgendwo dazwischen quetschen, um ein Teil des etablierten Straßenbilds zu werden?
Christian Ruess:
Ja, allerdings gilt das nicht nur für die queere Community, sondern für alle Menschen, die in irgendeiner Form marginalisiert werden. Und da ich kein großer Fan davon bin, immer alles gleich zu labeln, daher sage ich es etwas allgemeiner: Wenn man ein Anliegen hat, ist es wichtig, sich Gehör zu verschaffen und einen Platz zu erarbeiten. Es bringt in unserer Gesellschaft nichts, sich wegzuducken.

»Der Einzige, vor dem man sich outen muss, ist man selbst.«
MYP Magazine:
Einer der ausgestellten Fotokünstler, AdeY, sagt im Zusammenhang mit seinen Arbeiten Folgendes: „Sichtbarkeit heißt, sich um seine Mitmenschen zu kümmern – weil man weiß, dass diese Menschen einen genauso sehen, wie man ist, und sie sich in demselben Maße auch um einen selbst kümmern.“ Ist queere Sichtbarkeit für Dich ebenfalls ein Akt von Achtsamkeit? Und gibt es vielleicht sogar eine moralische Pflicht zum Aktivismus und zur Sichtbarmachung des eigenen Queerseins?
Christian Ruess:
Jein. Ich halte nichts von Outing. Ich persönlich habe mich in meinem Leben auch nie geoutet. Warum auch? Aus welchem Grund sollte ich mich vor irgendjemandem aufbauen und sagen, dass ich dieses oder jenes bin? Äh, nein, fickt euch! Das geht niemanden etwas an, das ist ganz allein meins. Der Einzige, vor dem man sich outen muss, ist man selbst. Man muss sich selbst erkennen und lernen, das mit Stolz nach außen zu tragen – ohne sich dafür zu erklären oder zu entschuldigen. Das ist das Allerwichtigste.

»In der Popkultur der DDR gab es niemanden, der mich hätte inspirieren können.«
MYP Magazine:
Wie ist Dir das in Deiner eigenen Kindheit und Jugend gelungen?
Christian Ruess:
Ich bin in den Achtzigern und Neunzigern in einem kleinen Kaff in Mecklenburg-Vorpommern aufgewachsen. An diesem Ort hätte ich gar nicht die Möglichkeit gehabt, mich zu outen oder zu erklären – weil es dort weder die Worte gab für jemanden wie mich noch irgendwelche role models, zu denen ich hätte aufschauen können. In der Popkultur der DDR gab es niemanden, der mich hätte inspirieren können – nicht im Entferntesten! Meine einzige Inspiration war Madonna.
Von daher war es für mich immer schwierig, mich irgendwo einzusortieren und zu mir selbst zu finden. Als Teenager war ich erst Raver, dann Punk, dann habe ich Hip-Hop-Klamotten getragen und zum Schluss hatte ich bunte Haare. Ich habe geschneidert, Musik gemacht, Geschichten geschrieben. Ich wusste nicht, wohin mit dieser Kreativität. Und ebenso wenig wusste ich, wo all das herkam und was das sollte. Ich war immer auf der Suche nach einer Antwort, nach einer Erfüllung. Und diese Suche wurde schnell zu einem „ich gegen die anderen“. Erst als ich schon lange erwachsen war, habe ich herausgefunden, dass dieses Getriebensein seinen Ursprung darin hat, dass mir als Kind niemand sagen konnte, dass es okay ist, wie ich bin. Und dass es dafür einen Begriff gibt: queer.

»Die Millennials sind eine schwierige Generation.«
MYP Magazine:
Viele queere Millennials – also Menschen, die im Zeitraum der frühen 1980er bis zu den späten 1990er Jahren geboren wurden – haben Schwierigkeiten, ihre persönlichen Outing-Erfahrungen oder Diskriminierungserlebnisse mit anderen zu teilen. Die Generation Z zum Beispiel scheint da ganz anders zu ticken. Wie kann man queere Menschen dieser Altersgruppe dazu bringen, sich mehr zu öffnen und ihre wichtigen Geschichten zu teilen?
Christian Ruess:
Ich habe da ganz ähnliche Erfahrungen gemacht. Die Millennials sind eine schwierige Generation. Viele haben einen Schlussstrich unter ihre oft schwierige Vergangenheit gezogen, haben sich ein solides Leben aufgebaut und sind irgendwo angekommen. Und ganz ehrlich: Auch das ist vollkommen okay.
MYP Magazine:
Hast Du eine Erklärung, warum das so ist?
Christian Ruess:
Ich glaube, das liegt an der deutschen Kultur. Wir sind in unserem Land sehr angstgetrieben und fragen uns immer: Findet mich die Nachbarschaft gut? Findet mich die Familie gut? Finden mich die Arbeitskolleg*innen gut? Und wie muss ich mich verhalten, dass mich alle gut finden? Das macht einen doch wahnsinnig! Ich persönlich denke: Solange man nett ist und ein Herz hat, kannt man machen, was man will, und rumlaufen, wie man will. Doch in einer Kultur, in der es vor allem darum geht, nicht aufzufallen, ist das schwierig.
Gerade deshalb ist es wichtig, dass viel mehr Leute ihre Erfahrungen teilen und diese nach außen tragen. Ich zumindest versuche das mit „Container Love“, aber auch in meiner Arbeit als Creative Director. Agenturen geht es doch immer darum, eine Emotion zu verkaufen oder eine Geschichte zu erzählen. Dabei denke ich mir immer: Dann erzählt doch die Geschichten! Sie liegen auf der Straße, man muss nur hinschauen, zuhören und den Mut haben, sie weiterzutragen.

»Bitte genießt weiter eure Freiheit – aber schottet euch nicht ab!«
MYP Magazine:
Dazu gehören zum Beispiel die Geschichten queerer Menschen aus der Babyboomer-Generation, die in der AIDS-Krise der Achtziger und Neunziger fast ihren gesamten Freundeskreis verloren haben. Eine Katastrophe, von der viele jüngere Queers noch nie etwas gehört haben. Was können die Jungen tun, um das Leid der Alten nicht in Vergessenheit geraten zu lassen?
Christian Ruess:
Auch da komme ich wieder nur zu der Lösung, einander zuzuhören. Selbstverständlich müssen solche Geschichten erzählt werden. Es ist wichtig, dass man darum weiß. Aber ganz ehrlich: Auch hier kann ich niemanden zwingen, sich dafür zu interessieren. Wenn ich etwa auf die queere Community in Berlin schaue, machen die Jungen im Prinzip auch nur das, was ich mit 18 gemacht habe. Sie schneidern sich ihre eigenen Klamotten zusammen, färben sich die Haare und kümmern sich einen Scheißdreck darum, was andere von ihnen halten. Ich finde das super und genau richtig. Bitte genießt weiter eure Freiheit! Ich habe dabei nur ein Anliegen: Schottet euch nicht ab!

»Es geht darum, unsere Unterschiedlichkeiten zu feiern – und nicht unsere Gemeinsamkeiten.«
MYP Magazine:
Wie meinst Du das?
Christian Ruess:
Wenn ich auf das queere Leben in Berlin blicke, habe ich das Gefühl, dass sich die Community eher aufsplittert als zusammenzuwachsen. Es gibt immer mehr Nischen-Communitys, in der alle ihren ganz eigenen safe space finden. Das führt dazu, dass die Leute außerhalb ihrer eigenen Bubble kaum mehr etwas miteinander zu tun haben. Ich weiß nicht, ob ich diese Entwicklung so gut finde. Am Ende sind wir doch eine Community, in der es darum geht, unsere Unterschiedlichkeiten zu feiern – und nicht unsere Gemeinsamkeiten. Wäre es nicht toll, wenn sich all diese kleinen Gruppen untereinander solidarisieren und ihre geschützten Räume zusammenlegen würden, um ihre Meinungen und Visionen miteinander zu teilen? Genau das ist übrigens der Anspruch und Nukleus von „Container Love“.

»Wir haben keine Ahnung, ob sie überhaupt noch leben.«
MYP Magazine:
In vielen Ländern der Welt ist es immer noch lebensgefährlich, sich als queerer Mensch sichtbar zu machen. Zum Beispiel wurde in Uganda vor Kurzem ein 20-Jähriger wegen „schwerer Homosexualität“ angeklagt. Nach dem neuen Anti-LGBTQ-Gesetz, das dort im Mai in Kraft getreten war, droht dem jungen Mann die Todesstrafe. Ist queere Sichtbarkeit ein westliches Privileg?
Christian Ruess:
Das Privileg ist vor allem ein demokratisches. Wir Queers hier in Deutschland sind es gewohnt, unsere Stimmen hörbar zu machen – auch wenn das lange genug gedauert hat. Doch viele andere Menschen haben diese Möglichkeit nicht. Es ist auch nicht absehbar, dass sich ihre Situation in naher Zeit wirklich verbessert. Ganz im Gegenteil: In vielen Ländern wird es immer schlimmer.
Das ist übrigens auch einer der Gründe, warum „Container Love“ existiert: um den Leuten klarzumachen, dass wir in einer seligen Blase leben. Zwar ist auch hierzulande nicht alles rosig. Aber als queerer Mensch in Deutschland zu leben, ist in den allermeisten Fällen immer noch ein Privileg. Anderswo dagegen ist es oft ein Albtraum. Da spreche ich leider aus Erfahrung…
MYP Magazine:
Inwiefern?
Christian Ruess:
Vor einigen Jahren wollte uns eine Künstlergruppe aus Uganda eine Fotostrecke für unsere Plattform zur Verfügung stellen. Doch kurz nachdem die Gruppe per Mail an uns herangetreten war, brach der Kontakt ab. Erst Monate später hörten wir wieder etwas von ihnen. Die Künstler*innen baten uns, sofort alles zu löschen, was online war. Sie fürchteten um ihre Sicherheit. Wir wissen bis heute nicht, ob es ernsthafte Konsequenzen für sie gab. Wir haben keine Ahnung, ob es ihnen gut geht oder sie überhaupt noch leben.

»Die queere Community ist nicht dumm und sie ist nicht blind.«
MYP Magazine:
Wie Du gerade angemerkt hast, ist auch in Deutschland noch nicht alles rosig, wenn es um queere Sichtbarkeit und Akzeptanz geht. So wäre es noch vor wenigen Jahren undenkbar gewesen, dass ein DAX-Konzern sein Logo in Regenbogenfarben taucht. Mittlerweile ist das mehr oder weniger Standard, zumindest im Juni, dem pride month.
Christian Ruess:
Ja, aber auch nur hier im westlichen Teil der Welt. In Dubai zum Beispiel passiert das nicht. Dort findet man queere Menschen scheiße. Warum sollten man also mit ihnen Werbung machen? Das kann man gut finden oder nicht, aber Dubai ist da zumindest ehrlich – was man von vielen Konzernen nicht unbedingt behaupten kann.
MYP Magazine:
In Deinem Job als Creative Director hilfst Du großen Marken dabei, in ihrer Kommunikation diverser zu werden. Hast du nicht Sorge, dass Deine Arbeit am Ende nur dem Pinkwashing-Bestreben eines Unternehmens dient?
Christian Ruess:
Die queere Community ist nicht dumm und sie ist nicht blind. Queere Menschen haben ein sehr feines Gespür dafür, wer da draußen Pinkwashing betreibt. And let’s face it: Die meisten Unternehmen benutzen queere Sichtbarkeit hauptsächlich für ihre Werbe- und Marketingzwecke. Das tatsächliche gesellschaftliche Engagement kommt entweder lange danach oder gar nicht. Aus diesem Grund geht hier immer noch wahnsinnig viel in die falsche Richtung, das ist sehr schade.
Ich persönlich mache Marken da ein ganz klares Angebot. Ich sage: Redet mit uns, wir können helfen. Wir können euch sagen, wo ihr anfangen müsst, aus welchen Gründen ihr das machen müsst und wohin ihr damit wollt. Wir geben euch das alles an die Hand. Es gibt so viele queere Konsument*innen, die es gut finden würden, wenn Marken ihre Geschichten richtig und ausführlich erzählten; wenn die richtigen Pronomen benutzt würden; wenn richtig gegendert würde. Es gibt so viele Möglichkeiten, uns zu repräsentieren und uns in die Markenwelt mitzunehmen.

»In mir steckt ein kleiner Aktivist, der die Welt verändern will.«
MYP Magazine:
Wie bist Du überhaupt dazu gekommen, Marken in Sachen Diversität zu beraten?
Christian Ruess:
Ich piesacke gerne Leute und akzeptiere den Status quo nicht. Außerdem steckt in mir ein kleiner Aktivist, der die Welt verändern will – und der es gleichzeitig liebt, kreativ zu arbeiten, Menschen vor die Kamera zu bringen und gute Geschichten zu erzählen.
Darüber hinaus habe ich im Laufe meines Berufslebens genug Mist erlebt. Ich hatte zum Beispiel mal einen Kunden aus dem Automobilsektor, für den ich Photoshoots für den asiatischen Markt konzipieren sollte. Mir wurde verboten, für die Kampagne nichtweiße Models zu buchen. Die Begründung: Der asiatische Markt mag die nicht. Aus solchen unnötigen Situationen ist eine Wut entstanden, die ich benutzen wollte, um tatsächlich etwas zu verändern.

»Manchmal braucht es ein kleines Kompliment, vor allem an sich selbst.«
MYP Magazine:
In einem der Filme, die ihr auf der „Visible Love“-Ausstellung gezeigt habt, wird folgende Frage gestellt: „Wenn ich mein Teenager-Ich treffen könnte, was würde ich ihm sagen?“ Welche Botschaft hättest Du für Dein jüngeres Ich?
Christian Ruess:
Es fällt mir schwer, das auszusprechen. Aber ich glaube, ich würde meinem teenage self sagen, dass es sich selbst lieben solle. Weil das etwas ist, das mir nie beigebracht wurde. Punkt.
MYP Magazine:
Ist das auch der Grund, warum bei der Ausstellung überall Sticker mit der Aufschrift „You look good“ herumlagen?
Christian Ruess:
Klar! Manchmal braucht es ein kleines Kompliment, vor allem an sich selbst. Das ist wichtig. Außerdem sind so viele Os grafisch einfach hübsch. Kommunikation ist das A und O. Und ein Kompliment ist ein guter Einstieg.
Mehr von und über Christian Ruess:
Mehr von und über »Container Love«:
Interview & Text: Jonas Meyer
Portraits Christian Ruess: Sven Serkis
Fotografie »Visible Love 2023«: Milena Zara
Mit besonderem Dank an Javier Zamora-Kalazich.
Monica Conesa
Portrait — Monica Conesa
Diese Opfer muss man bringen, um ein Opernstar zu werden
Die aktuellen Top-Opernstars der Welt sind in ihren Fünfzigern, daher wagt sich so langsam die nächste Generation aus der Deckung: Das kubanisch-amerikanische Nachwuchstalent Monica Conesa hat die Stimme, die Eleganz und das Durchhaltevermögen für die Position der Primadonna. Außerdem trällerte sie bereits als Netrebko-Vertretung in Verona. Ein Portrait.
4. November 2023 — Text: Katharina Viktoria Weiß, Fotografie: Frederike van der Straeten

Aktuell schwebt Monica Conesa in den Fußstapfen von Anna Netrebko über die Bühne.
Monica Conesa singt Opern, wie Tennisspielerinnen sich auf die US Open vorbereiten: Alle Emotionen sind auf das Ziel gerichtet, der Körper wird athletisch optimiert und die Technik wird stets perfektioniert. Und ähnlich wie viele Sportstars reist die kubanisch-amerikanische Sängerin auch mit ihrem Trainer um die Welt.
Wir treffen die beiden im Berliner Precise Hotel, das mit seinem spanischen Vintage-Charme die perfekte Kulisse für die katzenhafte Künstlerin und ihren Gesangslehrer ist. Der in Mexico geborene Mauricio Trejo ist für den 27-Jährigen Nachwuchsstar das, was Giovanni Battista Meneghini für die Jahrhundertsängerin Maria Callas war: Mentor, Coach und Gefährte auf einem Weg zur globalen Megakarriere.
Denn aktuell schwebt Monica Conesa bereits in den Fußstapfen von Anna Netrebko über die Bühne, der derzeit bekanntesten Opernsängerin der Welt: Letztes Jahr debütierte sie als anmutige Aida in der gleichnamigen Verdi-Oper, und zwar in der legendären Arena di Verona, Italiens spektakulärster Kulisse für klassische Musik.
Und auch im Sommer 2023 wurde sie erneut eingeladen, um sich mit Anna Netrebko die Hauptrolle der äthiopischen Prinzessin mit einem atemberaubenden Programm zu teilen, das die beliebtesten und meistaufgeführten Werke des legendären Amphitheaters in ein neues Zeitalter führen sollte – eine ganz besondere Ehre, denn die Opernfestspiele in der Arena feierten ihr 100-jähriges Jubiläum.
Die Aufführungen in der malerischen Kulisse sind stets spektakulär, was zu einem ungewöhnlich jungen Publikum führt: Von allen Theatern Italiens beansprucht das Opernhaus den größten Anteil an Besucher*innen unter 30 Jahren für sich.

»Diese Geschichte zeigt, wie unsere Hände zärtlich streicheln oder brutal zerstören können.«
Für dieses Publikum ist Monica Conesa ein Magnet: Ihr gesanglicher Ausdruck ist klar, ihre Bewegungen sind leidenschaftlich und in ihrem unverbrauchten Blick lodert das Feuer ebenso explosiv wie in ihrer einzigartigen Stimme. Diese reizvolle Verkörperung von unbändigem Willen und erdbebenhafter Energie passte perfekt in die Inszenierung von Regisseur Stefano Poda, der seine Eröffnungsoper bei einem Berlin-Besuch im Frühjahr als „ein breit hingepinseltes Fresko der Menschheitsgeschichte“ bezeichnete.
„Diese Geschichte zeigt, wie unsere Hände zärtlich streicheln oder brutal zerstören können“, äußerte sich Poda außerdem. Seine „Aida“ sei futuristisch und technologisch und habe ästhetische Ähnlichkeiten zur Renaissance-Tour von Beyoncé. Ein Vergleich, der Monica Conesa zum Schmunzeln bringt. „Bei ihm verschmelzen Epochen, Welten und Dimensionen. Seine Produktionen bringen das Unterbewusste als körperliche Choreografie auf die Bühne“, erklärt Conesa.
So erdachte sich Poda beispielsweise Szenen, in denen Aidas Erinnerungen an ihre Kindheit in Äthiopien als Tanzformationen versinnbildlicht werden. So ein Bühnenbild regierte zwischen antiken Ruinen und Raumschiffen. Ein Experiment, dass unter dem Sternenhimmel der offenen Arena di Verona ein bildgewaltiges Statement setzte – und bei dem sich die Opernsängerin einmal mehr bewusst wurde, warum ihr dieser Lebensweg all die Opfer wert ist.

»Früher habe ich mich für eine Karriere als Tierärztin interessiert.«
Monica Conesa wuchs auf der Insel Venice in Florida auf, unweit von Disney World. Sie erinnert sich an eine glückliche Kindheit. Die schillernden Fantasie-Welten hätten ihre Ambition, selbst ein Märchen zu erleben, stark geprägt, erzählt sie. „Durch die ganzen Zoos in der Umgebung, die die Besucherscharen mit exotischen Tieren locken, habe ich mich früher für eine Karriere als Tierärztin interessiert.“ Ihre Eltern haben kubanische Wurzeln und sind Ärzte, ihre ganze Familie hat starken beruflichen Bezug zum medizinischen Sektor.
Doch dann entdeckte sie als 14-Jährige eine DVD in der Sammlung ihres Großvaters. Es war das mittlerweile legendäre „The Berlin Concert“ von Plácido Domingo, Anna Netrebko und Rolando Villazon aus dem Jahr 2006. Dass der Dirigent der Aufführung, Maestro Marco Armiliato, ebenjener war, unter dem sie Jahre später auch ihr Debüt als Opernstar in Verona feiern sollte, ist nur eines von vielen Beispielen, wie sich in der Karriere von Monica Conesa immer wieder magische Kreise schließen.

»Meine Lungen sollen sich mit Luft gefüllt haben, anscheinend waren mir die Anstrengung und der Wille anzusehen.«
„Und so verliebte ich mich in die Oper. Ich verbrachte den ganzen Sommer damit, jede Opern-Aufzeichnung in die Finger zu bekommen, die irgendwie in Reichweite war.“ Wenn sie von diesem Augenblick berichtet, schwingt in ihrer schönen Erzählstimme die Obsession mit, die sie seitdem begleitet.
Sie ist ihren Eltern dankbar, dass die ihre Leidenschaft von Anfang an unterstützten, und den Teeanger zu einem Opernkurs für Jugendliche anmeldeten. „Meine Mutter erzählt immer von der Anekdote, als ich ein kleines Baby war. Ich lag nackt auf der Couch und beobachtete sie. Plötzlich fing sie an zu singen. Meine Augen wurden ganz groß und fixierten ihr Gesicht. Danach sollen sich meine Lungen mit Luft gefüllt haben, anscheinend waren mir die Anstrengung und der Wille anzusehen. Plötzlich kam ein lautes ‚Ahhh‘ heraus – mein erster langer Ton.“ Es sollten noch viele lange und dann immer längere Töne folgen.


»Meine Lehrerin hat mir von Anfang an sehr ehrlich beschrieben, wie schwierig dieses Leben ist.«
Ihre erste Lehrerin an der Opernschule in Sarasota war eine berühmte Mezzosopranistin, die über weite Teile ihrer Laufbahn in München gesungen hatte. „Sie bestärkt mich in dem Traum, bereits zu Beginn meiner Karriere Engagements in Europa anzustreben. Sie war auch diejenige, die mir von Anfang an sehr ehrlich beschrieben hat, wie schwierig dieses Leben ist und warum es so voller Entbehrungen steckt.“
Um auf dem Niveau singen zu können, wie es Monica Conesa tut, muss der Körper mit einer Disziplin geformt werden, die der von Hochleistungssportler*innen ähnelt. Neben Alkohol und sehr salzhaltigen Gerichten müssen auch Nüsse vermieden werden, da sie Allergien auslösen können. Und auch Lebensmittel, die das Aufstoßen von Magensäure begünstigen, sollten vom Speiseplan gestrichen werden. Zudem gibt es viele Nächte, in denen man als Sängerin stumm zu Hause sitzen muss, um die Stimme für den großen Auftritt zu schonen.

»Am Ende hängt alles an dem Körper – und an den Muskeln, die den Sound supporten.«
Monica Conesa ging direkt nach der High School auf die Manhattan School of Music. Während sich andere in New York die Nächte um die Ohren schlugen, trank Conesa zu Hause Tee und lernte Opernsprachen wie Deutsch und Italienisch. „Mir wurde früh gesagt, wie viel Druck diese Karriere bedeutet. Aber ich habe meine Entscheidung nie hinterfragt, diese Opfer fielen mir leicht. Außerdem stellte ich schnell fest, dass ich nicht nur auf der Bühne in Topform sein will, sondern auch mit der Stimme trainieren will, die ja irgendwann in einem Opernhaus zu hören ist. Und am Ende hängt eben alles an dem Körper – und an den Muskeln, die den Sound supporten. Mein Klang ist zu 100 Prozent ein Produkt dieser Region hier“, sagt Conesa und streicht sich dabei über die Körpermitte.
Um zu verdeutlichen, wie stark sich ihre Konstitution durch das Gesangstraining verändert, erzählt sie, dass ihr Brustkorb um eine BH-Größe angewachsen sei. Gerade in Zeiten, in denen sie jeden Tag für Vorstellungen übt oder vor Publikum singt, müsse sie sich zudem sehr proteinreich ernähren, um die nötige Energie aufzubringen.

»Deine Freunde sind dir nur voraus, du wirst ihnen später begegnen.«
Über lange Jahre machte sie das zu einer Außenseiterin. „Aber ich war schon immer okay damit, eher eine Einzelgängerin und vielleicht manchmal auch etwas einsam zu sein.“ Denn es habe nie viele Gleichaltrige gegeben, die Conesas Faszination für die Opernkultur, in die sie sich so vertiefen wollte, teilen konnten.
„Meine Mutter sagte dann immer: ‚Mach dir keine Sorgen, deine Freunde sind dir nur voraus, du wirst ihnen später begegnen‘. Ich folgte ihren Rat und bildete mich stetig weiter. Nun bin ich in einer Situation, in der mir viele Menschen begegnen, die meine Leidenschaften teilen und mein Leben mit Glück erfüllen.“

»Ich habe immer gesagt, Monica hat einen Hals wie ein Mann.«
Zu diesem Menschen gehören auch ihr Mentor Mauricio Trejo und seine Frau Elisabeth. Als Monica Conesa noch in New York lebte, kämpfte sie mit der Tatsache, dass ihre ausdrucksstarke und laute Stimme nicht ganz den Zeitgeist traf. Sie wanderte von Gesangslehrerin zu Gesangslehrer und wurde letztlich an Elisabeth de Trejo verweisen. Sie gilt als Expertin auf dem Gebiet der starken Stimmen. Vielleicht auch, weil ihr Ehemann Mauricio selbst so ein Organ besitzt.
De Trejo half ihrer Schülerin dabei, Körper, Arbeitsethos und Geisteshaltung in eine Linie zu bringen – und übergab den Staffelstab dann an ihren Gatten. „Ich habe immer gesagt, Monica hat einen Hals wie ein Mann“, sagt der Stimmcoach, als er seinen Zögling einen Espresso vorbeibringt.

Das Ausufern ihrer Stimme ist nun kein Hindernis mehr – sondern ein wertvolles Alleinstellungsmerkmal.
Während in der Pandemie viele talentierte Künstler*innen den Operngesang an den Nagel hingen, zog Monica Conesa bei dem Mentoren-Ehepaar ein. Sie half den de Trejos beim Homeschooling der beiden Kinder und erhielt im Gegenzug intensives Gesangstraining. Zusammen haben sie die Technik der Nachwuchs-Sopranistin so verfeinert, dass das Ausufern ihrer Stimme nun kein Hindernis mehr ist – sondern ein wertvolles Alleinstellungsmerkmal.
Das erkannte auch Maestro José Carreras. Der Klassikstar war Juryvorsitzender des Premio Fausto Ricci Wettbewerbs und verlieh 2021 die Trophäe an Monica Conesa. In diesem Zuge bescheinigte er ihr „eine außergewöhnliche, theatralische und sichere Stimme“.
Besonders wundervoll kommt diese im Zusammenspiel mit ihren männlichen Kollegen zum Ausdruck. Wenn Conesa auf der Bühne steht und einen ebenbürtigen Tenor zur Seite hat, schaukelt sich die Melodie hoch, wie bei einem spannenden Tennismatch. Obwohl sich die Opernsängerin in ihren Rollen für die Liebe umbringen lässt oder vor Leidenschaft zergeht, versucht sie sich im Privaten von zu viel Drama fernzuhalten.

»Für einen Termin wie heute schicke ich meine Bühnenpersona oder mein kreatives Ich ins Rennen.«
Sie erzählt von einer Methode, bei der Künstler*innen ihre Bühnenpersona, ihr kreatives Ich und ihr privates Ich voneinander trennen. „Zwei davon können sich vermischen, aber für die dritte ist kein Platz mehr. Für einen Interview-Termin wie heute – oder für einen Auftritt vor Publikum – schicke ich meine Bühnenpersona oder mein kreatives Ich ins Rennen. Und mein privates Ich, das eher schüchtern ist, bekommt dann Pause und kann sich entspannen. Das ist tatsächlich weniger schizophren, als es jetzt klingt“, sagt sie lachend.

»Niemand will Monica aus Florida sehen, die nach einer Probennacht um zwei Uhr tot ins Bett fällt.«
Das schenkt ihr die Möglichkeit, alle Facetten ihres Berufs zu genießen. Für unser Shooting zum Beispiel bereitete sie sich dadurch vor, dass sie ein exquisites Schmuckset beim italienischen Designer Giovanni Raspini erwarb. „Niemand will Monica aus Florida sehen, die nach einer Probennacht um zwei Uhr tot ins Bett fällt. Die Menschen kommen für Monica Conesa.“
Mit ihrem Stil unterstreicht sie diese Vision. Sie ist inspiriert von den vierziger und fünfziger Jahren – und paart den zeitlosen Diven-Look mit kontemporären Accessoires. Statt in Leggins probt sie stets in High-Waste-Hosen und Audrey-Hepburn-Bodys. Doch das hat nicht nur Fashion-Gründe: „Zum einen kann Mauricio dann ständig meine Atmung sehen und mich korrigieren. Und an der Taille spüre ich, ob mein Bauch den richtigen Druck nach außen ausübt.“

»Die Deutschen sind verrückt nach Opern.«
Trotz ihres hinreißenden Temperaments scheint alles an Monica Conesa sehr überlegt zu sein. Auch ihre nächsten Schritte in Europa wird sie mit wachem Geist machen. In der Hauptstadt geistert das Gerücht um, dass Berlin als „Hollywood für Opernsänger“ gelte.
Darauf angesprochen überlegt Conesa kurz und bestätigt dann: „Die Deutschen sind verrückt nach Opern, auch in Italien ist der Großteil des Publikums aus Deutschland. Zusammen mit der Schweiz und Österreich ist der Markt sehr groß – und die Opernhäuser in Berlin oder Wien sind ein Traum.“
Ihr Mentor könnte sich seinen Schützling auch in einer Wagner-Oper vorstellen. Doch letztlich ist es egal, ob es die Künstlerin nach Bayreuth oder an das Sydney Opera House ziehen wird: Die großen Opernstars unserer Zeit, wie Anna Netrebko oder Jonas Kaufmann, sind in ihren Fünfzigern, die neue Generation wurde noch nicht identifiziert. Nur „Die Conesa“ bringt sich jetzt schon in Aufstellung für die Aufnahme in den Olymp.

Mehr von und über Monica Conesa:
Interview & Text: Katharina Viktoria Weiß
Fotografie: Frederike van der Straeten
JEREMIAS
Interview — JEREMIAS
»Songschreiben ist eine ziemlich egozentrische Sache«
Mit ihrem zweiten Album, liebevoll »Von Wind und Anonymität« genannt, ermöglichen uns JEREMIAS einen tiefen Einblick in ihr Seelenleben. Dabei ist es der Hannoveraner Band gelungen, eine musikalische Grundsätzlichkeit zu schaffen, mit der sie das Gesagte millimetergenau auf den Punkt bringt. Kurz gesagt: ein Album mit Geist und Groove – chapeau! Wir treffen Frontmann Jeremias Heimbach zu einem sehr persönlichen Interview: ein Gespräch über die Vorzüge der Anonymität, die Anziehungskraft von Hermann Hesse, doofe Memes und eine windige Insel, auf der man hin und wieder auf die Fresse fällt.
27. Oktober 2023 — Interview & Text: Jonas Meyer, Fotografie: Maximilian König

Man stelle sich kurz folgende Situation vor: Man sitzt abends allein in einer kleinen Bar, sinniert so vor sich hin und plötzlich fragt ein Unbekannter, ob er sich dazusetzen dürfe. In einer Mischung aus Höflichkeit und Neugier bietet man ihm einen Platz an und lässt sich auf ein Glas Vino Bianco einladen.
Kaum hat man sich zugeprostet, fängt der Unbekannte an, aus seinem Leben zu erzählen. Mal berichtet er vom Tod eines geliebten Menschen, mal vom Umzug in eine neue Stadt, mal von der Sorge um einen engen Freund. Ohne Berührungsängste und mit beeindruckender Eloquenz teilt seine tiefsten Gefühle und privateste Gedanken. Dabei wirkt er überraschend unverzagt und ganz bei sich. Mehr noch: Seine Gier nach Leben ist geradezu ansteckend.
Nach einer knappen Dreiviertelstunde steht der Unbekannte auf und verabschiedet sich mit einer herzlichen Umarmung. Plötzlich ist da nichts als Stille – und das Gefühl, gerade eine Form emotionaler Verbundenheit erlebt zu haben, mit der man zu Beginn des Abends nicht gerechnet hätte.
So oder so ähnlich fühlt es sich an, wenn man zum ersten Mal „Von Wind und Anonymität“ hört, das neue Album von JEREMIAS. Die vierköpfige Band, die sich 2018 in Hannover gründete und drei Jahre später mit „Golden Hour“ ihr erstes Studioalbum präsentierte, hat nun mit ihrer zweiten Platte ein Werk geschaffen, das einen auf vielfältige Art und Weise berührt. Ein Album mit Geist und Groove, das von Anfang bis Ende großen Spaß macht – auch wenn Ben Hoffmann, Jeremias Heimbach, Jonas Hermann und Oliver Sparkuhle damit ihre Hörer*innen tief in ihr Seelenleben blicken lassen. Oder gerade deshalb.
Hatte sich der 23-jährige Sänger und Bandgründer Jeremias vor einiger Zeit noch unbekleidet auf einem EP-Cover abbilden lassen, macht sich auf dem zweiten Album nun die gesamte Band nackt – allerdings aus rein emotionaler Perspektive. Und wenn man ehrlich ist, ist das bei Menschen auch der deutlich interessantere Aspekt.
Verpackt sind diese überaus persönlichen Gefühle und Gedanken in eine textliche Poesie, die sich erfrischend klar und wortgewandt von eingetretenen Deutschpop-Pfaden absetzt. Und in einen Sound, der das Gesagte musikalisch auf den Punkt bringt, und zwar millimetergenau. Der Sound des neuen Albums kommt im Vergleich zu „Golden Hour“ zwar weniger fulminant daher, wirkt dafür aber wesentlich grundsätzlicher und selbstbewusster. Man könnte auch erwachsener sagen, aber mit diesem Begriff, so wird uns Frontmann Jeremias im Interview erzählen, hat er so seine Probleme.
Alles in allem ist „Von Wind und Anonymität“ ein Plädoyer dafür, dass die Welt der Musik eine schlechtere wäre, wenn sie nur noch aus hastig veröffentlichten Singles bestünde – ohne reichhaltige, sorgfältig kuratierte Alben wie dieses, deren Reiz gerade darin besteht, dass man sich einfach mal 45 Minuten auf sie einlassen muss. Wie auf einen Unbekannten, der sich abends in einer kleinen Bar zu einem an den Tisch setzt und von seinem Leben erzählt.
Im Moabiter Studio von Fotograf Maximilian König treffen wir Jeremias Heimbach zu einem sehr persönlichen Gespräch.

»Wir freuen uns, dass mit diesem Album wirklich alles einmal gesagt wurde.«
MYP Magazine:
Mit Eurem neuem Album gestattet Ihr uns, den Hörer*innen, einen tiefen Blick in Euer Seelenleben. Wie geht es Dir und den anderen drei damit, ein so intimes Stück Musik in die Welt geworfen zu haben?
Jeremias:
Uns geht‘s definitiv gut damit. Wir haben ja im Vorfeld schon sieben Singles rausgehauen und sind dabei auf sehr viel positive Resonanz gestoßen. Außerdem ist es mittlerweile fast ein Jahr her, dass wir die Platte aufgenommen haben. Dadurch haben wir alle auch einen gewissen Abstand dazu. Aber ich will das jetzt gar nicht kleinreden, ganz im Gegenteil: Wir freuen uns, dass mit diesem Album jetzt, zum 22. September 2023, wirklich alles einmal gesagt wurde.

»Wir machen das alles einfach nur aus einer puren Freude, Liebe und inneren Dringlichkeit heraus.«
MYP Magazine:
Wenn man „Von Wind und Anonymität“ zum allerersten Mal hört, kann es passieren, dass man sich emotional ziemlich überrollt fühlt: Die Tatsache, dass einem vier fremde Menschen so private Gedanken und Gefühle anvertrauen, scheint eine besondere Verbindlichkeit zu schaffen, der man als Hörer*in auch irgendwie gerecht werden will. Wie gehst Du persönlich mit der Verantwortung um, die entsteht, wenn man mit seiner Musik für andere Menschen einen so großen emotionalen Resonanzraum schafft?
Jeremias:
Dass unser neues Album derartige Gefühle auslösen kann, höre ich gerade zum ersten Mal – und berührt mich. Aber diese krasse Verantwortung, von der Du sprichst, spüre ich persönlich überhaupt nicht, zumindest nicht im Moment. Das liegt wahrscheinlich daran, dass wir das alles einfach nur aus einer puren Freude, Liebe und inneren Dringlichkeit heraus machen. Das allein ist der Kern unserer Musik. Vielleicht entspringt daraus dieses Nichtverantwortungsgefühl.

»Mist! Wir singen davon, dass wir den Winter überlebt haben? Leute überleben den scheiß Krieg nicht!«
MYP Magazine:
Öffentlich über seine Gefühle zu sprechen, ist etwas, das immer noch nicht selbstverständlich ist in unserer Gesellschaft – insbesondere für Männer. Viele argumentieren, dass ihre Probleme im Vergleich zu anderen eher unbedeutend seien, vor allem mit Blick auf das Elend dieser Welt. Gab es bei Euch ähnliche Gedanken bei der Entwicklung der neuen Platte? Hattest Du persönlich Zweifel, dass Deine Gefühle nicht „wichtig genug“ seien, um sie zu äußern?
Jeremias:
Ja, absolut. Ich kann Dir dazu sogar einen konkreten Moment nennen. Als ich im März 2022 in Barcelona war und den Song „Wir haben den Winter überlebt“ geschrieben habe, hatte Putin wenige Wochen zuvor die Ukraine überfallen. Ich dachte nur: Mist! Wir singen davon, dass wir den Winter überlebt haben? Leute überleben den scheiß Krieg nicht! Als ich darüber mit unserem A&R-Manager Maxi gesprochen habe, hat er mir einen wichtigen Satz mitgegeben. Er sagte, dass man menschliches Leid nicht vergleichen und Gefühle nicht gegeneinander aufwiegen solle. Und das habe ich seitdem auch nicht mehr getan…
MYP Magazine:
… weil alles Menschliche seine Berechtigung hat.
Jeremias:
Genau. Und dennoch glaube ich, dass man sich als Musiker in so einem Moment nur gutfühlen kann, wenn man ganz genau weiß, wofür man das alles macht. Natürlich wollen wir, dass die Leute unsere Songs hören; natürlich wollen wir, dass sie zu den Konzerten kommen und unsere Texte mitbrüllen. Aber absolut vorrangig ist für uns, in der Musik Ausdruck zu finden. Nur darum geht es, das ist unser Antrieb.

»Mit zunehmendem Erfolg haben wir festgestellt, dass jeder von uns auf einmal etwas anderes wollte.«
MYP Magazine:
Diese Einstimmigkeit innerhalb der Band gab es in den letzten Jahren aber nicht immer. Im Pressetext zum neuen Album heißt es: „Die Synchronisation untereinander und füreinander ging verloren, die Beziehungen gerieten aus dem Takt. Irgendwann die Frage aller Fragen: scheitern oder weiter?“ Was genau war passiert?
Jeremias:
Ich glaube, dass ein gewisser Erfolg für alle erst mal komisch ist – und sich auch auf jeden Einzelnen anders auswirkt: privat, in der Beziehung zueinander sowie in den Beziehungen zu anderen Menschen. Zwar befinden wir uns als Band immer noch auf einem entspannten Level, was den Hype angeht. Dennoch haben wir mit zunehmendem Erfolg festgestellt, dass jeder von uns etwas anderes wollte. Und diese Situation war für alle erst mal verwirrend.
»Plötzlich steht man an einem Punkt, an dem die Leute diverse Dinge auf einen projizieren.«
MYP Magazine:
Kannst Du beschreiben, warum?
Jeremias:
Als wir vor fünf Jahren mit der Band gestartet sind, waren wir einfach nur vier Freunde, die gemeinsam Mucke machen wollten. Dann haben wir gemerkt, dass das etwas Längerfristiges werden könnte – etwas, das man beruflich machen will. In unserem Fall hieß das: Man gründet eine fucking GbR und plötzlich steht man an einem Punkt, an dem einen die Leute auf der Straße erkennen und diverse Dinge auf einen projizieren. Man wird zu einer Person der Öffentlichkeit, hat diverse Geschäftspartner und es gibt erwachsene Menschen, die mit einem ihren Lebensunterhalt verdienen. All das war nicht nur super neu für uns, sondern gleich auf mehreren Ebenen anstrengend. So kam es, dass jeder von uns für sich und sein Leben etwas anderes wollte. Das war auch okay so, wir haben sehr viel daraus gelernt. Und letztendlich ist das bei vier Individuen auch normal.

»Die drei sind die einzigen, die wirklich nachvollziehen können, wie es ist, sich klein zu fühlen und riesig.«
MYP Magazine:
Was bedeuten Ben, Jonas und Olli für Dich?
Jeremias:
Diese drei Jungs sind mein Lebenselixier.
MYP Magazine:
Es gibt Menschen, die wählen hierfür den Begriff „chosen family“.
Jeremias: (lächelt)
Ich mag meine Familie sehr, daher würde ich das Wort auch nur exklusiv für sie verwenden. Aber wir vier sind genauso eng. Und ich bin sehr froh, mit diesen drei Jungs das große Abenteuer teilen zu können, das wir 2018 gemeinsam begonnen haben. Sie sind die einzigen, die wirklich nachvollziehen können, wie es ist, 70 Konzerte zu spielen; sich sicher zu fühlen mit der Öffentlichkeit und unsicher; sich geil zu fühlen und schrecklich; sich klein zu fühlen und riesig. Außenstehende werden das in der Form nie wirklich nachvollziehen können – weder das Management, noch das Label, noch das Booking. Auch nicht ein bester Kumpel. Ich bin sehr dankbar, dass wir vier diese gemeinsame Erzählung haben.

»In dem Moment, in dem es Olli nicht gut ging, war das Grund genug für mich zu sagen: Ich bin da für dich.«
MYP Magazine:
Du hast Olli den Song „Da für Dich“ gewidmet. In Deiner Stimme scheint hier eine ganz besondere Dringlichkeit und Betroffenheit zu stecken. Was hat Dich dazu gebracht, diesen Song zu schreiben?
Jeremias:
Auslöser war eine Show in Linz am 18. Mai 2022. Nach dem Auftritt kam Olli zu uns hinter die Bühne und sagte, dass er gerade eine Panikattacke gehabt habe – und dass er nicht wisse, ob er das alles noch könne und wolle. Damit meinte er nicht nur die Live-Shows, sondern auch die Band als solche. Als wir einen Tag später in Wien gespielt haben, kam mir im Backstage die Idee für den Song. Und später im Hotel habe ich angefangen, daran zu schreiben.
MYP Magazine:
„Da für Dich“ erzählt davon, dass Ollis Seele nicht nachkam in den letzten Jahren. Wie erging es Deiner eigenen Seele in dieser Zeit?
Jeremias: (zögert einen Moment)
Gut, denke ich… nein, eigentlich nicht gut, weil es meinem Bruder nicht gut ging. Aber irgendwie war ich okay damit. Oder besser gesagt: Mir selbst ging es okay. Aber weißt Du, das mit dem Songschreiben ist eine ziemlich egozentrische Sache. Ich kann am Ende immer nur über das schreiben, was mich persönlich triggert und in irgendeiner Form berührt. Alles andere ist mir egal, zumindest aus musikalischer Sicht. Soll heißen: In dem Moment, in dem es Olli nicht gut ging, war das Grund genug für mich zu sagen: Ich bin da für dich. Und das wollte ich in einem Song ausdrücken.

»Tobias? Elias? Wie heißt Du?«
MYP Magazine:
Im Song „Egoist“ erzählst Du davon, wie sich Dein eigenes Leben in den letzten Jahren verändert hat. Was hat Dich hier getriggert, dass Du des in einem Song verarbeiten wolltest?
Jeremias:
In „Egoist“ behandele ich meinen Umzug nach Berlin. In Hannover wurde ich in letzter Zeit immer öfter auf der Straße erkannt und angesprochen, das wurde mir irgendwann zu viel. In Berlin habe ich das absolute Gegenteil erlebt – und das ist heute immer noch so. Wenn ich mich hier jemandem vorstelle, gibt’s oft die Antwort: „Tobias? Elias? Wie heißt Du?“ Das fand ich vor allem am Anfang richtig geil. Ich dachte: Wie krass ist es, dass niemand etwas von mir will? Dieses Gefühl wollte ich in der Songzeile „Dann bin ich lieber nichts“ zum Ausdruck bringen.
MYP Magazine:
Wie gelingt es Ben, Jonas und Olli, sich ein Privatleben zu bewahren?
Jeremias:
Ich würde behaupten, dass es uns allen enorm hilft, jeweils einen festen Freundeskreis zu haben, der um das Gut Privatsphäre weiß. Daher funktioniert es auch für die drei noch ganz gut, so etwas wie ein Privatleben zu haben.

»Wer bin ich, dass ich den Leuten sage, was sie zu denken haben?«
MYP Magazine:
Als Ihr vor einigen Jahren in der Sendung „Inas Nacht“ aufgetreten seid, begrüßte Euch Moderatorin Ina Müller mit den Worten: „Ihr seht sooo gut aus.“ Wie geht Ihr damit um, wenn Euer Aussehen so explizit thematisiert und vielleicht sogar vor die Musik gesetzt wird? Ärgern Euch solche Momente?
Jeremias:
Ärgern ist ein viel zu großes Wort dafür. Wir haben uns damals riesig über Inas Einladung in die Sendung gefreut, daher läge mir nichts ferner, als ihr daraus einen Strick zu drehen. Sie hat in dem Augenblick nur das in Worte gepackt, was sie gedacht hat, und wollte uns ein schönes Kompliment machen. Wir jedenfalls haben uns in dem Moment sehr geschmeichelt geführt.
MYP Magazine:
Trotzdem gibt es Menschen, die Bands in erster Linie wegen ihres Aussehens gut finden – diesen Umstand beschreibt Ihr selbst auch im Song „Clown zum Freak“.
Jeremias:
Ja, safe. So etwas ist super einseitig und oberflächlich. Aber wer bin ich, dass ich den Leuten sage, was sie zu denken haben? Letztendlich hinterlässt jeder Mensch einen Eindruck. Wir können nichts dafür, wenn uns Leute aus optischen Gründen gut finden. Aber auch das ist natürlich okay… (lacht)
Es gibt übrigens eine deutsche Meme-Seite, die immer wieder ein Foto von uns nimmt und „Elevator Boys“ darunter schreibt. Ich denke mir dabei regelmäßig: Hä, warum? Aber es ist, wie es ist. Mittlerweile sind wir‘s gewohnt und ich habe aufgehört, dem nachzugehen. Man kann ohnehin nicht allen Leuten gefallen. Unmöglich. Entweder erkennen die Menschen das, was du tust, und lieben dich dafür. Oder eben nicht. Beides ist okay. Ich werde hier niemanden verurteilen. Und ich werde auch nicht versuchen, irgendwen zu überzeugen.

»Für mich ist es immer wieder faszinierend, wie aus einem einzelnen Wort eine physische, haptische Sache wird.«
MYP Magazine:
Eure jüngste Single-Auskopplung, der Song „Goldmund“, ist eine kleine Hommage an den berühmten Roman „Narziss und Goldmund“ von Herman Hesse. Welche Rolle spielt Literatur in Deinem Leben?
Jeremias:
Ich finde die Kunstform richtig geil! Das mag vielleicht ein bisschen altbacken klingen, aber für mich ist es immer wieder faszinierend, wie aus einem einzelnen Wort eine physische, haptische Sache wird; wenn so ein Wort auf ein weißes Blatt Papier gedruckt wird und dann in deinem Kopf Bilder auslöst, sobald du es gelesen hast. Ich habe zwar schon als Kind und Jugendlicher viel gelesen, zu Hause und in der Schule, aber erst vor Kurzem einige Klassiker für mich entdeckt. Die Werke von Hermann Hesse mag ich wirklich sehr, aber auch Bücher wie „Schachnovelle“ von Stefan Zweig oder „Das Parfum“ von Patrick Süskind. Ich bin einfach ein Freund guter Geschichten. „Schachnovelle“ zum Beispiel ist dramaturgisch so aufgebaut ist, dass du mit dem letzten Satz abgeholzt wirst – das erschüttert dich, weil‘s so gut ist.

»Goldmund gehört niemandem. Diesen Gedanken fand ich schön.«
MYP Magazine:
Und warum hat es Dir die Figur Goldmund so angetan?
Jeremias:
Ich habe „Narziss und Goldmund“ gelesen, als wir alle im zweiten Corona-Frühjahr steckten und jede*r ganz allein für sich war, im stillen Kämmerlein. Dieser Goldmund aber, der war draußen in der Welt unterwegs und konnte machen, was er wollte. Erst war er mit Narziss im Kloster, dann ist er dort ausgebrochen und im Anschluss durch die Dörfer getingelt. Das fand ich in dem Moment wahnsinnig schön und hoffnungsvoll.
MYP Magazine:
In den ersten Zeilen des Songs heißt es: „Goldmund, du erinnerst mich an mich“. Hermann Hesse beschreibt Goldmund in seinem Roman als jemanden, der „zu den Menschen gehöre, welchen ein Stück aus ihrem Leben verloren gegangen ist, welche unter dem Druck irgendeiner Not oder Bezauberung sich dazu verstehen mussten, einen Teil ihrer Vergangenheit zu vergessen.“ Ist dieser Aspekt ebenfalls einer, in dem Du dich widerfindest?
Jeremias:
Nein, überhaupt nicht. Meine Vergangenheit war super, ich bin dankbar für alles. Ich mochte einfach nur Goldmunds Art zu denken – damit kann ich mich persönlich absolut identifizieren. Goldmund lebt nach Lust und Laune in den Tag hinein, ist heute hier und morgen da, ist im einen Moment überschwänglich und happy und im nächsten Moment wieder bittertraurig. Dennoch macht er am Ende immer, was er will. Er gehört niemandem. Diesen Gedanken fand ich schön. Man muss aber auch aufpassen, dass es nicht zu pathetisch wird. (grinst)
MYP Magazine:
Pathos hat das Album an anderen Stellen ja auch im Überfluss.
Jeremias lacht laut.

»Ich habe den Knabenchor in Hannover gefragt, ob sie sich vorstellen könnten, das einzusingen.«
MYP Magazine:
Ist der sakrale Charakter des Songs „97“ auch von „Narziss und Goldmund“ und der mittelalterlichen Klosterschule inspiriert, in der der Roman spielt?
Jeremias:
Das mag man denken. Aber tatsächlich geht das auf die Entscheidung zurück, keine weitere Klavierballade machen zu wollen. Trotzdem wollten wir mit diesem Song irgendwie musikalisch umgehen. Die Option, das Ganze mit unseren Instrumenten neu zu arrangieren, kam für uns aber nicht infrage. Also habe ich den Knabenchor in Hannover angerufen, in dem ich selbst 16 Jahre lang gesungen habe, und gefragt, ob sie sich vorstellen könnten, das einzusingen. Nach ihrer Zusage habe ich ihnen kongruent zum Klavier ein Arrangement geschrieben. Deswegen klingt es so, wie es klingt. Ein sehr sakraler Vibe, aber auch richtig nice.
»Wir haben alles Mögliche ausprobiert, um am Ende doch noch zusammenzukommen.«
MYP Magazine:
Im Vergleich zu Eurem ersten Album wirkt die Musik jetzt zwar zurückhaltender, dennoch hat die neue Platte einen ganz eigenen, grundsätzlich und erwachsen wirkenden Sound. Wie ist der musikalische Charakter dieses zweiten Albums entstanden?
Jeremias:
Wie ich eben bereits angedeutet habe: In den letzten Jahren wollten alle vier zunehmend etwas anderes. Das bezog sich auch auf die Musik. Der eine wollte sich vor den PC hocken und produzieren, der andere wollte nur Klavierballaden schreiben und wieder ein anderer wollte einfach ein Mikrofon in den Raum stehen und acht Minuten lang jammen. Aus diesen vielen Gelüsten hat sich langsam und über Monate das Album entwickelt. „Von Wind und Anonymität“ ist das Ergebnis eines langen Prozesses, in dem wir alles Mögliche ausprobiert haben, um am Ende doch noch zusammenzukommen und unsere Wünsche zu vereinen.

»Wenn man da den Berg hochgeht, rutscht man tausendmal ab und fällt auch hin und wieder auf die Fresse.«
MYP Magazine:
Im März habt Ihr euch für ein paar Wochen aus dem deutschen Noch-Winter ausgeklinkt und seid nach Fuerteventura geflogen. Dort sind diverse Fotos, Videos und Visualizer für das neue Album entstanden. Warum habt Ihr euch ausgerechnet für die Kanareninsel entschieden?
Jeremias:
Wir hatten einen Ort gesucht, der das Album visuell gut zusammenfasst. Das klingt vielleicht ein bisschen platt, aber Fuerteventura heißt übersetzt so viel wie „starker Wind“. Wir empfanden das als eine schöne Analogie zum Albumtitel. Außerdem hatten wir das Gefühl, dass die Insel mit ihren steinigen und weitläufigen Hügellandschaften gut zur Musik passt. Aber dass es am Ende so perfekt aufgehen würde, war für uns alle dann doch überraschend.
MYP Magazine:
Inwiefern?
Jeremias:
Unsere erste Platte, „Golden Hour“, wirkt aus heutiger Perspektive sehr weichzeichnerisch und jugendhaft. Die Musik war zwar nicht irrelevant, aber im Vergleich zu „Von Wind und Anonymität“ ein bisschen nichtssagend. Daher wollten wir versuchen, die Essenz des neuen Albums – dieses deutliche, teilweise abgefuckte und stark kontrastierte Wesen – auch visuell adäquat darzubringen. Und dafür war Fuerteventura perfekt. Wenn man da den Berg hochgeht, rutscht man tausendmal ab und fällt auch hin und wieder auf die Fresse.

»Für mich ist das Kindsein viel faszinierender als das Erwachsensein.«
MYP Magazine:
In Eurer Musik finden sich immer wieder Referenzen auf Eure Kindheit, etwa im Song „Wir haben den Winter überlebt“ oder im Musikvideo zu „Sommer“. Wie bemerkst Du an dir persönlich das Erwachsenwerden – und welchen Aspekte schätzt Du daran?
Jeremias:
Am meisten schätze ich die Unabhängigkeit und die Freiheit, die dieses Erwachsensein mit sich bringt. Aber ganz ehrlich? Eigentlich verteufele ich das auch. Oder besser gesagt: Ich mag es nicht so gerne. Sobald ich merke, dass ich irgendwo einen erwachsenen Eindruck mache, macht mich das ein bisschen traurig. Für mich ist das Kindsein viel faszinierender als das Erwachsensein. Als Kind ist man so losgelöst und einfach für sich, daran denke ich immer wieder gerne zurück. Aber unabhängig zu sein und für sich selbst entscheiden zu können, was man machen will, ist natürlich auch nicht uncool. (lächelt)

»Am liebsten genieße ich gerade die Stille.«
MYP Magazine:
Zu Beginn unseres Gesprächs haben wir über die emotionale Verbundenheit gesprochen, die Hörer*innen in Eurer neuen Platte finden können. Gibt es für Dich persönlich ein Album, das Dich in den letzten Jahren begleitet hat und Dir besonders am Herzen liegt?
Jeremias:
Mich hat „Am Wahn“ von Tristan Brusch sehr mitgenommen – das habe ich sogar eben noch im Taxi gehört. Dieses Album mag ich sehr. Und vor kurzem bin ich auf den Song „Die Freiheit“ von Georg Danzer gestoßen, den mag ich ebenso… (schweigt einen Moment) Mann, sorry! Eigentlich würde ich Dir gerne sehr viel konkretere Sachen nennen.
MYP Magazine:
Vielleicht ist das etwas so Privates und Intimes, dass man es in einem Interview nicht preisgeben sollte: Musik, bei der man seine Seele öffnet.
Jeremias:
Das stimmt. Es ist aber auch so, dass ich vor allem in den letzten beiden Jahren wenig Musik gehört habe. Am liebsten genieße ich gerade die Stille. Aus diesem Gefühl heraus habe ich auch den letzten Song des Albums geschrieben. Ist schon strange, oder? Ich bin erst 23 und suche jetzt schon die Stille. Ich weiß nicht, wie das mit 80 werden soll.
Mehr von und über JEREMIAS:
Interview & Text: Jonas Meyer
Fotografie: Maximilian König
Mit besonderem Dank an Franziska Kokocinski.
Fatoni
Interview — Fatoni
»Im Rap kann Wut als Antrieb sehr hilfreich sein«
Rapper Fatoni ist seit über zwei Dekaden im Geschäft, im deutschen Hip-Hop genießt er so etwas wie Legendenstatus. Wie sein aktuelles Album »Wunderbare Welt« beweist, hat der 38-Jährige immer noch etwas zu sagen: etwa zu den Erfahrungen des Älterwerdens; oder zu den gesellschaftlichen Diskursen unserer Zeit. Damit holt er nicht nur seine treuen Millennial-Fans ab, sondern auch viele aus der Generation Z. Wenige Wochen vor dem Start seiner Deutschland-Tour haben wir den gebürtigen Münchner in Berlin zu einem sehr persönlichen Gespräch getroffen: ein Interview über den Bruch mit alten Idealen, junge Leute, die alles nur noch cringe finden, und die begrenzte Macht von Musik gegenüber rechten Parolen.
12. Oktober 2023 — Interview & Text: Anna Kasparyan, Fotografie: Steven Lüdtke

»Es war total wichtig für mich, mit alten Idealen zu brechen.«
MYP Magazine:
Fatoni, deine aktuelle Platte besticht wieder mit etlichen Artist-Features, darunter etwa Tristan Brusch, MOLA, Danger Dan, Deichkind oder Max Herre. Wie wählst du aus?
Fatoni:
Dass ich die Leute cool finde, ist natürlich die Voraussetzung! Deichkind und Max Herre zum Beispiel haben mich in meiner Jugend stark beeinflusst, auch wenn ihre Musik eine ganz unterschiedliche ist. So sind die Features auf meinen Alben auch immer ein persönliches Statement.
MYP Magazine:
Auf vergangenen Platten hast du Max Herre noch gedisst…
Fatoni:
Max Herre ist ein Jugendidol von mir. Ich war sehr lange Fan von ihm, hatte dann aber eine kurze Phase, in der ich seine neuen Sachen doof fand. Es war in diesem Lebensabschnitt total wichtig für mich, mit alten Idealen zu brechen und so einen Held auch mal zu demontieren. Das ist aber lange her, mittlerweile entdecke ich wieder viele Motive aus meiner Jugend. Dass Max Herre und Deichkind auf der Platte sind, ist also Absicht. Obwohl ich schon lange kein Teenager mehr bin, ist das Album so etwas wie eine Coming-of-age-Platte.

»Wenn man als junger Rapper Leute disst, hat das viel mit einem selbst zu tun.«
MYP Magazine:
Wie konntest du deinen Frieden mit früheren Phasen schließen?
Fatoni:
Wenn man als junger Rapper Leute disst, hat das viel mit einem selbst zu tun. Nicht, dass man sie inhaltlich wack (Anm. d. Red.: umgangssprachlicher und vor allem im Hip-Hop geläufiger Begriff für blöd, lahm, schlecht) finden würde. Man ist eher frustriert, dass man es mit der eigenen Musik nicht zu so einem Erfolg schafft. Das führt zu Unzufriedenheit, die aber auch eine Motivation sein kann. Im Rap kann Wut als Antrieb sehr hilfreich sein.

»Vielleicht würde auch ich heute auch in eine Casting-Show gehen – allein fürs Geld!«
MYP Magazine:
Du rappst auch: „Wär doch schlimm, wenn ich nicht so geworden wäre, wie ich niemals werden wollte.“ Woran merkst du, dass sich deine Haltung zu Themen über die Jahre verändert hat?
Fatoni:
Vor zehn Jahren einen Witz über Max Herre zu machen, weil er als Juror in einer Casting-Show war, empfand ich damals als passend. Aus heutiger Sicht wirkt das vielleicht etwas hängengeblieben. Ich finde meinen Fokus von damals eher komisch. Vielleicht bin ich jetzt aber auch eher in einer Position wie Max Herre damals. Und vielleicht würde auch ich heute auch in eine Casting-Show gehen – allein fürs Geld! Es ist auch easy, über solche Jobs zu witzeln, wenn man 28 ist und denkt: Dieses Angebot wird für einen selbst niemals kommen. Es ist in der eigenen Realität gar nicht vorhanden. Wenn ich ehrlich bin, war ich eigentlich nur unzufrieden mit meiner eigenen Karriere.
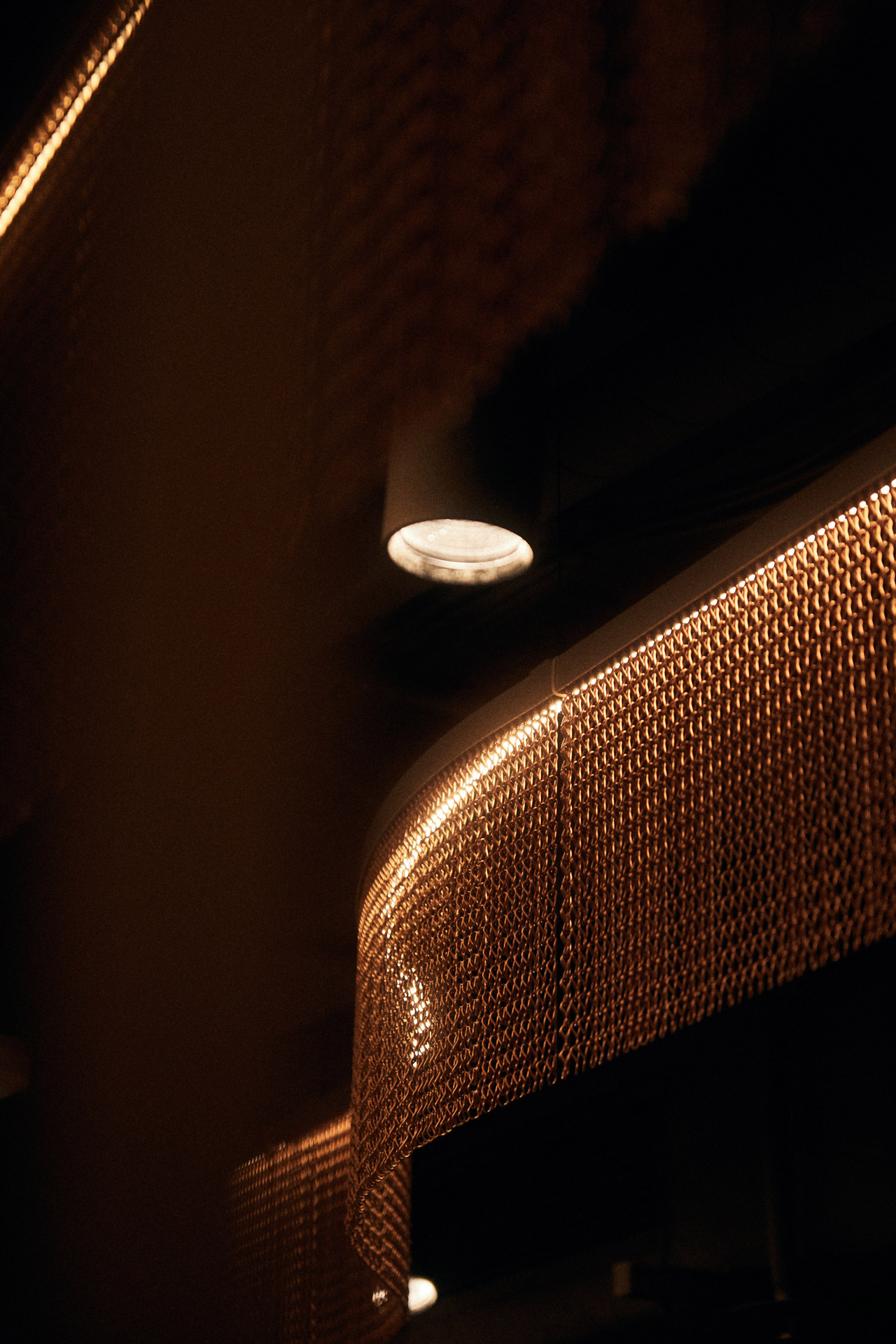
»Früher hatte ich immer Schiss, mir einen Korb abzuholen.«
MYP Magazine:
Denkst du gerade über neue Kollaborationen nach?
Fatoni:
Sophie Hunger wäre ein Traumfeature. Auch im Deutschrap gibt es gerade tolle junge Künstlerinnen, aber ich sehe aktuell nicht, was man da zusammen machen könnte. Trotzdem bin ich zum Beispiel ein Fan von Paula Hartmann und Nina Chuba. Und dann habe ich vor kurzem DJ Koze auf Instagram geschrieben. Früher hatte ich immer Schiss, mir einen Korb abzuholen. Mittlerweile ist mir das egal. Es tut zwar weh, aber ich denke mir: Ich bin 38 Jahre alt – warum sollte ich rumeiern? Er hat auch zurückgeschrieben und gesagt, dass er sich gerade um sein Album kümmern muss, aber wir danach was starten können.

»Es ist immer eine Frage von Erfolg und finanziellen Möglichkeiten, ob man seine Visionen umsetzen kann oder nicht.«
MYP Magazine:
Hast du jemals Angst, deine Kreativität zu verlieren?
Fatoni:
Ja, schon manchmal. Auch, weil es immer eine Frage von Erfolg und finanziellen Möglichkeiten ist, ob man seine Visionen umsetzen kann oder nicht. Es ist unmöglich, alles allein zu machen, und ich kann bereits jetzt nicht alles umsetzen, worauf ich Bock habe. Vielleicht auch, weil ich nicht den Elan oder den Wahnsinn habe. So wie die Künstlerin Mine, mit ihren krassen Shows und dem Riesenorchester. Was Mine auf die Beine stellt, ist einzigartig und sehr beeindruckend. Viele Projekte sind nur möglich, wenn man wahnsinnig erfolgreich ist – oder nicht abhängig ist vom freien Markt. Etwa, weil man staatlich subventioniert wird für die Shows.

»Wenn ich auf der Bühne vor den Leuten stehe, trägt mich das am meisten.«
MYP Magazine:
Was treibt dich voran?
Fatoni:
Was ich neben dem Rappen und der Musik am spannendsten finde, ist das Unvorhergesehene: das, was bei den Shows auf der Bühne dazwischen passiert oder davor. Ebenfalls spannend finde ich es, mit den Leuten zu kommunizieren. Ich rede darüber eher selten und es fällt mir auch jetzt schwer, das in Worte zu fassen. Ich denke, dass ich vor allem Leute unterhalten kann. Wenn ich auf der Bühne vor den Leuten stehe, trägt mich das am meisten – da bin ich in the zone.

»Ich dachte lange nicht, dass die Sache mit der Musik funktionieren würde.«
MYP Magazine:
In deinen Texten thematisiert du oft deine Münchener Herkunft, die herausfordernde Schulzeit oder die Entscheidung, dich voll und ganz auf die Musik zu konzentrieren. Wenn du heute einen Blick zurückwirfst: Kannst du Lebensentscheidungen skizzieren, die du für unabdingbar hältst – weil sie dich an den Punkt gebracht haben, an dem du jetzt bist?
Fatoni:
Diese Entscheidung habe ich nie wirklich bewusst gefällt. Ich hab’s einfach gemacht. Ich dachte lange nicht, dass die Sache mit der Musik funktionieren würde. Genauso wie ich nie gedacht hätte, dass ich jemals die Position in der Musikwelt erreiche, in der ich heute bin. Aber jetzt will ich natürlich mehr. Ich hatte in den Anfangsjahren mehrere Jobs, die fast schon Berufe waren. Dass ich diese nicht weiter verfolgt habe, lag aber nie daran, dass ich darauf gesetzt habe, dass das mit der Musik letztendlich besser klappen würde. Ich habe es einfach gehasst, diese Berufe auszuüben – ich hatte also keine andere Wahl.

»Damals dachte ich: Das Theater ist jetzt mein Lebensentwurf, das wird meine Karriere.«
MYP Magazine:
Hast du dafür ein Beispiel?
Fatoni:
Nach der Schauspielschule bin ich am Theater gelandet. Damals dachte ich: Das ist jetzt mein Lebensentwurf, das wird meine Karriere. Eigentlich ein Traumberuf, aber ich fand’s wirklich schlimm. Ich hatte fast ein Burn-out und bekam krasse psychosomatische Beschwerden, Bauch- und Kopfschmerzen. Und das über Monate! Es ging einfach nicht mehr. Ich konnte da nicht mehr bleiben, ich hab’s so sehr gehasst. Es ist zwar nicht so, dass ich das Theater an sich hasse, aber die Umstände waren für mich falsch. Fest an ein Theater werde ich wohl nie wieder gehen. Ich hatte sogar kurz überlegt, wieder zu kellnern. Die Gastro fand ich von all den Nebenjobs eigentlich am coolsten – weil man mit normalen Menschen spricht und meiner Erfahrung nach auch weniger Intrigen oder irgendwelche Spielchen aushalten muss.

»Manchmal frage ich mich, ob diese Sphäre des Angekommenseins überhaupt existiert.«
MYP Magazine:
Wie identitätsstiftend ist es jetzt, auf der Musikbühne zu stehen?
Fatoni:
Es ist immer Teil der Identität, wenn du etwas machst, das du machen willst – und du auch noch Erfolg damit hast. Aber ich wüsste nicht, wie es wäre, wenn’s nicht so wäre. Und privat bin ich natürlich auch nicht immer der Performer. Ich glaube, was sich durch meine Texte zieht, weil ich oft darüber rede, ist das Ankommen. Oder besser: das Gefühl zu haben, noch nicht angekommen zu sein. Manchmal frage ich mich, ob diese Sphäre des Angekommenseins überhaupt existiert.
MYP Magazine:
Alter scheint für dich eine wichtige Rolle zu spielen. Wieso?
Fatoni:
Ehrlich gesagt denke ich darüber viel zu viel nach. Es gab mal eine sehr coole Kritik in der Wochenzeitung „der Freitag“, in der eine tolle Journalistin darüber schrieb, dass es nerve, dass ich immer übers Älterwerden rappen würde. Tatsächlich hat sie dann im Artikel diverse Songs aufgezählt, in denen ich das thematisiere. Das hat mir gezeigt, dass ich beim nächsten Album nicht mehr so lächerlich viel darüber schreiben sollte. Andererseits kann mich wahrscheinlich nie komplett davon freimachen, da ich ja tatsächlich ständig älter werde. Und in diesem Prozess wird es immer wieder neue 20-jährige Rap-Stars geben. Dabei muss man selbst schauen, ob man den neuen Trends standhält und bleiben kann.

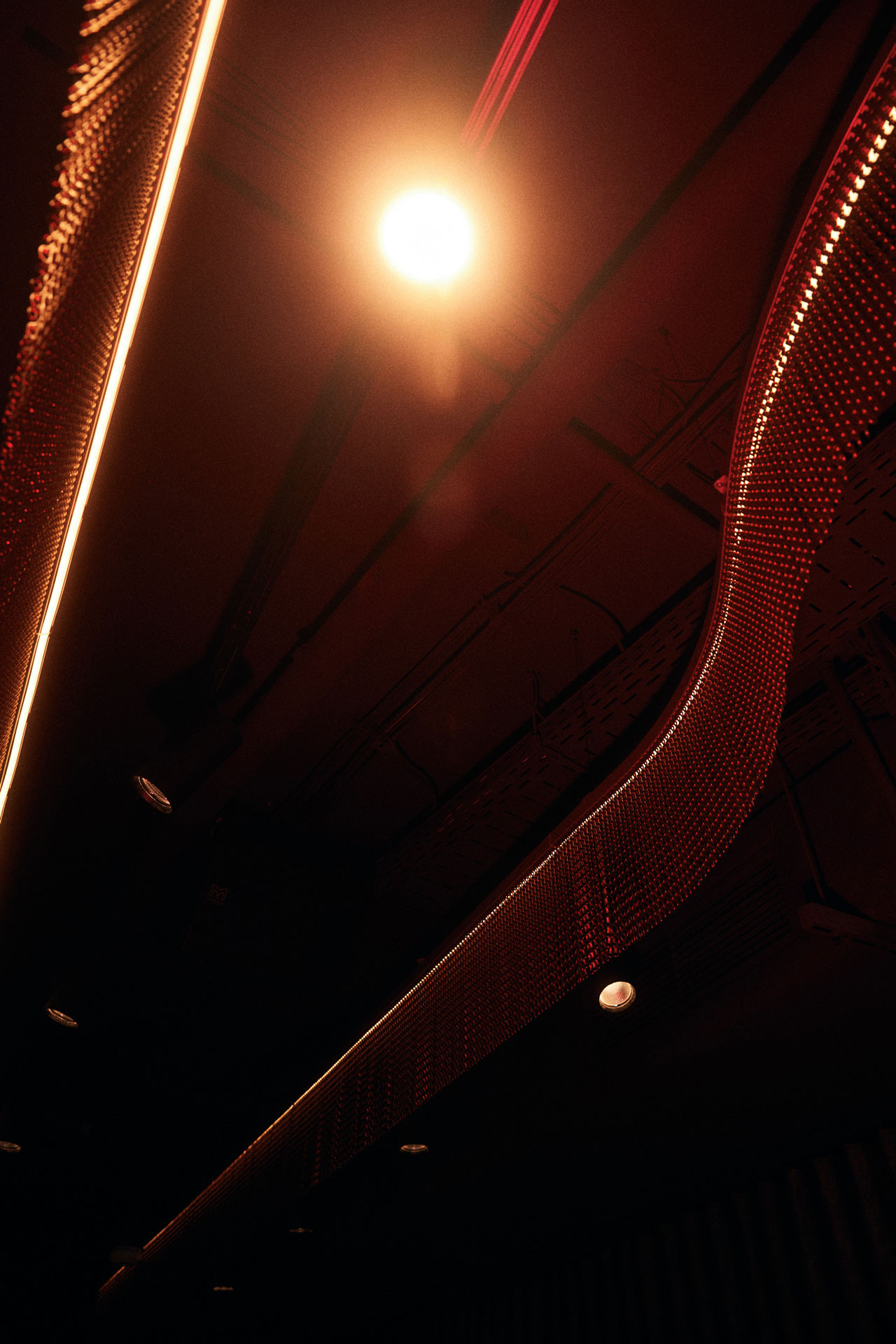
»Ich habe das Gefühl, die junge Generation ist sehr von der Coolness-Frage vereinnahmt.«
MYP Magazine:
Wie blicken die jüngeren Kolleg*innen dann auf dich?
Fatoni:
Neulich hat mir ein jüngerer Künstler gesagt, der früher oder vielleicht auch heute noch Fatoni-Fan ist: „Ich fühle deine Texte so hart. Du bist zwar mega cringe, aber halt auch mega cool.“ Ich habe das Gefühl, die junge Generation ist sehr von der Coolness-Frage vereinnahmt. Es geht oft darum, sich dadurch abzugrenzen, alles und sich gegenseitig cringe zu finden. Und cringe ist ja auch gleichzeitig cool, aber irgendwie ist auch nichts cool, da habe ich etwas den Anschluss verloren. Ich denke mir lieber: Ist doch egal. Wenn sie nach zehn Jahren auf ihre Fotos blicken, sollen sie sagen: „Das war ‘ne geile Zeit, aber Vokuhila ist schon mega cringe.“

»Ich glaube aber nicht, dass ich mit meinem Text einen Klimaleugner oder eine AfD-Wählerin umdrehen kann.«
MYP Magazine:
Wir leben aktuell in unruhigen Zeiten: Multiple Krisen folgen aufeinander, der Populismus erstarkt in Europa – auch in deinen Songs spielen Systemkritik und Gesellschaftssatire immer eine große Rolle. Was macht dir Mut?
Fatoni:
Boah! Ich traue mich gar nicht, darauf zu antworten. Die meisten Künstler*innen – und dazu zähle ich mich auch – haben keine Lösungen. Ich kann Probleme nur komprimieren und thematisieren. Daher habe ich viel mehr Respekt vor Leuten, die Realpolitik machen. Das sehe ich nicht für mich, was für ein krasser Kampf! Was kann man mit Musik schon bewirken? Es kann höchstens einer gewissen gesellschaftlichen Bubble das Gefühl geben, dass man nicht allein ist. Jede*r kennt das Gefühl, wenn Künstler*innen genau das ansprechen, was uns individuell wichtig ist. Ich glaube aber nicht, dass ich mit meinem Text einen Klimaleugner oder eine AfD-Wählerin umdrehen kann. Ich bringe die nicht mal ansatzweise zum Denken. Die würden meine Songs auch direkt wieder ausmachen – so wie ich die Mucke von Rechten nicht hören würde.

»Du siehst dir ein kapitalismuskritisches Theaterstück an. Aber dann bestellst du in der Nacht noch schnell auf Amazon.«
MYP Magazine:
Was gibt dir persönlich Mut?
Fatoni:
Eigentlich gar nichts, ich verdränge eher. Vor allem die Klimakatastrophe, aber auch die neuesten AfD-Umfragewerte. Da habe ich zum ersten Mal seit 2016 gedacht: Krass, ich sehe es zwar immer noch nicht, dass die AfD die Regierung stellt. Aber in Italien zum Beispiel gibt es mittlerweile schon eine rechte Regierung, das ist dort pure Realität und sehr beunruhigend. Kultur kann dem im Allgemeinen wenig entgegenstellen, sie ist zu weiten Teilen Unterhaltung. Du hörst Musik, die dich angesprochen hat, und siehst dir dann ein kapitalismuskritisches Theaterstück an. Aber dann bestellst du in der Nacht noch schnell auf Amazon. So ist das eben.

Fatoni: „Wunderbare Welttournee“
31. Oktober 2023 bis 26. Januar 2024, alle Termine und Tickets hier
Mehr von und über Fatoni:
Interview & Text: Anna Kasparyan
Fotografie: Steven Lüdtke
Mit besonderem Dank an:
The Alchemist Bar & Restaurant
Linkstr. 4, 10785 Berlin
Stephen Sanchez
Interview — Stephen Sanchez
»I feel like music should help you learn from each other«
With his emotive and soulful music, Stephen Sanchez takes his audience on a journey back in time to the 1950s and 1960s. Yet, the young musician from Nashville is anything but a sentimentalist who glorifies the past. We met him for an interview about his debut album »Angel Face,« about music that feels like a warm hug, and a time when non-white artists had to use music to make themselves heard in the face of adversity and pervasive racism.
22. September 2023 — Interview & text by Jonas Meyer, photography by Stefan Hobmaier

Nostalgia is a perilous emotion. We often gaze back with a certain melancholy at the apparent glory of days long past, yearning for the return of the good old times. Yet, all too willingly, we forget that the past was far from perfect – especially concerning the socio-political circumstances that meant injustice, lack of freedom, and oppression for many people.
But who can truly blame us for occasionally indulging in nostalgia? It’s also undeniably tempting. Consider the 1950s and 1960s, for instance: From today’s perspective, everything possessed a distinct style, particularly in terms of fashion. People wore elegant suits instead of sweatpants, enjoyed leisurely meals rather than fast food, and, when dating, had to make a physical approach instead of swiping through an app. And just think of all the music legends this era has produced!
So, how can we indulge in nostalgia without feeling guilty? Stephen Sanchez sets an example. Born in 2002 and raised in Sacramento, California, he unveiled his musical talent to the world about three years ago when he released his single “Lady by the Sea.” Almost overnight, it skyrocketed on TikTok, turning his life upside down in the blink of an eye. Even though Stephen’s music and demeanor are deeply rooted in the style of the fifties and sixties, he is simultaneously a representative of the present — a modern young man with a wholly unfiltered and reflective view of the world.
That this young man is a serious music artist and not just a fleeting social media phenomenon became clear, especially after none other than Sir Elton John declared himself as his advocate and fan. The British music icon, known for consistently nurturing young musicians, recently bestowed a distinct honor upon Stephen: On June 25th, during the final UK performance of his career, Elton John invited several guest stars onto the stage at the renowned Glastonbury Festival, and among them was Stephen Sanchez.
Originally, the plan was for the two to perform Elton’s song “I Guess That’s Why They Call It the Blues” together. But the pop giant made a spontaneous change. He wanted Stephen to play one of his own songs when inviting him onto the stage. Thus, the young man found himself performing his hit “Until I Found You” in front of a quarter of a million people.
Just a few days after this memorable performance and a couple of weeks prior to the release of his debut album “Angel Face,” we met the Stephen for an interview and a casual photoshoot at the headquarters of Universal Music Germany.


»Performing in front of so many people is something you don’t come down from quickly.«
MYP Magazine:
It was just three days ago that you were on stage with Elton John, performing in front of 250,000 people. How do you feel right now? Did you find it challenging to return to everyday life?
Stephen Sanchez:
I’m still buzzing from that experience and riding a high. Performing in front of so many people is something you don’t come down from quickly. I’m a person who can’t wait to get out and play shows anyway, but that experience has made me even more excited for the upcoming things — by which I mean the release of my debut record and a big tour for my band and me.
MYP Magazine:
What does it mean to you when someone like Elton John — an artist who has achieved everything in the music business — supports young musicians and talents like you?
Stephen Sanchez:
That gives me a lot of affirmation about what I’m doing. It makes me feel like I can do anything. Even though there are people in my personal life who make me feel like I could achieve anything, it’s pretty amazing to have someone like him champion me. I mean, Elton John is a hero, a music industry icon who has had a career spanning half the past century. I’m very grateful that such a person appreciates the music I’ve created, even though he doesn’t really know me. And by the way: I’ve never heard of Elton bringing anybody out to sing their own song in the middle of a set. That’s just incredible.

»I do feel a bit of pressure, but it’s not a pressure I’m afraid of.«
MYP Magazine:
In September, you are going to release your first album. Do you feel any pressure now that half the world already seems to be celebrating your music?
Stephen Sanchez:
I do feel a bit of pressure, but it’s not a pressure I’m afraid of, actually. I mean, the music industry is extremely different now. There are a lot of artists in their twenties with access to creating music. Whether they are really great or really bad, it’s kind of hard to push your own project through all the mess and be recognized as something truly great. So, I don’t feel weird. I feel like I’m exactly where I’m supposed to be. Putting this record out could be an amazing thing to watch happen.

»Having music that people can sit down and listen to all the way through, and find meaning in it at the end, is crucial.«
MYP Magazine:
What does it even mean to release an album with 13 tracks in the age of Instagram and TikTok, where sometimes only seconds decide about the success or failure of a single song?
Stephen Sanchez:
It’s exciting for me because this new record is a conceptual album. There’s a story to it, there are characters to it, and I think that makes it more digestible. Each song can stand on its own and speak for itself. It doesn’t rely on other songs to be great. I believe there’s importance in that. Having music that people can sit down and listen to all the way through, and find meaning in it at the end, is crucial — and that’s hopefully the same with my record. I think the world needs more of that because it truly helps. Just like when you watch a movie, you immerse yourself in the character’s shoes, feelings, experiences, and circumstances. It’s important for self-reflection on your own life: Ideally a movie helps you to see your own and understand yourself — and music functions the same way.
»Movies serve as a catalyst for evoking memories, which is wonderful because the same applies to music.«
MYP Magazine:
Movies are a good keyword. When listening to your music, it often feels like being immersed in a film scene, such as with the song “Death of the Troubadour,” characterized by a distinctive cowboy-Western sound. What role does Hollywood culture play for you when you’re crafting songs?
Stephen Sanchez:
I believe movie culture, in general, helps me bring out my emotions. I tend to watch movies that remind me of someone because I’ve watched those films with them. It’s like they trigger those memories. Then, later on, I can revisit those memories and write about them because they’ve been on my mind all day, you know? So, I think movies certainly serve as a catalyst for evoking memories, which is wonderful because the same applies to music. Everything is tied to memories. I can definitely say that certain movies have influenced my songwriting to some extent. However, I consider them as non-specific influences that remind me of someone I care about — no more, but no less.


»I feel like the music of the fifties and sixties was written for the future.«
MYP Magazine:
Your music and style evoke associations with a bygone era of music history. What particularly captivates you about the pop culture of the 1950 and 1960s?
Stephen Sanchez:
I feel like the music of the fifties and sixties was written for the future. It’s so timeless and still so universal because it’s riding on one concept, which is, for example, “I’ve lost her,” “my heart’s broken”, “I love her and I’m going to keep loving her,” or “I was a fool for you and now I don’t know what to do.” Or simply said: themes that are universally digestible.
To me, this music is so special because it’s straightforward. It doesn’t try to be dirty, provocative, or showy. It’s simple and direct, like saying, “I’ve made a mistake and I still love you.” There’s a beauty in that simplicity. Even in moments of struggle, there’s a certain elegance. For instance, Patsy Cline’s song “Walking After Midnight” is about her searching for her drunk husband after midnight and bringing him home as he cries over her. It’s incredibly powerful. I adore this straightforwardness; it holds a deep richness within its simplicity.

»Artists like Elton John still add value to the industry — and to society.«
MYP Magazine:
When this music was written about the future, would you say that today’s music is written about the past?
Stephen Sanchez:
Hmm, that’s an intriguing question. Maybe. Or it might be that this music is needed now because of its simplicity and the deep layers present in its songwriting. It’s almost like a blueprint for certain things, like how to love someone, how to apologize sincerely.
Nowadays, there doesn’t seem to be as much coherence in music. There isn’t much that’s significantly contributing to the world in a novel way, something that hasn’t been experienced to some extent already. You know, the music that has existed continues to contribute because it’s ingrained in our culture, like the music of the fifties, sixties, and rock and roll. Artists like Elton John still add value to the industry — and to society. However, we’re currently in an era of rapid releases, often filled with explicit content, drugs, or violence. It’s not really about laying a foundation, about showcasing the essence of being human and how to connect with each other. It mostly reflects what’s already present, lacking profound depth.
MYP Magazine:
Would you say we’ve lost focus?
Stephen Sanchez:
Yeah, definitely. I feel like music should teach you something. It should help you learn from each other and bring yourself closer to one another. Even though music in general has always done that, I think more and more often we just rely on the hype that is made about some things.

»We still have much to improve as a society.«
MYP Magazine:
On you Instagram page you say: “Welcome to 1964!” What were the strengths and weaknesses of that time? Or to phrase it differently: What do you miss from the sixties in today’s world? And what aspects of that period are you glad we left behind?
Stephen Sanchez:
Well, obviously, misogyny stands out as a significant issue. Unfortunately, racism continues to persist widely, and misogyny still exists to some extent. However, during that period, these negative aspects were deeply ingrained and normalized. Today, there’s at least an acknowledgment and a pushback against misogyny and racism in our culture. That’s a positive development. Yet, we still have much to improve as a society. It’s encouraging that these issues are no longer as accepted in mainstream American culture, but as long as they still exist, we have a considerable amount of work ahead of us.
MYP Magazine:
In 2020 you moved to Nashville. Why is it important for you as a young musician of the digital age to be physically on the spot?
Stephen Sanchez: (smiles)
It was kind of an accident, to be honest. I couldn’t afford to live in New York or L.A. back then, and my parents were moving to Nashville. Additionally, I had friends already in the city. So, things naturally led me there. I believe it’s a fantastic music community with wonderful people and artists who are truly inspiring — and who genuinely support each other instead of getting caught up in egos. Everyone’s focused on being there for one another, and that’s heartwarming. I’ve gained a lot from being in that environment.

»I’m drawn to that aspect of nostalgia — witnessing people using music to regain their voices in the face of adversity.«
MYP Magazine:
In the United States, we are currently witnessing a society divided between those who aim to preserve the past and those advocating for socio-political progress. Does it bother you that some factions of society manipulate the term “nostalgia” to further their own agendas?
Stephen Sanchez:
When I experience nostalgia, it’s for the positive aspects of that era, such as the cars, music, and rock and roll. I appreciate these elements because they hold significance. I also find inspiration in artists from that time, especially African-Americans who used music as a means of expression, given their voices were suppressed due to the pervasive racism in America. It was more than just creating love songs; it was a way of life. I’m drawn to that aspect of nostalgia — witnessing people using music to regain their voices in the face of adversity. That’s what matters to me.
So, I can only share my perspective and can’t speak for others as I am not in their shoes. However, anyone who promotes divisiveness and mistreats another culture due to personal preferences is, in my view, in the wrong. I believe in unity, and I feel like we should all come together as a society.

»If I were ever to lose someone, the music would be the outcome.«
MYP Magazine:
It seems that there is often a certain melancholy to your music. Do you consider yourself a melancholic person?
Stephen Sanchez:
Um, to some extent, I believe so. I think romance embraces both sides of the spectrum. I consider myself a strong romantic, and within that, there’s a sense of hopelessness as well as hopefulness. These two aspects constantly compete. So, I believe there’s undoubtedly a touch of melancholy in all things I’ve composed and sung about. However, there’s always a counterbalance. For instance, if I were ever to lose someone, the music would be the outcome. I can confidently say that.

»Love demands hard and substantial effort because human beings are complex.
MYP Magazine:
In the song “No One Knows” you sing: “No one knows the trouble, honey, that we’ve been through.” Are you someone who prefers to deal with heartbreak and relationship problems with yourself?
Stephen Sanchez:
Obviously, “Until I Found You” is about a specific person. I wrote that song when I was 18 while I was going through the breakup. However, if I were to be in a relationship now and faced a breakup, I would keep the details within the both of us. They wouldn’t spill out into the public space. Yet, in writing songs like that, I aim to convey that love can be challenging. It’s not always a simple case of instant puppy love. Love demands hard and substantial effort because human beings are complex.
Nevertheless, the outcome of this hard work is something incredibly beautiful — a healthy and happy relationship with someone who truly understands and sees you. I believe unless you navigate through difficulties and reveal your less-than-perfect self to someone, you discover that you’re not so different after all. You learn to love and appreciate those aspects of each other, wanting to comprehend and embrace the full spectrum rather than just the surface-level affection. So, in songs like “No One Knows,” the lyrics express a dual sentiment: “I love you, but also I struggle with these aspects of you.” The message is about choosing to accept both the flaws and the strengths of a person and of oneself, seeing them as equally valuable. Everyone should love both of those things as if they were the best.

»Love is about deciding on something and sticking with it.«
MYP Magazine:
Your music extensively explores the theme of love. Would you argue that this topic is the primary reason for the existence of music itself?
Stephen Sanchez:
Absolutely! I believe it’s about the pursuit of something, and love represents that pursuit. However, this concept isn’t confined solely to romantic love. It includes many more facets. If we consider love as a pursuit, then it’s the pursuit of one’s identity, one’s independence, one’s self-expression. Love manifests in all these aspects. It’s not limited to romantic relationships; it can revolve around countless other subjects. Whether it’s directed at a person, an object like a car or a home, or even the act of going out and having fun. (smiles) It’s quite profound, really. I mean, everything is pretty much a love song just to a degree — because love is about deciding on something and sticking with it.
»The idea of being homeward bound resonates deeply with me. It’s like a big warm hug.«
MYP Magazine:
What music can you personally escape to when you need a big hug?
Stephen Sanchez: (laughs)
Oh, man! A hug?!
MYP Magazine:
Isn’t that what music is all about? Being hugged?
Stephen Sanchez:
Yeah, well, I really love that, I’ve never really thought of it in that perspective before. Lately, I’ve been quite drawn to artists like Glen Campbell and Cat Stevens — artists with a comforting and hugging singer-songwriter style. I also just have to think of the song “Homeward Bound” by Simon & Garfunkel. It’s about yearning to return home, reflecting on one-night stands in various cities while on tour. The song captures the feeling of transience and the desire for a deeper connection. The idea of being homeward bound, going back to the person you love, resonates deeply with me. It’s like a big warm hug. Any song that revolves around this theme exudes a sense of comfort and tenderness in my opinion. The thought of heading back, all by yourself, evokes the feeling of a warm embrace as it brings to mind thinking about someone special.

»I’m now much better at expressing my love for someone outside of the musical world.«
MYP Magazine:
What would you say you can you express through your music that you can’t convey in an ordinary conversation?
Stephen Sanchez:
I feel like I’ve gotten better at expressing my feelings. When I was younger, I was using music for that. As I’ve met people in my life, such as the guys in the band and someone very dear to me, they’ve shown me that it’s totally okay to express your emotions and to experience them deeply. This was something I lacked while growing up; I didn’t have that sense of emotional security. Now, I find myself capable of communicating clearly.
In essence, I’m a blend of both. I find it more exquisite to sing a love song and let my emotions flow through music. It’s definitely my preferred method. However, I think I’m now much better at expressing my love for someone outside of the musical world. It’s a more profound form of connection. Yet, music remains a powerful means of expression, a very significant one, and it’s still my favorite.

With special thanks to David Groß from Universal Music Germany for his empathy, patience, and weeks-long efforts.
Sometimes it’s those outside the spotlight who shine the brightest…
More about Stephen Sanchez:
Interview and text by Jonas Meyer:
Photography by Stefan Hobmaier:
Teddy Swims
Interview — Teddy Swims
»The older I get, the further I move from who I thought I was«
With »I've Tried Everything But Therapy (Part 1)« Teddy Swims presents his long-awaited debut album — a record that the vocal powerhouse from Atlanta has linked to a very special promise to himself. We met the warm-hearted and approachable artist in Berlin for a deeply personal interview: a conversation about mental health, the advantages of being a grown man, and the musical magic of Georgia.
15. September 2023 — Words by Jonas Meyer, photography by Maximilian König

In life, there are two types of encounters: those that fade after a short time, and those that linger in our memories for a long while. The encounter we had last Saturday in July definitely falls into category 2 — but not because it took place at Hole 44, a quirky venue on the southern outskirts of Berlin that appears more like a car workshop from the outside but has been hosting the most interesting music acts for some time now. Rather, it’s because we had the privilege to meet a human being whose approachability, warmth, and sincerity left a lasting impression on us.
The individual in question goes by the name Teddy Swims and is legally known as Jaten Dimsdale. How he’s addressed is of little concern to the 30-year-old. In any case, Teddy aka Jaten is unreserved and, after a brief yet friendly greeting, cheerfully leads us to the backstage area on the first floor, where we settle down on a small couch for the interview. Meanwhile, a dozen guys downstairs are setting up the band equipment on the stage, as the singer-songwriter, who is currently among the most hyped musicians in both the analog and digital realms, will be performing one of his few concerts in Germany here in a few hours.
The previous evening, Teddy Swims could be seen in Hamburg — or more accurately, could be heard, because his voice is nothing short of a force. Although we don’t typically resort to using press text terminology, we must make an exception here, for there’s no better way to describe this voice than with the term “vocal powerhouse.”
That Teddy would one day grace the stages of the world and generate millions of streams on the internet was by no means predestined for him. Jaten Dimsdale was born and raised in Atlanta, Georgia, as the grandson of a Pentecostal pastor. During his childhood and youth, he focused on football for many years before discovering musical theater, and then went on to play in several bands from high school onward, spanning genres from 80s glam metal, funk, modern metalcore, and soul to alternative country.
However, he truly gained recognition when he started covering famous songs on YouTube in 2019, including Lewis Capaldi’s “Someone You Loved” and George Michael’s “I Can’t Make You Love Me.” These videos were so successful that in early 2020, Warner Music took notice and signed him. After releasing numerous singles, his long-awaited debut album titled “I’ve Tried Everything But Therapy (Part 1)” was finally published today on September 15th — an album that Teddy has linked to a very special promise to himself…

»As I grow older, I think that everyone would benefit from therapy, myself included.«
MYP Magazine:
Teddy, your new record sounds like a basket full of soul and groove. Is there a specific personal emotion from which you wrote the album?
Teddy Swims:
I believe this record simply reflects the ups and downs of coping mechanisms I use in my life. When I came up with the title, “I’ve Tried Everything But Therapy,” I had in mind that the young generation of our time is the first one that is really openly talking about mental health and ways we can deal with issues like depression. As I grow older, I think that everyone would benefit from therapy, myself included. However, I feel that it’s still very hard for me to motivate myself to do it for whatever reason, even though I know it would be good for me. Maybe the reason lies in the way I was raised — I just feel like I’m terrified of going, you know?

»This album is my first step into trying to accept that some things are out of my control.«
MYP Magazine:
So, you’ve literally tried everything but therapy…
Teddy Swims:
Indeed, I haven’t tried it yet. But this album is my first step into openly discussing my own mental health with the world and engaging in sincere conversations about the ways I cope with things. Whether it’s drinking a lot of tequila, biting my nails or cheeks, or having any other tics, I have specific ways of dealing with things. However, as I already mentioned, there’s a deep-seated fear within me when it comes to considering therapy. Maybe it’s because I’m afraid of getting answers to questions I didn’t even want. That’s why this album, for me, is my first step into trying to accept that some things are out of my control; and that I can openly talk about my insecurities and hopefully be candid about my issues. By the way, I made a promise to myself that when the album comes out, that’s when I’ll start therapy. I’ll allow myself just a few weeks of fear, and then I’ll finally face it. (laughs)
MYP Magazine:
But don’t be afraid — be excited! Therapy can significantly improve your life.
Teddy Swims:
I believe I’ll feel that way. However, for some reason, something has been preventing me from pursuing it for many decades now. I don’t know what it is. That’s why I’ve made this promise to myself. And I think if I can share these thoughts right now, perhaps it will encourage someone else to take that step towards getting help too.


»To any parents out there: You should recognize the power you give your kids by allowing them to pursue their dreams.«
MYP Magazine:
Your father introduced you to soul music when you were a little boy. Would you say that was the point when you actually started creating your first album?
Teddy Swims:
I guess I always wanted that. I remember hearing Keith Sweat, Al Green, or Boyz II Men for the first time and just thinking, “God, I want to be that too!” I mean, I’ve never heard music like Al Green’s before. The moment I heard his voice, I was convinced that I would never forget it. And I still haven’t to this day — it changed me forever.
My dad raised me on a lot of good soul music, but he also introduced me to other genres like old hip hop, as well as country music from artists like George Strait and Alan Jackson. I really have to thank my dad a lot for my music taste, and he’s also the first person who encouraged me to become an actual musician. When I was 19, I was attending cosmetology school to learn about hair. He told me, “Son, if you want to pursue music as your career, you need to drop out of school immediately and focus on this without a backup plan.” He added, “Believe me, this is going to work.” I followed his advice, and now I’m here.
That’s why I’m so grateful to my dad. All I personally needed was his support; I just needed his permission to chase my dream, which meant dedicating my life to making music. He was completely supportive and just said, “Go for it, baby.” To any parents out there: You should recognize the power you give your kids by allowing them to pursue their dreams.

»Some of the best music ever, from every walk of life, has emerged from Georgia.«
MYP Magazine:
You were born and raised in Atlanta, Georgia. How did this place shape your understanding of pop culture and music in particular?
Teddy Swims:
Well, I’m very fortunate. You know, all the guys you see here today, the people touring with me, they’re all my best friends from school. For instance, there’s a guy named Jessie who has been my best friend since I was in sixth grade. His dad was the first person I knew who played guitar and sang. He used to be in bands, and we spent a lot of nights at his house when he was downstairs in the basement rehearsing old rock songs with his band. He introduced me to all the cool rock shit, like Van Halen or Pink Floyd. That also had a significant impact on my musical upbringing.
And just being from Georgia in general, a lot of country music comes out of Georgia, while hip hop largely originates from Atlanta. I mean, we had T.I., we had Jeezy, we had OutKast! There are numerous hip hop artists and soul musicians as well. Legends like James Brown, Otis Redding, and Ray Charles came from Georgia, among others. So, I would say that some of the best music ever, from every walk of life, has emerged from Georgia. It’s the most beautiful melting pot. I think just culture and people in general, I love it there.

»When I used to play in metal bands, literally the best way to express anger was to scream.«
MYP Magazine:
Wikipedia says: “Jaten Dimsdale is an American singer-songwriter, known for blending genres including R&B, soul, country, and pop.” That sounds like an old winemaker who blends a special cuvée from many different grapes. What is so charming about this way of making music?
Teddy Swims:
I love that comparison. I never really think about the genre when I’m in the process of making music. I just focus on which sounds would best help convey the emotion. And maybe certain genres are more suited to certain emotions than others. When I used to play in metal bands, literally the best way to express anger was to scream. You can’t really channel that level of anger in R&B, you know? But at the same time, in metal, you can’t really express love in the way you can in R&B or talk tenderly about the love of your life. And if you want to tell a compelling story in the right way, you have to lean more towards country, as it allows you to convey a chronological narrative. I believe that certain genres or styles of music are more adept at conveying specific emotions you want to portray. I’m always striving to match the emotion I want to express with the song’s style or genre, as they naturally align with that emotion.

»When I first opened my mouth, I wasn’t very good at it.«
MYP Magazine:
You grew up in a football-crazy family and played yourself for many years before discovering your passion for musicals and theater. What have these different worlds imparted to you for your life today? What experiences and lessons can you draw upon?
Teddy Swims:
I remember when I first got into musical theater, I went to my mom and said, “I think I don’t want to play football anymore. I just want to do this — only this.” Her response consisted only of crying and more crying. She said, “You’ve been playing football since you were six years old. Why would you do this?” She was so hurt by it. But I recall the first musical theater performance I did. I mean, I only had like two lines to say, but she heard me and she just said, “Maybe this is where you belong. This is your superstar moment.” I think in American Football, I wasn’t going very far at a height of 5’7’’ anyway. (smiles)
To be honest, becoming a musician wasn’t easy for me either, at least in the beginning. When I first opened my mouth, I wasn’t very good at it. Even though I improved my singing over time, I had actually fallen more in love with the process, the acting, and the emotions that come alive on stage. I just loved that. I felt so at home there. And I still do.
MYP Magazine:
But is there something that you learned in football that you can use today on stage as a musician?
Teddy Swims:
Yeah, I believe discipline. Very much so. Discipline is something I’ve taken away from my time in football. Getting up, moving your body, staying hydrated, and drinking water — these habits I learned from football are applicable. While what I do on stage isn’t as physically demanding as football, maintaining or improving my physical condition, adhering to discipline, waking up early, and starting my day with purpose are all lessons I’ve carried over. Additionally, football taught me about teamwork, leadership, and the importance of a sense of family. We’re all a team here.

»For the first time in my life, I feel like I’m truly a grown man.«
MYP Magazine:
You came comparatively late to a career as a professional musician. What is the advantage of entering this world as an adult compared to those teen stars?
Teddy Swims:
I think that only now I am finally ready for the storm that’s about to happen because even just three years ago, if I had experienced the success I’m having right now, I would have been drinking too much, partying too much, and doing cocaine too much. I would have constantly put fucking whatever up my nose and into my lungs.
MYP Magazine:
Or maybe you would have bought a Lamborghini…
Teddy Swims:
Yeah, buying stupid shit is another one of those behaviors. But I’m very aware that my priorities are in order. For the first time in my life, I feel like I’m truly a grown man. And I’m doing what people do who are grown men. I’m fortunate to be able to say that I’ve become someone people trust, that my close friends and I work together, and we make money together. Our health and well-being is crucial to keeping food on each other’s tables. I believe that if I were younger, my priorities would not be the same. So, I’m grateful to have the mindset I currently do and to know what truly matters in life. I feel that my priorities are heading in the right direction. And I’m no longer constantly getting hammered like I used to when I was a kid. (smiles)

»I believe that there is a certain set of words said in a certain way at a certain time that can fix any problem on the planet.«
MYP Magazine:
You have an hourglass tattooed next to your left eye. What does time mean to you in your life?
Teddy Swims:
I believe everything is about timing. Timing holds immense power. Just as you mentioned, if I had started earlier, I don’t think I would have been prepared for it. I think everything comes with divine timing, whether that’s guided by a higher power or something else. I believe that everything unfolds in its proper moment. And, when it comes to timing, I’m also a firm believer that there is a certain set of words said in a certain way at a certain time that can fix any problem on the planet. I truly hold the belief that if you convey the right message at the right time, it has the potential to heal almost anything.

»You have to choose love every day.«
MYP Magazine:
The second part of your artist’s name stands for “Someone Who Isn’t Me Sometimes.” What’s appealing about not being yourself occasionally?
Teddy Swims:
I’ll say it like this: The older I get, the further I move from who I thought I was — the person I was planning to be five or ten years ago. Today, I am so distant from what I thought I wanted and who I believed I was supposed to be or going to be, or how I perceived myself.
That name resonates more with me as I grow older because I am constantly evolving into somebody different. Over the last two years, I’ve felt like I’ve been three different people. The aspects of music that I’ve cherished, and the way this has become a career, have undergone a complete transformation for me. There are aspects of it that feel like a job; I had to retrain my brain, get rid of onerous habits, and remind myself to be grateful for being here.

MYP Magazine:
That sounds very challenging.
Teddy Swims:
Absolutely. Let’s put it this way: If you’re in a relationship for two years and you keep growing, it’s not like every day you wake up thinking, “Oh, it’s another wonderful day loving you. I’m so happy all the time.” You have to choose love every day. You have to rediscover yourself and let parts of you die every day to approach each day with a fresh perspective and tackle everything as it comes. Sometimes I’m not able to do that. I falter. Sometimes I wake up and think, “Okay, I just want to punch everybody. I don’t want to be around anyone.”
And then, I have to remind myself that I’m incredibly fortunate to be here. I look at myself in the mirror and say, “You are beautiful. You deserve this. You are good enough for this. You are good enough in general. You are lucky. Be thankful for being here!” So, a significant part of that name serves as a reminder to me that I will continue to grow and transform into someone else throughout every step of the journey ahead.

»Comparisons and expectations are the artist’s worst enemies.«
MYP Magazine:
There’s a following quote of you in your press kit: “I’m finally learning to trust my gut, stop trying to compare myself to people, and to just let me be authentic to the only me in the world.” Comparing yourself to others, for example on Instagram, seems to be causing more and more emotional damage in our society. What has comparing to others done to you?
Teddy Swims:
I think it completely made me such an insecure person. When I was coming up and doing covers, I covered so many great songs that are some of the best in the world. And when I tried to transition to making my own music and releasing that, I felt like I was holding myself to that same level of fame. But you can’t just step out and expect your own music to be like “I Can’t Make You Love Me.” It takes time. It takes years to develop. And not just that. You can’t compare where you don’t compete, you know? I always thought, “I’m not John Mayer, I’m not Otis Redding. I’ll never be like them and I’ll never beat that. I’m setting myself up for failure. I’ll hate everything I create.”

MYP Magazine:
A classical imposter syndrome…
Teddy Swims:
Rather a mental block. There was a time when I was experiencing severe writer’s block. I was at home during the holidays or Christmas. I started talking to my aunt and she said, “Son, you’re always in places like L.A., Nashville, or London, just writing, writing, writing, and we never see you. Yet, you’ve only released five songs. What are you doing all that time?” And I replied, “Well, I’m just trying to make sure I write something good.” She said, “Why do you only write the good ones?”
That hit me like a ton of bricks. I realized I can’t write great songs every time. I have to write the shitty ones, the bad ones as well. And that realization unlocked something for me. I understood that writer’s block only happens when you expect something to be good, when you compare it to your desired outcome and block out what’s actually there. The creative part of your brain wants to be free; comparisons and expectations are the artist’s worst enemies.

»Frank Ocean’s influence is deeply ingrained in my music.«
MYP Magazine:
The world became aware of you and your voice when you started covering famous songs on YouTube. If you could wish for a famous musician to cover one of your songs, which artist would that be, and which song?
Teddy Swims:
Damn, that’s a great question. When the new album comes out, there’s a song on it called “Last Communion,” and I believe it’s a beautiful song. Andrew Jackson, an incredible writer, wrote it, and I feel fortunate to have him as its creator. I think I would absolutely love to hear Frank Ocean sing that particular song. I feel like I leaned into my admiration for him. You can probably tell that structurally, it’s heavily influenced by him when you listen to it. His influence is deeply ingrained in my music. He’s my all-time favorite artist. I think you can discern a lot of his influence in my music. I would be thrilled to hear him sing that song. But actually, I don’t think Frank Ocean should cover any of my songs because he’s God, he’s the one. And I’m just a kid from Atlanta. (laughs)
MYP Magazine:
Not making yourself so small anymore is definitely something you learn in therapy.
Teddy Swims: (smiles)
That’s good to know. Like I mentioned before, I made this promise to myself, and I am a person who sticks to his promises.

More about Teddy Swims:
Interview and text by Jonas Meyer:
Photography by Maximilian König:
Production assistance by Marco Brandelik









