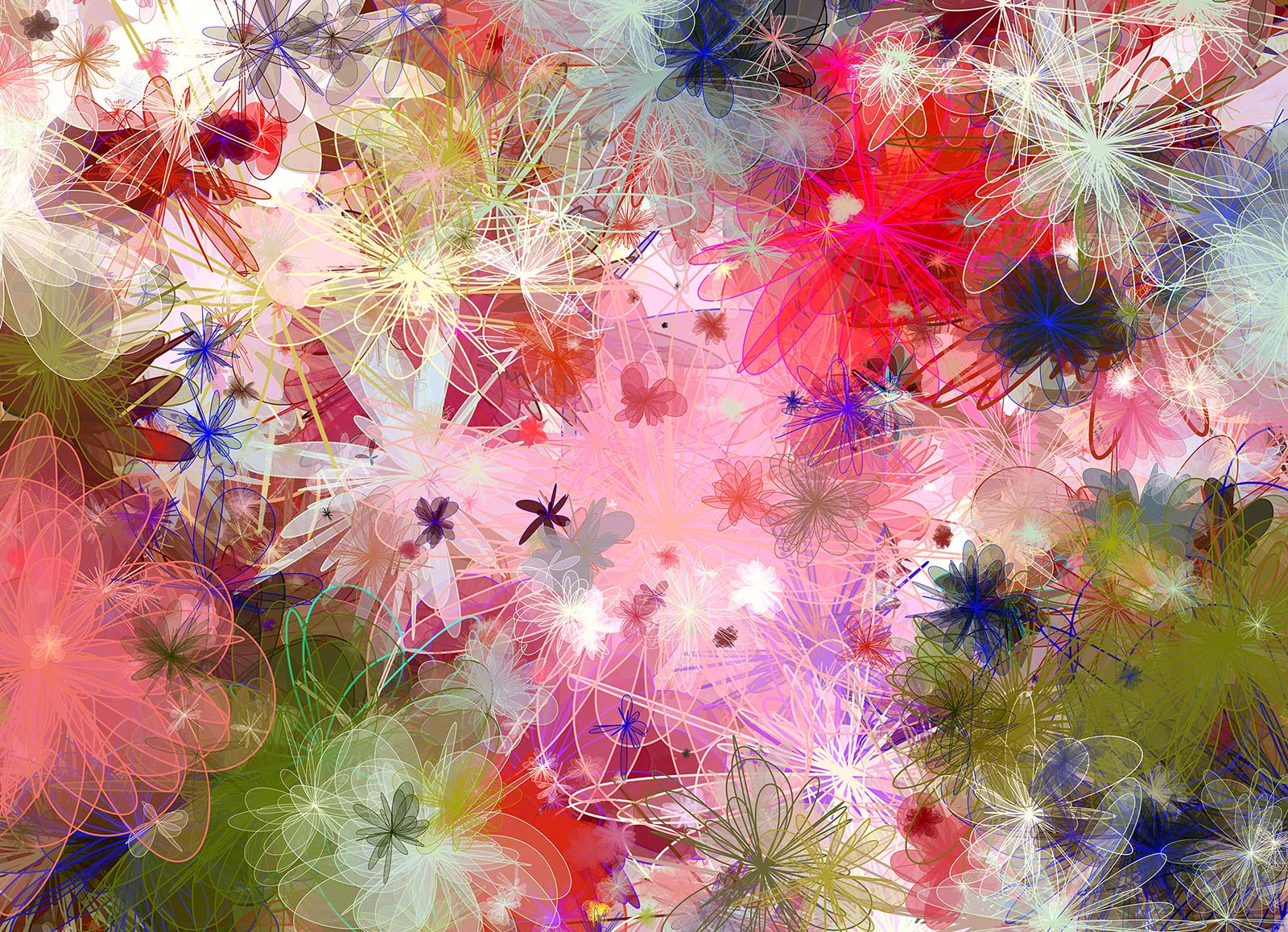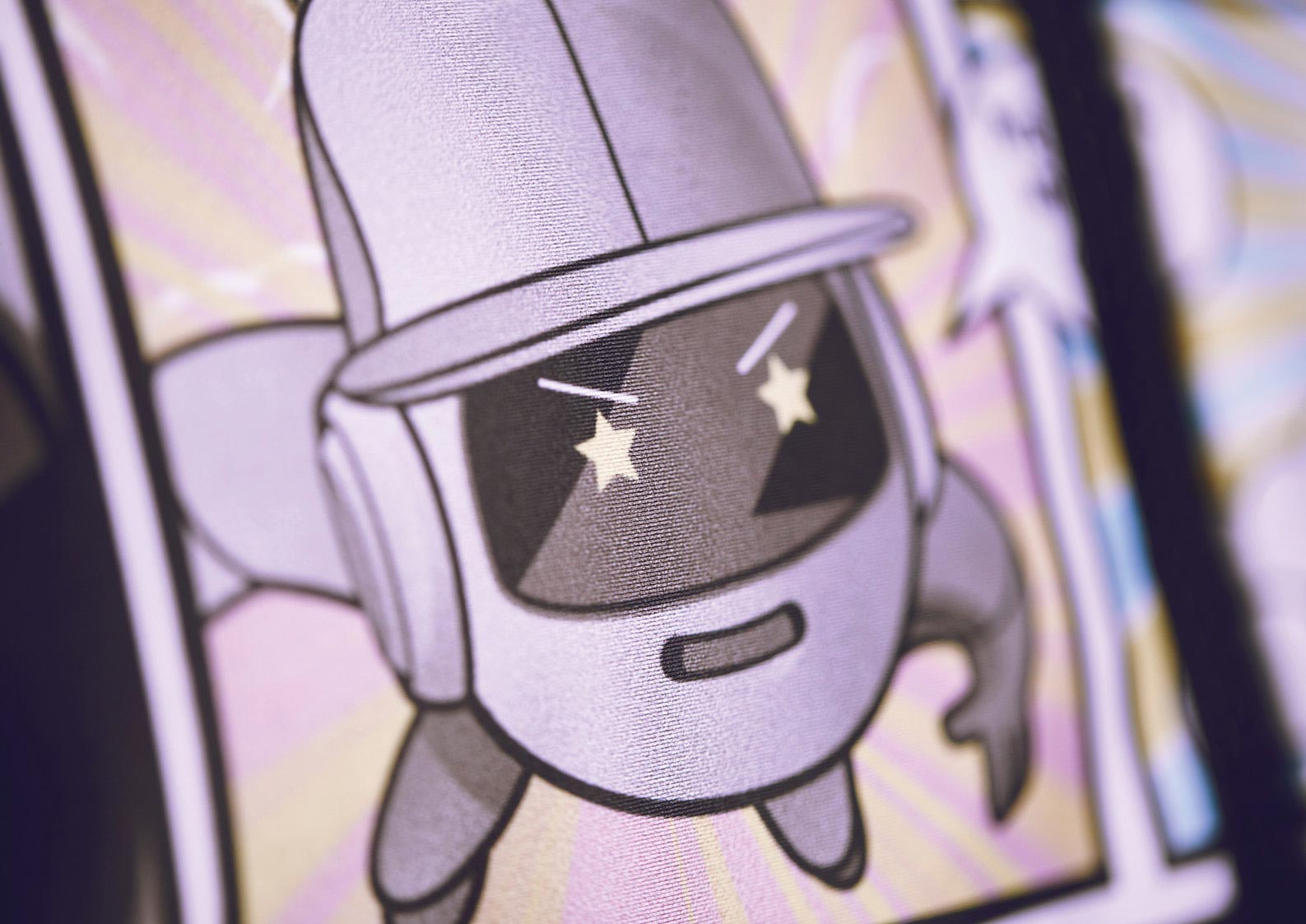Andreas Levers
Editorial — Andreas Levers
Nebel und Stille
19. September 2017 — MYP N° 21 »Ekstase« — Fotos und Text: Andreas Levers
Die Ekstase als „Ausmirherausgeraten“ versteckt sich im Nebel und in der Stille. Das finde ich, wenn ich im Herbst alleine unterwegs bin – wenn sich das Kunstlicht im Nebel streut.
Die begrenzte Sichtweite öffnet einen anderen Blick auf die Welt, indem es vertraute Orte aus der Umgebung herausnimmt. Der Kontext löst sich im Dunst auf und zurück bleibt eine Umgebung, die zugleich vertraut und fremd ist.
Dieses Gefühl bleibt – genau wie der Ort – oft vage. Es löst sich auf, wenn man es zu genau greifen möchte.
Andreas Levers ist 38 Jahre alt, lebt in Potsdam und arbeitet als Mediengestalter.
Dirk Mentrop
Editorial — Dirk Mentrop
Innen zu Außen
19. September 2017 — MYP N° 21 »Ekstase« — Fotos und Text: Dirk Mentrop
Wenn Innen zu Außen wird...
Was ist einem bewusst? Wissen wir immer, in welcher Welt wir leben? Was real, was wahr und wirklich? Jede unserer Seelen ist ambivalent. Klar und jetzt und doch entrückt. Zurückhaltend und doch explosiv.
Wenn wir von Realität sprechen, welche meinen wir dann? Unsere, oder die der anderen? Und wenn wir von unserer reden, zu welchem Zeitpunkt spielt sich diese ab? Gibt es Zeiten, Momente, in denen unsere Seele neben uns steht, auf uns herabschaut? In denen ein Teil von uns neben oder über dem anderen steht. Losgelöst. Wir uns selbst beobachten, Zeit und Raum entrückt.
Ekstase beginnt da, wo Denken und (Selbst)kontrolle aufhören. Und sie beginnt dann, wenn wir einsam am schmalen Grad zwischen Innen und Außen stehen.
Mein Tag
Was für ein einsamer Tag
Wechselbad zwischen
Fühlen und Apathie
Und doch es ist mein Tag
Benzin für die Seele
Und dann ein Streichholz
Und nix mehr und Buuummm
Grau und Ausweglos
Aber ein Tag – Mein Tag!
Ein, zwei, drei Regentropfen
Regnen vom Himmel
Pfützen auf´m Pflaster
Werden zu Seen
Opium fürs Gemüt
Und die Frau gegenüber
Sieht traurig aus und weint
Schmerzvoll und verwirrt
Aber ein Tag – Mein Tag!
Was für eine Symphonie
Gnadenlos in Moll
Und laut wie nie
Und verdammt es ist mein Tag
Klänge fürs Gefühl
Und dann ein Aufbäumen
Und alles und doch vorbei
Schrill und surreal
Aber ein Tag – Mein Tag!
Dirk Mentrop, Jahrgang 1969, lebt in Trier und arbeitet als freischaffender Künstler und Sozialarbeiter.
www.facebook.com/WhereThePixelWorx
www.flickr.com/photos/wherethepixelworx
Mark Broyer
Editorial — Mark Broyer
High and Dry
19. September 2017 — MYP N° 21 »Ekstase« — Fotos und Text: Mark Broyer
Einmal hast du der ganzen Welt den Arsch gerettet. Es hat richtig geknallt, damals, und alles war wie im Rausch. Es hätte ewig so weitergehen können. Aber das hat nicht geklappt.
Man sagt, das Leben verlaufe in Wellenbewegungen. Und man solle die Welle abreiten, solange sie einen trägt.
Du weißt, dass das stimmt. Niemand weiß das besser als Du. Dieses magische Gefühl, von der Welle erfasst zu werden, im richtigen Moment am richtigen Ort zu sein, hast du bis heute nicht vergessen.
Aber niemand hat dir gesagt, was passiert, wenn keine Welle mehr kommt. Wenn man mitten in der Wüste steht. Wie lächerlich es eigentlich ist, hier auf die nächste Welle zu warten.*
*Das Städtchen Trona in der Mojave Wüste, zwischen dem Death Valley und Los Angeles, erlebte während des Ersten Weltkriegs einen wirtschaftlichen Boom als Zentrum der Schießpulverproduktion. Einst gegründet von der American Trona Corp., wuchs die Einwohnerzahl schnell auf 7.000. Nach einer Entlassungswelle in den 80 Jahren ging es jedoch stetig bergab. Die Einwohner zogen weg, die Infrastruktur zerfiel, das soziale Leben löste sich mehr und mehr auf.
Mark Broyer ist 38 Jahre alt, arbeitet als freier Art Director und lebt in Hamburg.
Holger Lippmann
Submission — Holger Lippmann
Ikonen der Schönheit
19. September 2017 — MYP N° 21 »Ekstase« — Bilder und Text: Holger Lippmann
Ich bin mir nicht wirklich sicher, ob ich Blumen malen würde, wenn ich mit traditionellen Farben arbeiten würde. Aber eines scheint mir klar zu sein: Ich hätte nicht wirklich daran gedacht, als ich jünger war.
Nach einer ganzen Reihe von eher schwierigen und zerstreuenden Höhen und Tiefen fühle ich mich mittlerweile sehr verändert. Irgendetwas muss mit mir passiert sein. Plötzlich kamen ein starker innerer Frieden und eine extreme Entspannung über mich und ich hatte das Gefühl, in alles verliebt zu sein – besonders in die Natur.
Das war Mitte der 90er Jahre, als ich von meinen Reisen (ein halbes Jahr Stuttgart, ein Jahr Paris, zwei Jahre New York) zurück nach Dresden kam. Ich verbrachte viel Zeit in der Natur, ging an der Elbe spazieren oder fuhr in die anliegenden Wälder.
Während dieser Zeit fand ich einen neuen Blick auf die Welt, alles erschien wie verzaubert. Ich wusste plötzlich, dass Blumen ganz besondere Ikonen der Schönheit sind, und wie könnte man sie nicht malen wollen!?
Das war der Beginn eines komplett neuen künstlerischen Bestrebens. Es entstand eine Vielzahl von Naturfotografien und schließlich erste – in Actionscript programmierte – Adobe Flash-Applikationen zur Generierung von Bildern.
Bildlegende:
Bild 1: Effervescent-Everpresent
Jahr: 2010
Technik: programmiert in Processing
Medium/Material: Vector für Druck
Bild 2: Outburst of Yellow
Jahr: 2011
Technik: programmiert in Processing
Medium/Material: Vector für Druck
Holger Lippmann, Jahrgang 1960, ist Künstler und lebt in Wandlitz bei Berlin.
Matthew Coleman
Submission — Matthew Coleman
Three Billion Atoms
19. September 2017 — MYP N° 21 »Ecstasy« — Photo & Text: Matthew Coleman
The world is on fire outside and from its flames, she steps,
into her temple that raises up into the early morning skies
high, high, where the birdsong sighs.
Inside the belly of the beast they writhe,
its people caught between the shadows and the strobes.
Her eyes are closed now.
The palms of her hands pressed together.
She moves with the music,
her outline lit by shards of light.
Here, she begins her dance,
and like the San tribe of Africa, she dances into trance.
The phantoms of the San women building up their song.
She moves
and becomes the song,
the shaman,
the fire,
as the women continue rhythm until its ever more intense.
She becomes everything and everyone; all matter condensed…
The music goes through her, lifting her out of her being…
freedom flickers as flames.
She runs,
runs naked and free.
She runs,
in ecstasy,
She runs,
each one of her three billion, billion, billion atoms
rising right up to the stars.
Dancing,
she becomes our star, our planet.
Dancing,
she becomes all.
Dancing,
she becomes everything
Dancing ever onwards into that good night.
Matthew Coleman is an artist living in Berlin, who was born in Brighton (UK).
MYP20 – Prolog "Mein System"
Editorial — MYP Magazine N° 20
Prolog »Mein System«
3. Mai 2016 — Kida Khodr Ramadan fotografiert von Steven Lüdtke
— Kida Khodr Ramadan im Interview
Kida Khodr Ramadan
Interview — Kida Khodr Ramadan
Kreuzberg, Übersee
Kida Ramadan ist ein Kreuzberger Urgestein. In seinem Lieblingscafé am Paul-Lincke-Ufer sprach er mit uns darüber, wie er im Kiez sozialisiert wurde, was er von Vorurteilen gegenüber Flüchtlingen hält und warum er Angela Merkel bewundert.
3. Mai 2016 — MYP N° 20 »Mein System« — Interview: Jonas Meyer, Fotos: Steven Lüdtke
Wer aus seiner Heimat flieht, hat meistens einen Grund. Der eine lässt sie hinter sich, weil er die Schwere der Provinz nicht mehr erträgt. Der andere versucht nichts weiter, als dem nackten Elend zu entkommen. Persönliche Befindlichkeiten versus Hunger, Krieg und Unterdrückung. Seltsam ist die Welt geworden. Und paradox.
Leider erreicht nicht jeder Fliehende sein Ziel. Der eine scheitert, weil er nicht zu seiner Mitte findet. Der andere, weil er im kalten Meer ertrinkt. Was existenzielle Not bedeutet, ist nicht einfach eine Frage der Perspektive. Sie wird bestimmt vom Schicksal und vom Glück. Und von der Gnade der Geburt.
Ganz egal, um welche Art von Fliehenden es geht, in einem sind sich alle gleich: Wer es geschafft hat anzukommen, baut sich irgendwie ein neues Leben auf. Und formt sich darin ein Zuhause. Denn zuhause sein bedeutet, einen festen Platz zu haben – einen ganz bestimmten Ort, an den man hingehört. Oder einen ganz bestimmten Menschen, bei dem man sich geborgen fühlt.
Es ist Sonntagabend. Gemeinsam mit Schauspieler Kida Khodr Ramadan sitzen wir in der hinteren Ecke einer sympathischen Café-Bar am Berliner Paul-Lincke-Ufer, die den verheißungsvollen Namen „Übersee“ trägt. Vor dem Eingang ist ein mit Pflanzen bewachsener Metallpavillon installiert, aus dessen Dach Dutzende kleiner Lampen hervorragen. Zusammen mit dem gold-gelb illuminierten Schriftzug der Café-Bar spiegelt sich ihr Licht in der nachtschwarzen Oberfläche des Landwehrkanals.
Es fällt uns etwas schwer, mit dem Gespräch zu starten, denn ständig kommt jemand an unseren Tisch, der mit Kida ein paar Worte wechseln will. Der 40-Jährige lebt bereits seit seiner frühesten Kindheit in dieser Gegend, er kennt hier jeden und jeder kennt ihn. Und spätestens seit dem Jahr 2014, als er für seine Rolle in „Ummah – Unter Freunden“ sowohl für den Deutschen Filmpreis als auch für den Deutschen Schauspielerpreis nominiert war, kennt man ihn auch über Kreuzberg hinaus.
Jonas:
Als wir dich vor kurzem gefragt haben, ob es hier in Berlin einen Ort gäbe, der dir besonders am Herzen liegt, hast du ohne zu zögern das Café Übersee genannt. Bist du oft hier?
Kida:
Ja, sehr oft – ebenso wie viele meiner Schauspielkollegen. Frederick Lau oder Numan Acar zum Beispiel, die kommen regelmäßig ins Übersee. Oder Herbert Knaup, der hat sich auch schon ein paar Mal hier blicken lassen. Wir nennen diesen Ort „unsere Base“, denn es ist total familiär und gemütlich hier. Und Firat, der Chef, ist ziemlich cool.
Irgendwie hat es sich auch so entwickelt, dass wir alle hier mittlerweile ganz gerne unsere Interviews abhalten. Das Übersee ist daher so etwas wie unser Büro. Und unser Jugendclub.
Jonas:
Euer Plan ist also, ewig jung zu bleiben?
Kida:
Genau das ist es. Ewige Jugend!
Jonas:
Trägt man nicht ohnehin eine gewisse Jugend in sich, wenn man wie du in Kreuzberg lebt und aufgewachsen ist?
Kida:
Da ist schon was dran. Allerdings wohne ich mittlerweile gar nicht mehr hier. Vor wenigen Wochen bin ich von Kreuzberg nach Schöneberg gezogen.
Jonas:
Du hast tatsächlich als waschechter Kreuzberger deinen geliebten Kiez verlassen?
Kida:
Ja, ich wollte meiner Frau und meinen fünf Kindern einfach mehr Platz und Freiheit schenken. Und zumindest einmal im Leben sollte man sich eine schönere Wohnung leisten, oder? Außerdem hat mich dieses überdrehte Hipster-Leben hier in der Ecke genervt. Das wird von Tag zu Tag schlimmer.
Jonas:
Deine Familie stammt ursprünglich aus dem Libanon. Wegen des Bürgerkriegs musstet ihr Ende der 70er Jahre von heute auf morgen aus Beirut fliehen und seid am Ende in Kreuzberg gelandet. Was ist deine früheste Erinnerung an diesen Stadtteil und seine Menschen?
Kida:
Der Zusammenhalt. In Kreuzberg gab es damals viele Leute, die so waren wie wir. Sie waren in einer ähnlichen Situation, hatten eine ähnliche Geschichte. Hier im Kiez habe ich als Kind viel Freundschaft und Liebe erfahren. Als ein Flüchtlingsjunge, der ich damals ja war, wurde ich gut behandelt. Das hat mich sehr geprägt.
Man hat das Gefühl, in Deutschland sei das Wort Flüchtling mittlerweile gleichbedeutend mit kriminell.
Jonas:
Fühlst du dich durch das, was zur Zeit in Deutschland und Europa passiert, an die Situation von damals erinnert?
Kida:
Für die Leute, die vor dem Krieg fliehen, sind die heutigen Umstände noch viel brutaler. Man hat das Gefühl, in Deutschland sei das Wort Flüchtling mittlerweile gleichbedeutend mit kriminell. Dabei kann doch niemand etwas dafür, in welches Land und in welche Lebensverhältnisse er hineingeboren wird. Das ist einfach pures Schicksal. Daher ist meiner Meinung nach auch jeder Mensch dazu verpflichtet, jeden anderen ebenfalls als Mensch zu sehen und ihn mit Respekt zu behandeln.
Jonas:
Du hast in den letzten 40 Jahren immer an Orten gelebt, an denen sich zu der jeweiligen Zeit sehr viel verändert hat: Der Libanon wurde durch den Bürgerkrieg zu einem anderen Land, Berlin durch den Mauerfall zu einer anderen Stadt, Kreuzberg durch die Gentrifizierung zu einem anderen Kiez. Und gerade jetzt erleben wir, wie in Deutschland und anderen europäischen Ländern die Gesellschaft zu einer anderen zu werden scheint. Wie schätzt du diese Entwicklung ein?
Kida (grinst):
Siehst du, mich zieht es immer dahin, wo was los ist. Aber im Ernst: Ich glaube, dass wir in Deutschland sehr privilegiert, frei und sicher leben. Wir können uns glücklich schätzen, dass es hier immer noch den einen oder anderen Respekt gibt. Und die eine oder andere Regel, Disziplin und Struktur, an die man sich hält, damit das Ganze nicht kippt.
Jonas:
Was glaubst du, wie hätte sich dein Leben entwickelt, wenn du nicht in einer Metropole aufgewachsen wärst, sondern irgendwo anders – beispielsweise auf dem platten Land?
Kida:
Allein beruflich hätte ich wahrscheinlich etwas komplett anderes gemacht. Ich bin absolut davon überzeugt, dass ich nur deshalb Schauspieler geworden bin, weil es hier in Kreuzberg eine so lebendige künstlerische Szene gibt. Wenn man wie ich ständig in Jugendzentren gechillt hat und ununterbrochen von Kunst und Kultur umgeben war, ist es ganz automatisch passiert, dass man in diese Welt hineingezogen wurde. Schicksal eben. Und fucking Glück.
Ich habe mir angewöhnt zu sagen,
dass ich der Beste bin: der beste
Schauspieler und der Beste überhaupt!
I am the greatest!
Jonas:
Hattest du auf Schule keinen Bock?
Kida:
Nein! Auf Schule und Studium hatte ich deshalb keinen Bock, weil mir seit der frühen Pubertät klar war, dass ich einmal Künstler sein werde. Ich hatte das Gefühl, dass mir Schule dabei nicht helfen würde – kein Abschluss dieser Welt hätte etwas an meinem Lebensplan geändert: Ich wollte Leute entertainen und sie zum Lachen oder Weinen bringen.
Daher wusste ich schon sehr früh, dass ich mein Geld auf andere Weise verdienen werde. Und wenn es mit der Schauspielerei nicht geklappt hätte, hätte ich immer noch als Tellerwäscher oder Kellner anfangen können. Damit hätte ich kein Problem gehabt. Firat würde mir hier im Übersee bestimmt einen Job geben, wenn ich ihn fragen würde.
(Kida lächelt und bestellt bei Firat eine Cola)
Weißt du, man muss im Leben Ziele haben. Und man muss früh genug und aktiv damit anfangen, sie zu verwirklichen. Wenn man sich von vornherein sagt, man ist ein Gewinner, dann ist man auch ein Gewinner. Aber wenn man immer nur wartet und wartet, bis irgendetwas passiert, dann ist und bleibt man zwangsläufig ein Loser. Daher habe ich mir angewöhnt zu sagen, dass ich der Beste bin: der beste Schauspieler und der Beste überhaupt! I am the greatest!
Jonas:
Einer deiner wichtigsten Wegbereiter ist der deutsch-türkische Regisseur Neco Çelik, der in den 90er Jahren auch als Sozialarbeiter in einem Kreuzberger Jugendzentrum gearbeitet hat. Wie genau hat er dich zum Film gebracht?
Kida:
Neco ist ein super Typ. Schon damals war er hier in Kreuzberg für viele ein Vorbild, weil er sich als Sprüher in der HipHop-Szene einen Namen gemacht hatte. Ich habe ihn im Jahr 2002 kennengelernt, als er sein Fernsehfilmprojekt „Alltag“ vorbereitet hat – in der Story geht es um zwei Jungs, die ein Kreuzberger Wettbüro überfallen. Neco ist auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte mitzumachen. Daher ist er sozusagen mein Entdecker.
Ich habe ihm sehr viel zu verdanken – vor allem, was meine Zukunft angeht. Egal wie alt ich bin und in welcher Situation ich mich gerade befinde, Neco ist einer der wichtigsten Antreiber meiner Karriere. Daher nutze ich jede Chance, die sich bietet, um ihm zu danken: Danke, dass du an mich geglaubt hast, lieber Neco!
Jonas:
Da kommt also jemand und fragt dich, ob du in seinem Film mitspielen willst, und plötzlich stehst du mit Mitte 20 zum ersten Mal an einem Filmset. Hattest du Lampenfieber?
Kida:
Nö. Das Filmset ist für mich wie ein Boxring. Und wenn ich in den Ring steige, steige ich als Gewinner in den Ring und nicht als Verlierer. Wie ich schon gesagt habe: Meine Einstellung ist: Ich bin der Beste. Das war bei meinem ersten Film so und das wird auch bei meinem letzten Film so sein. Das heißt natürlich nicht, dass ich tatsächlich der Beste bin, aber ich brauche für mich einfach diese ganz spezielle Tonalität, diesen Spirit. Es bringt mir ja nichts, wie ein kleines Kind in der Ecke zu stehen und die ganze Zeit andere Schauspieler anzuhimmeln.
Jonas:
Kann man von den Kollegen, mit denen man zusammenarbeitet, nicht auch etwas lernen?
Kida:
Selbstverständlich, diese Chance nutze ich ja auch. Es gibt immer etwas zu lernen, bei jeder Produktion: zum Beispiel wie unterschiedlich die einzelnen Arbeits- und Herangehensweisen der Kollegen sind. Allerdings ist das nichts, was exklusiv der Schauspielerei vorbehalten wäre. In jedem Beruf ist es doch so, dass man versucht herauszufinden, an welcher Stelle man seine Arbeit optimieren kann – ganz egal, ob man vor einer Kamera steht, im Supermarkt an der Kasse sitzt oder irgendwo am Fließband arbeitet.
Kreuzberg ist ein sehr ambivalentes Pflaster, wo viele crazy Motherfuckers herumlaufen. Hier ist man einfach nicht so prüde wie etwa in Zehlendorf.
Jonas:
Ich bin bei der Vorbereitung auf unser Gespräch auf deine Äußerung gestoßen, dass Kreuzberg deine beste Schauspielschule war. Wie ist dieser Satz gemeint?
Kida:
Kreuzberg ist ein sehr ambivalentes Pflaster, wo viele crazy Motherfuckers herumlaufen. Hier ist man einfach nicht so prüde wie etwa in Zehlendorf. Nichts gegen Zehlendorf, da gibt es bestimmt auch viele nette Leute. Aber in Kreuzberg sind die Menschen irgendwie am wenigsten eintönig. Es gibt hier sehr viel Trara, man sieht viel und hört viel. Dementsprechend kann man sich viel abschauen, wenn es darum geht, andere Charaktäre darzustellen.
Jonas:
Wie funktioniert das genau?
Kida:
Man muss in Kreuzberg einfach aktiv den Alltag erleben. Egal ob man morgens zum Bäcker geht oder in die Ubahn steigt. Die Art und Weise, wie die Menschen hier reden und sich verhalten, ist reines Entertainment. Das ist in Istanbul oder Beirut übrigens nicht anders.
Dazu kommt, dass ich als Jugendlicher nicht gerade ein Engel war: oft in schlechter Gesellschaft, viel auf der Straße unterwegs – da lernt man viel. Man wird aber auch zwangsläufig zum Schakal.
Jonas:
Für einen Schakal wirkst du sehr offen und menschenfreundlich.
Kida:
Vor Menschen soll man ja auch keine Angst haben. Warum auch? So wie man sich selbst gibt, so kommt es auch zurück. Das Leben ist wie ein Boomerang.
Ich bin immer gut zu den Leuten: Wenn ich merke, dass jemand der tollste Mensch der Welt ist, dann versuche ich, mindestens genauso toll zu ihm sein. Das ist eine Sache des gegenseitigen Respekts. Es kommt einfach auf die Tonalität an. Wir sind doch alle gleich: Der Mensch ist Mensch, ich bin nicht besser als du und du bist nicht besser als ich. Nur eines darf man nicht: sich wie eine Ratte verhalten. Dann werde ich auch zur Ratte.
Jonas:
Kurz nach „Alltag“ hast du noch für ein weiteres Projekt von Neco Çelik vor der Kamera gestanden: „Urban Guerillas“. Und nur wenig später konntest du bereits wichtige Rollen in den Kinofilmen „Yugotrip“ und „Kebap Connection“ übernehmen: Bei „Kebap Connection“ war dein Name zum ersten Mal auf Filmplakaten zu lesen. Dieser Erfolg ist auf der einen Seite natürlich super, auf der anderen Seite reichen wenige Engagements im Jahr nicht aus, um damit den Kühlschrank füllen zu können. Wie hast du die ersten Jahre als Schauspieler erlebt?
Kida:
Ganz ehrlich: stellenweise als eine schlimme und harte Zeit. Zwar waren für mich vor allem die Kinoproduktionen richtig große Dinger – mit wichtigen Rollen, vielen Drehtagen, bekannten Produktionsfirmen und viel Lob von allen Seiten. Doch wenn so ein Film erstmal abgedreht ist, ist plötzlich alles vorbei: nichts mehr zu tun, Stillstand. Vor allem, wenn es keine weiteren Anfragen gibt. In solchen Situationen fragt man sich: Alter, warte mal, was ist denn los? Warum geht es nicht mehr voran? Ich bin also kein richtiger Schauspieler, oder?
Ein halbes Jahr lang ist nichts passiert – ich wusste einfach nicht, wie’s weitergehen soll. Und so habe ich hier mal gekellnert, dort mal als Tellerwäscher gearbeitet, um mich über Wasser zu halten.
Jonas:
Irgendwie geht es immer weiter.
Kida:
Man darf eben nicht aufgeben. Und man muss Geduld haben: Irgendwann ging es auch bei mir wieder ganz langsam los.
Jonas:
Und aus dir wurde ein hauptberuflicher Schauspieler.
Kida:
Aber was heißt das denn? Wenn man eine Ausbildung zum Elektriker macht, ist man irgendwann Elektriker von Beruf. Aber ist das bei einem Schauspieler wirklich genauso? Wenn man zehn Jahre an der HFF studiert hat oder 15 Jahre an der Ernst Busch war, kann man dann sagen, dass man Schauspieler ist?
Ich habe mir diese Frage in meinem Leben immer wieder gestellt: Ab welchem Punkt kann man von sich behaupten, Schauspieler zu sein? Irgendwie gibt’s diesen Beruf doch gar nicht. Das ist alles Lüge. Wie viele sogenannte Schauspieler können letztendlich von dem leben, was sie da tun? 15 bis 20 Prozent?
Jonas:
Soweit ich weiß, sind es in Deutschland weniger als zehn Prozent, die allein von der Schauspielerei leben können.
Kida:
Weniger als zehn Prozent? Das ist erschreckend. Wirklich brutal.
Jonas:
Kannst wenigstens du allein von der Schauspielerei leben?
Kida:
In meinem Leben gab es Zeiten, da wäre dieser Gedanke für mich unvorstellbar gewesen. Aber heute gehöre ich tatsächlich zu diesen zehn Prozent, die irgendwie Glück mit ihren Agenten hatten und ins Business gekommen sind. Daher geht es mir im Moment auch einfach sehr gut. Aber man weiß ja nie, was morgen ist. Man hat keine Ahnung, welche Jobs kommen und welche wieder platzen. Die Schauspielerei ist einfach unberechenbar. Daher wiegt dieses Wort für mich auch so schwer.
Jonas:
Im Vergleich zu einem 20-jährigen Jungschauspieler trägst du als Familienvater auch eine ganz andere Verantwortung. Deine Kinder brauchen jeden Tag etwas zu essen auf dem Tisch und ein Dach über dem Kopf.
Kida:
Ganz genau. Trotzdem hat bei mir Existenzangst nie eine Rolle gespielt. Wenn ich mal drei Monate keine Arbeit habe, schaue ich einfach, was ich sonst noch so machen kann – ganz egal, wie groß die Rolle war, die ich vorher gespielt habe. Versteh mich nicht falsch: Mein Ziel im Leben ist es, gute Filme zu machen. Aber manchmal geht es auch einfach nur darum, den Kühlschrank zu füllen.
Ich wusste bei meinem ersten Tatort nicht, was das ist. Ich bin mit Denver Clan und Dallas groß geworden. Und mit Bonanza und Glücksrad.
Jonas:
Du bist jemand, den man immer mal wieder im Tatort sieht. Viele Millionen Menschen in Deutschland sind mit diesem TV-Format aufgewachsen. Du auch?
Kida:
Ganz ehrlich? Ich wusste bei meinem ersten Tatort nicht, was das ist. Ich bin mit Denver Clan und Dallas groß geworden. Und mit Bonanza und Glücksrad. Aber Tatort? Ich wusste zwar, dass es jeden Sonntag um 20:15 Uhr im Fernsehen immer wieder so einen Einspieler mit Fadenkreuz gab, aber dass um diese Serie bis heute so ein Hype gemacht wird, war mir lange nicht bewusst.
Jonas:
Ich finde es sehr bemerkenswert, wie sich dieses TV-Format in über 40 Jahren entwickelt hat.
Kida:
Ja, voll modern geworden, oder? Welcher ist dein Lieblings-Tatort?
Jonas:
Mir gefällt der neue Berliner Tatort mit Meret Becker. Gut erzählt, tolle Dynamik. Außerdem mag ich die sechs Episoden mit Mehmet Kurtuluş als Ermittler in Hamburg, die bis 2011 ausgestrahlt wurden – alleine schon wegen der Bildsprache. Dagegen fand ich beispielsweise den Saarland-Tatort nie so berauschend.
Kida:
Was sagst du da? Nichts gegen den saarländischen Tatort mit Devid Striesow! Der ist wirklich gut. Als Devid im Jahr 2009 seinen allerersten Fall gedreht hat, war ich übrigens dabei. Ich habe damals einen Gangster gespielt, der ein kleines Kind entführt.
Jonas:
Schon wieder einen Gangster.
Kida:
So sieht’s aus.
Jonas:
Stört es dich nicht, dass du immer wieder solche Charaktäre spielen sollst? Ich muss gerade an das denken, was uns deine Kollegin Ulrike Folkerts erzählt hat, als wir sie im Sommer 2014 interviewt haben: „Das deutsche Fernsehen hat noch etliche andere Großbaustellen: So findet beispielsweise der Ausländeranteil, den wir in unserem Alltag erleben, im Fernsehen einfach nicht statt […] Da werden etwa türkischstämmige Schauspieler immer noch ausschließlich für flache Klischeerollen besetzt, obwohl sie in ihrem Leben vielleicht ein einziges Mal nach Anatolien gereist sind, weil von dort ihre Großeltern kommen. Auch hier muss das Fernsehen endlich anfangen, moderner zu werden und den Spiegel der Gesellschaft an sich zu reißen. Es wird sich nichts ändern, wenn man immer wieder gängige Klischees bedient und beispielsweise einen Schwulen eine Tucke spielen lässt oder einen Schauspieler mit ausländischen Wurzeln für die Rolle des Dönerverkäufers oder Gemüsehändlers besetzt.“ Siehst du das ähnlich?
In Deutschland traut man sich einfach nicht, jemanden wie mich beispielsweise für die Rolle eines deutschen Lehrers Michael Meier zu besetzen.
Kida:
Ich küsse die Hände dieser Frau! Sie hat es auf den Punkt gebracht. In Deutschland traut man sich einfach nicht, jemanden wie mich beispielsweise für die Rolle eines deutschen Lehrers Michael Meier zu besetzen. Aber es ist auch schon besser geworden, zumindest was den Erfolgsstatus von Schauspielern wie etwa Elyas M’Barek oder Fahri Yardim angeht.
Jonas:
Aber auch die sind nicht davor geschützt, in der Öfferntlichkeit immer wieder mit seltsamen Fragen konfrontiert zu werden. Elyas M’Barek etwa wurde Ende 2013 in einer „Wetten, dass..?“ Sendung von Markus Lanz darauf angesprochen, warum er kein Arabisch spricht, wo doch sein Vater aus Tunesien stammt. Es scheint, als würde man bestimmte Denkmuster einfach nicht aus den Köpfen der Leute bekommen.
Kida:
Ich verstehe das Problem auch nicht. Für mich als Zuschauer wäre doch die Spielstärke eines Darstellers viel wichtiger als sein kultureller Hintergrund. Wenn jemand den Lehrer Michael Meier richtig gut spielen kann, warum sollte man ihn dann nicht für die Rolle besetzen?
Jonas:
Was müsste man denn tun, um das Publikum zu sozialisieren?
Kida:
Mehr Mut haben! Die Förderanstalten, die Geldgeber, die Sender – alle müssten mutiger sein. Aber sie trauen es den Schauspielern immer noch nicht zu. Dabei muss man sich nur Fahri Yardim im Hamburger Tatort anschauen, der an der Seite von Til Schweiger einen der beiden Hauptkommissare spielt. Fahri kommt da als absolut waschechter Hamburger rüber – mehr Lokalpatriot geht nicht.
Jonas:
Würdest du auch gerne mal eine große Hauptrolle übernehmen?
Kida:
Ich habe kein Problem damit, immer wieder gute Nebenrollen zu spielen. Ich bin ja auch eher der markantere Typ und weniger der typische Hauptrollen-Schönling. Aber klar, wenn das Angebot für eine interessante Hauptrolle kommen würde, würde ich auf jeden Fall zuschlagen. Wer würde das nicht tun?
Jonas:
Eine Hauptrolle der ganz anderen Art hast du vor einigen Monaten in dem Kurzfilm „The Huntingtons“ übernommen, in dem auch Kollegen wie Samuel Schneider, Frederick Lau, Jella Haase, Alice Dwyer oder Franziska Knuppe zu sehen sind. Mit dem Film, in dem du einen trauernden englischen Patriarchen spielst, hat der Berliner Modedesigner Kilian Kerner seine neue Herbst-Winter-Kollektion vorgestellt. Wie kam es zu dieser Zusammenarbeit?
Kida:
Bei Kilian konnte ich einfach nicht nein sagen, er ist einfach ein so wahnsinnig toller Mensch. Es gab mal eine Situation, in der ich wegen einer Premierenfeier gut aussehen musste und niemand einen Anzug für mich hatte. Ich war ein Nichts, niemand hätte mir nur einen einzigen Fetzen Stoff gegeben. Aber Kilian war für mich da und hat an mich geglaubt. Das werde ich ihm nie vergessen.
Ich war ein Nichts, niemand hätte mir nur einen einzigen Fetzen Stoff gegeben.
Jonas:
Wie habt ihr euch kennengelernt?
Kida:
Über meinen guten Freund Frederick Lau.
Jonas:
Frederick Lau ist ein großer Anker in deinem Leben, richtig?
Kida:
Du meinst Frederick Ramadan.
Jonas:
Oder Kida Lau.
Kida (lacht):
Genau. Wer Freddy kennt, der weiß, was für eine Granate dieser Kerl ist. Er hat zwar wie jeder Mensch seine Ecken und Kanten, aber dafür ein riesengroßes Herz. Als wir uns kennengelernt haben, haben wir schnell gemerkt, dass wir auf einem Level sind.
Jonas:
Ein mindestens genauso großer Anker wie Freundschaft ist die Familie. Was gibst du deinen Kindern mit, damit sie für diese Welt gewappnet sind?
Kida:
Ich möchte, dass meine Kinder lernen, alle Menschen zu respektieren und friedlich mit ihnen zusammenzuleben – egal ob sie hier geboren sind oder nicht. Man muss immer daran denken, dass die Menschen, die fliehen, nicht Deutschland als Ziel haben, sondern den Frieden.
Vor kurzem hatte ich mit meiner ältesten Tochter eine Diskussion darüber, in welchen glücklichen Verhältnissen wir eigentlich leben. Ich versuche meinen Kindern immer wieder zu erklären, dass es Menschen auf der Welt gibt, für die es purer Luxus ist, jeden Tag zu duschen oder sich ein Bad einzulassen. Während es für uns total normal ist, einen Schokoriegel aus dem Schrank zu nehmen, wenn man Lust darauf hat, kämpfen anderswo die Menschen um’s nackte Überleben.
Nach diesem Gespräch hat meine Tochter plötzlich angefangen zu weinen. Sie sagte, sie hätte Angst, dass in Deutschland das Gleiche passieren könnte wie im Libanon oder in Syrien.
Jonas:
Was hast du ihr geantwortet?
Kida:
Dass ich so etwas natürlich nicht hundertprozentig versprechen kann. Aber dass ich fest daran glaube, dass es in Deutschland nicht so kommen wird, jedenfalls mit der allergrößten Wahrscheinlichkeit.
Jonas:
Dennoch ist die Situation an vielen Orten in Deutschland und Europa zur Zeit bitterernst. Da werden Flüchtlingsheime angegriffen, Menschen verängstigt und in übelster Weise auf den Staat und die Presse geschimpft. Was geht deiner Meinung nach gerade schief in so vielen Köpfen?
Kida:
Ich weiß es nicht. Vielleicht hat man versäumt, ihnen schon im Kindergarten oder in der Schule klar zu machen, dass es Menschen gibt, die vor dem allergrößten Elend fliehen müssen, während man selbst genug zu fressen hat. Ich finde, diese Aufklärung sollte genauso selbstverständlich zum Lehrplan gehören wie der Sportunterricht.
Im Moment fühle ich mich sehr stark an die Zeit erinnert, als Anfang der 90er der Mob in Rostock-Lichtenhagen tobte. Die Stimmung im Land war ziemlich aufgeheizt, das war wirklich hässlich. Aber danach wurde es wieder ruhiger, es kamen viele schöne Jahre. Nur leider kocht jetzt das Ganze wieder hoch.
Ich glaube, das Problem liegt ganz allgemein darin, dass sich die Menschen zu wenig austauschen. Statt miteinander zu reden, rennen sie aus falscher Angst zu irgendeiner neuen Partei, die ihnen das Blaue vom Himmel verspricht. Aber lass die mal ein Jahr lang im Parlament sitzen. Die verkacken, Alter! Die verkacken hochgradig. Und dann sind sie bald wieder weg vom Fenster.
Jonas:
Du scheinst ein politischer Mensch zu sein.
Kida:
Nö, eigentlich nicht. Aber in diesen Zeiten wird man das einfach automatisch – vor allem, wenn man Kinder hat.
Jonas:
Vor kurzem hast du gemeinsam mit dem Regisseur Detlev Buck eine Berliner Justizvollzugsanstalt besucht, um euren Film „Knallhart“ von 2006 zu zeigen. Das Drama erzählt die Geschichte eines 15-jährigen Jungen, der von einer kriminellen Jugendbande drangsaliert wird. Dieser Film ist damals vielfach ausgezeichnet worden und dient Pädagogen heute noch als Arbeitsmaterial für ihren Unterricht. Würdest du sagen, dass du ein Vorbild bist?
Kida:
Ich würde sagen, dass ich zumindest für diejenigen Jugendlichen ein Vorbild sein kann, die es schaffen wollen. Ich fühle mich selbst ja immer noch als einer von ihnen – das versuche ich ihnen zu vermitteln. Aber wenn ich für diese Jungs wirklich ein Vorbild sein kann, dann will ich es als Familienvater sein und nicht als das, was ich beruflich mache.
Diese jungen Leute haben Detlev und mir erzählt, dass sie keine Träume mehr haben. Sie haben gesagt, dass sie einfach kaputt sind und das Lachen verloren haben. Das hat uns wirklich schockiert. Daher habe ich ihnen angeboten, mir auf Facebook zu schreiben, sobald sie wieder draußen sind. Ich habe ihnen gesagt, dass ich mit ihnen einen Kaffee trinken gehe und mir Zeit für sie nehme. Das mache ich wirklich gerne. Am Ende war es ein ziemlich komisches Gefühl, dass wir wieder nachhause gehen dürfen und die Jungs dort bleiben müssen.
(Kida schweigt für einen Moment)
Es geht mir echt nicht aus dem Kopf. 18, 19 Jahre alt und keine Träume mehr. Kann man sich das vorstellen?
Jonas:
Was sind denn deine Träume?
Kida:
Ich bete jeden Tag zu Gott und wünsche mir, dass meine Kinder gesund und aufrecht durch’s Leben gehen. Und ich wünsche mir, dass meine Frau und meine Mutter gesund bleiben. Der Rest ist purer Luxus für mich. Ich hab’s dir ja gesagt: Ich könnte morgen hier im Übersee in der Küche anfangen, kein Problem. Das Einzige, was ich will, ist irgendwann Opa werden.
Jonas:
Vor einigen Jahren ist dein Vater gestorben. Wie ist er damit umgegangen, dass du in deinem Leben Schauspieler geworden bist?
Kida:
Ich glaube, dass mein Vater letztendlich froh war, dass ich bei dem sozialen Umfeld, das ich als Jugendlicher hatte, nicht kriminell geworden bin. Und dass die Kunst meinen Arsch gerettet hat. Er war sogar ein wenig stolz, als er mich zum ersten Mal auf einem Filmplakat an einer Litfaßsäule gesehen hat.
Aber das, was mein Vater geleistet hat, werde ich selbst nie erreichen können. Er hat Tag und Nacht für uns gearbeitet und hat sich persönlich nie etwas gegönnt. Mein Vater hat nie vom Amt gelebt, hat alles aus dem Nichts aufgebaut und eine Familie mit sieben Kindern durchgebracht. Zeitweise hatte er sogar zwei Jobs gleichzeitig gehabt – alles nur, damit es uns gut geht und wir immer einen vollen Kühlschrank haben.
Echtes Leid kenne ich einfach nicht – das kennen übrigens auch die nicht, die gerade überall so laut schreien.
Jonas:
Aber du selbst hast doch auch viel erreicht in deinem Leben.
Kida:
Ja, aber ich habe diesen riesigen Sprung nicht gemacht, bin diesen steinigen und weiten Weg nicht gegangen. Mein Vater war Mitte der 70er Jahre ein erfolgreicher Geschäftsmann in Beirut. Aber plötzlich wurde er aus seinem etablierten, sicheren und guten Leben herausgerissen: Bam! Krieg! Raus hier! Da ging es vom einen auf den anderen Moment nur noch darum, die Familie zu retten.
Ich selbst bin hier in Deutschland aufgewachsen. Ich habe hier meine Frau kennengelernt. Hier wurden unsere Kinder geboren. Dementsprechend habe ich noch nie wirklich gelitten. Echtes Leid kenne ich einfach nicht – das kennen übrigens auch die nicht, die gerade überall so laut schreien.
Mein Vater hat immer gesagt: „Als wir nach Deutschland gekommen sind, haben wir mit allem gerechnet. Aber nicht damit, dass wir mal hier sterben werden.“ All die Jahre hat er sich gewünscht, irgendwann wieder in sein altes Leben zurückkehren zu können. Er hatte einfach das Gefühl, dort hinzugehören – zu seinem Land, zu seiner Heimat.
Kida Khodr Ramadan ist 40 Jahre alt, Schauspieler und lebt in Berlin.
Tyron Ricketts
Interview — Tyron Ricketts
Stories of Value
Back in the 90’s, when Berlin-Kreuzberg used to be a lawless zone, rap artist Tyron Ricketts had a gun pointed in his face: A talk about the grimey beginnings of the Berlin hype and how the difficult relationship with his dad shaped his identity.
3. Mai 2016 — MYP N° 20 »My System« — Interview: Maxim Tsarev, Photography: Roberto Brundo
Waiting for Tyron Ricketts, I take a seat on a bench with my back to Görlitzer Straße. He has asked to meet me here at a small café across from the once infamous park. Parents with strollers, students, and senior citizens stroll by in the afternoon sun, intermingling with the few dealers who remain at what used to be one of Europe’s premier drug plazas.
Although most of the ’90s era grime has been washed away by gentrification, Kreuzberg retains an edge that can be seen in the sharp cheekbones and furrowed brows of the young men trying to scratch out a living by the park entrances. Their gaze is unique to them, furtive and cartoonishly menacing, as if they are trying to convince themselves of their own sincerity. To me they just look hungry.
The first time Tyron passes me, I don’t immediately recognize him. He zips by on a sporty bicycle with a cap slung over his eyes, and it isn’t until he tracks back in my direction that I am able to identify him. After introducing ourselves we take a seat outside, and launch into a conversation about the US, where I am from, and Tyron now lives with his girlfriend.
Maxim:
You lived in LA a while, but recently moved to New York, right?
Tyron:
There were two reasons for that. In general I left for the US because I had already done quite a lot in Germany, and I wanted a new challenge. I had just gotten done traveling the world, and didn’t want to fall back into the same old rut. Either I was going to settle down with a wife and some kids, which is hard to do without the requisite partner, or I was going to try something different. I had the good fortune of meeting Harry Belafonte around that time. He helped me get a visa for the US, so that I could go to LA. Once you’re there you need a little time to understand the culture. Even when you think that you have the US figured out, it turns out much different from what you expected. That’s also where I met my girlfriend. Actually I’d met her 12 years prior to that, but we reconnected around that time. She’s a doctor in New York, and at some point the whole long-distance thing became a drag. It was easier for me to move to New York, than for her to move to LA, since she was in the middle of her residency at the time. That was about a year ago. In New York I started working with the Belafontes, in particular with Harry on Sankofa, an organisation he started that brings together artistry and social justice. The struggle for civil rights was a hallmark of his career, and he wants to pass that spark along to later generations. People like Usher and John Legend are also involved.
Maxim:
And you’re active there in your capacity as a musician, or as an actor?
Tyron:
Neither. In the beginning I was in charge of social media content. I was responsible for photo content, interviews, and video. At the time I curated all of our channels. Now I’m a little more independent. I filmed the Million Man March. When Harry gives interviews, I film those.
Maxim:
What brings you to Berlin then?
Going to a casting with 40 other people is hard when you’ve been in film for 20 years already.
Tyron:
I still have an apartment here. I still like being here, and I don’t want to lose contact to the city. Anyway, this is where my acting career is based. In America nobody cares that I’ve done 50 films. Here that’s a good thing, but over there they want to know what you’ve done in America. They tell you to come back once you have a little more weight under your belt. Going to a casting with 40 other people is hard when you’ve been in film for 20 years already. I was at one where all I had to say was, „Shut it, Spinelli!“ For that alone you drive an hour and a half into the Valley, and then wait 30 minutes in reception. It’s humbling. Here I shoot something every now and then. I was in a film called “Kleine Große Stimme”, which was a coproduction between Austrian and German public television.
Maxim:
What’s it about?
Tyron:
The film is about a little Black boy who lives in Austria with his grandparents in 1954. He is the son of an Austrian and an American soldier, and doesn’t feel like he belongs in his town. One day he sees that the Vienna boy’s choir will be travelling around the world, including stops in America, and he decides to join so that he can search for his father there. I play his father. The movie turned out really well. With public TV movies you sometimes expect the opposite, but the director, Wolfgang Murnberger, is one of the best in Austria.
Maxim:
In the music video to your song „Neustart“ you, playing the protagonist, accuse your father of neglecting his responsibility towards you. You let him know that he left you and your mother in the lurch in Germany, with no defense mechanisms against the racism there. Does that scene have an autobiographic background, or does it reflect certain problems in German or Austrian society?
I asked my father too: »How come you never showed more interest?« It would have been nice to have a role model, growing up.
Tyron:
That scene was from another film I was in. It was a 90 minute movie that starred Günther Kaufmann as my father. Although I never had a confrontation in those same words with my dad, I did help write some of the dialogue. My parents separated when I was six, and I grew up without a Black role model in the family. After my mother remarried I was the only Black family member which meant that things happened to me that they couldn’t always relate to. The same way that you can’t fully comprehend how a woman feels in a parking garage alone at night, because you aren’t a woman, my mother and step-father couldn’t understand it when the cops harassed me. One time I was at the skate park with friends, and the police singled me out to clean up cigarette butts and empty beer cans, even though I didn’t smoke and didn’t drink. When I came home, and told my parents what had happened, they insisted that it couldn’t have been a racist thing, and that I must have done something to draw the cops’s attention. That makes you feel isolated as a kid. You can’t really blame them either, because that’s not their reality. I asked my father too: „How come you never showed more interest?“ It would have been nice to have a role model, growing up. I wouldn’t have needed to model myself on rappers at 16 then, either.
Maxim:
Do you speak English with your dad?
Tyron:
My dad is no longer alive. As a kid I didn’t speak English, although I did understand it. Later, when we reconnected in my early 20s, we spoke English.
Maxim:
Where was he from?
Tyron:
He was from Jamaica. My parents met in London in the early ’70s. He spoke some German, but with this weird Austrian accent.
Maxim:
That’s funny. When my family first moved to Dresden they sent me to a German kindergarten. I ended up speaking with this really weird Saxonian-American accent. Do you have any relationship to Jamaica, besides your blood ties?
Tyron:
I was there twice, but I didn’t really experience much of the country on either occasion. The first time I was there to see my dad, so I couldn’t really concentrate on the country, and the second time was for a video shoot. I was the host for Wordcup, a rap show on the German TV station Viva, and we were going behind the scenes of a music video shoot for Gentleman. I would like to get to know Jamaica better in the future.
Maxim:
You didn’t stop off when you were travelling the world?
Tyron:
No. I was in Canada, LA, Mexico, Costa Rica, Hawaii, Fiji, New Zealand, Australia, and Indonesia.
Maxim:
Wow, how did your travels affect you?
Tyron:
You learn a lot. You learn to adapt to changing surroundings that you can’t control. It becomes your job to react well to new challenges. I like the spontaneity of it. You quit planning things. Here you know days or even weeks in advance what you are going to be doing the next day. I learned to live in the here and now, which is one of my biggest achievements, and one that helps me each and every day.
Maxim:
In the sense that you have a better grasp of your abilities and limitations?
Tyron:
You learn to make the best of bad situations. Sometimes you only learn by doing. In Mexico a friend I was supposed to stay with left me hanging, and I had to organize shelter for myself on little to no cash. When you’ve experienced one or two of these situations, your confidence grows. A lot of people are afraid to travel on their own, because they think they won’t have anyone to talk to.
Maxim:
So when did you move to Berlin?
Tyron:
I first came here in the mid ’90s, because I had a band in Berlin, called Mellowbag. I was still living in Cologne though, since I hosted my rap show there. I’d always stay in Berlin for a couple of months, and then go back to my TV job. In 2003 I finally gave up my spot in Cologne, and moved here. I wanted to focus more on acting. My company Panthertainment which produced my TV Show also had a booking and casting department for black actors and models. We had these street teams that would go out to try and find new talent, kind of like what I’d seen going on in New York. After the music industry crashed in ’03 it just wasn’t fun anymore. So I decided to focus on what I really cared about.
Maxim:
Where would you hang out in Berlin in the ’90s?
Tyron:
My DJ’s studio was in Prenzlauer Berg by Kollwitzplatz. Back then that was still a grimey part of town. Like really grimey. He didn’t have a bathroom. You had to go out into the hallway to get to a communal bathroom. And there was no heating, so you’d have to carry up coal. There was mold on the walls. It was actually more nasty than grimey. Now it’s one of the most expensive places to live in Berlin.
Maxim:
A friend of mine who grew up here in the ’90s was explaining the gang culture from that
period to me. He mentioned the 36 Boys. Did you ever see any of that?
Tyron:
I know people that used to be OGs back then. There was a government funded integration program, called Respekt 2010, that I worked on a couple of years ago with a guy who used to be with them. Then a director that I worked with was one of the founding members. I know some of the older guys from that scene, but I was never involved in any of it. Kreuzberg used to be a kind of lawless zone, since the cops didn’t want to come in. Back then, coming from Cologne, I thought Berlin was really rough. Since I hosted a rap show, a lot of the guys here thought they had to test my cred. I had a gun pointed in my face once. Honestly, I didn’t really like it much in the ’90s.
Maxim:
When you said that they tested your cred, I imagined that you meant verbally. A gun is a little more than that.
Tyron:
It wasn’t fun. Usually it was just verbal. They would come and talk to you. And sometimes you just didn’t feel like the hassle. So one time I just ignored this guy, and kept walking to my car which I had parked in an alley. When I was pulling out he stepped in front of my car. Since I didn’t want to run him over, I stopped. Then he pulled out a gun, and aimed it at me. So I did end up running him over a little bit. It’s gotten a lot more chill. We were young then, too.
Maxim:
You said you got into hip-hop when you were a teenager?
Tyron:
Yeah, around ’85/’86. Like I said, there weren’t many role models for Black people in Germany. When rap music showed up, and the first movies started coming out, like Beat Street and Style Wars, I saw people that looked like me, doing something powerful. I was hooked. We immediately started imitating that, learning the lyrics, trying out our own little rhymes and raps. And we just kept doing that until someone actually got us a record deal. That was in ’92. Then I moved to Frankfurt, because I was studying design, and interning at ad agencies there. At the time, Frankfurt was the forefront of rap music in Germany, because of all the Americans there. A lot of the people that started it were from Frankfurt, Heidelberg, Mannheim.
Maxim:
When you started listening to hip-hop, were you listening to American rappers?
Tyron:
There wasn’t any German hip-hop until later. It was Ice-T and Kool Moe Dee. I didn’t even understand all the lyrics, so I’d make some up as I went along.
Maxim:
Because of the language barrier?
Tyron:
Yeah, they didn’t teach any of the vocabulary at school, and my father certainly didn’t use those words. Colors came out around that time, and we thought it was awesome. It’s funny, when you see that culture through the lens of film or music, you think that it’s so cool. You don’t understand where it comes from, or what it means to dress that way. When I was 21 and went to New York for the first time, all I could think was, man, I looked like these people but I am not like them at all. Living there, it’s an even bigger reality check.
Maxim:
Has that changed your enjoyment of hip-hop any? Do you prefer what some people call conscious rap?
Tyron:
I certainly prefer J. Cole and Kendrick Lamar to the really ignorant shit. I think when hip-hop started, and N.W.A would talk about their situation, it was still more progressive than it is now. They were putting it on the map. Now people do it because it sells. That’s why record companies keep picking it up. It doesn’t give people a direction. I don’t think it improves communities. Maybe that’s too easy. But no other music style uses so many words. Why don’t you make good use of what you say? Why talk about stuff that doesn’t propel anyone anywhere?
Maxim:
What if your situation is hopeless, and there is nothing realistic to propel people towards? Isn’t it natural to talk about what’s going on outside your front door?
Nobody likes standing on a corner day in, day out, selling crack. Nobody likes getting shot at.
Tyron:
That’s fine. My problem is with glorifying it. It isn’t cool to shoot someone. None of the people who live that life actually think it’s cool. Nobody likes standing on a corner day in, day out, selling crack. Nobody likes getting shot at. Black music in the ’70s, ’80s, and ’90s used to be different. Even if they did speak from a position in the hood, I always felt like the goal was to improve. Now it feels like people are more complacent, more willing to stay ignorant. But that’s just my opinion. I would also rather read The Glass Bead Game than listening to silly rap lyrics.
Maxim:
Do you read much Hesse then?
Tyron:
Funnily enough yes. I never read him in school, so I didn’t discover him until I was an adult, but I can relate to the way he describes things. I like how he manages to build a bridge between the rational and the mystical. Narcissus and Goldmund is one of my favorite novels. But I read other stuff as well. Right now I’m reading this Chinese philosopher, called Mencius, who lived during the times of Confucius. I like philosophy too.
Maxim:
Are you particularly interested in Eastern philosophy?
Tyron:
Yeah, I am into the old Eastern way of looking at the world. I am currently working on a documentary about my girlfriends interest in bridging western medicine with alternative healing methods. For this we want to travel around the world.
Maxim:
Did you pick that up when you were living in LA?
Tyron:
No, I’ve been interested in it longer than that. When I was in my early 20s I started doing Tai Chi Qigong because I had some problems with my hip. Western medicine told me to think about getting an artificial hip joint, so I went to get a second opinion instead, and luckily this doctor also practised traditional Chinese medicine. He put me in touch with a Tai Chi Qigong teacher. We got along well, and my hip healed up without me having to pop pills or undergo surgery. That’s what put me onto the philosophy and meditation.
Maxim:
And Tai Chi Qigong is a martial art?
Tyron:
It’s like a mix of Tai Chi which is a martial art, and Qigong which is a kind of meditation method. You have 18 slow movements, you regulate your breathing, and build up your Chi. It’s meditation, not fighting. I think the early Chinese thinkers managed to find a balance between mind, body, and soul. Sadly it’s mostly been lost on our culture.
Maxim:
What makes you happy?
I want to be a storyteller who tells valuable stories, instead of just making something shallow for quick cash.
Tyron:
I want to be a storyteller who tells valuable stories, instead of just making something shallow for quick cash. Lately, I’ve started writing and doing work behind the camera, not just acting. Right now I’m working with Christian Alvert on a film that I wrote, called Riptide. In it, I play a German doctor, played by me, who drifts out to sea after a surfing accident on the Canary Islands. He gets picked up by an African refugee boat that gets turned away by the Spanish coast guard. A couple of days later he sets out from the Moroccan shores with one other guy, trying to reach Europe as a European. I wanted to flip the script on a boat of refugees to someone from our own midst, forced to make that same journey. If I can tell valuable stories that can help to affect some kind of change, I will be happy with my work.
Tyron Ricketts is a 43-year-old actor, moderator, and storyteller living in New York City.
Get Well Soon
Interview — Get Well Soon
Der Liebe wegen
Mit seinem neuen Album „Love“ liefert Konstantin Gropper alias Get Well Soon gleich elf Perspek-tiven auf das Thema Liebe. Mit uns spricht der unaufgeregte Mannheimer über seine größte Angst, seine Liebe zur Natur und die Zusammenarbeit mit Jan Böhmermann.
3. Mai 2016 — MYP No. 20 »Mein System« — Interview: Jonas Meyer, Fotos: Maximilian König
Clip 1. Eine beschauliche Neubausiedlung mit gepflegten Vorgärten. Bei einem der Häuser öffnet sich das Garagentor, ein dunkelgrüner Jaguar fährt ein. Das Tor schließt sich wieder, ein gutaussehender, etwas älterer Herr steigt aus dem Wagen und trägt seine Lebensmitteleinkäufe ins Haus. In der Küche angekommen, bindet er sich eine weiße Schürze um und beginnt, liebevoll und akribisch das Abendessen zuzubereiten. Anschließend deckt er im Esszimmer für zwei Personen ein, legt ein Dinner Jacket an und zieht die Gardinen zu.
Einige Augenblicke später. Der ältere Herr genießt in vollen Zügen das Abendessen. Am anderen Ende des Tisches ist eine junge Frau zu sehen, die etwas apatisch wirkt. Der ältere Herr erhebt sich von seinem Stuhl, setzt sich direkt neben sie und streichelt sanft über ihre langen, leicht zerzausten Haare. Dann greift er zu einer Garnele, führt sie zum Mund der jungen Frau und lässt sie abbeißen.
Kameraschwenk auf ihre Arme. Diese sind mit schwarzen Kabelbindern an den Stuhllehnen fixiert. Nachdem das Abendessen beendet ist, löst der ältere Herr die Fesseln und führt die junge Frau in den Keller. Dort ist im Boden eine Falltür eingelassen, die er langsam öffnet. „It’s love, love, and I can’t get rid of it… It’s love, love, and I can’t make sense of it.“
Clip 2. Ein Einfamilienhaus irgendwo im Deutschland der 70er Jahre, davor ein Polizeiwagen mit eingeschaltetem Blaulicht. Während zwei Männer einen Leichensack aus der Einfahrt tragen, trifft der ermittelnde Kommissar am Tatort ein. Vorbei an den Beamten betritt er das Haus. Der Flur ist übersät mit Unterlagen, daneben finden sich in einem Koffer unter anderem Flugtickets, Handtücher und eine Packung Mehl. Mit dem Diktiergerät in der Hand nimmt sich der Kommissar Zimmer um Zimmer vor, begutachtet verschiedenste Gegenstände und sucht nach Spuren. Im Abfluss des Swimmingpools hat sich Schmuck verfangen, die Toilette steckt voller Dollarnoten, das Schlafzimmer ist ein einziges Blutbad. Was mag vor wenigen Stunden in dem Haus, in dem scheinbar ein prominentes Musikerpärchen gelebt hat, nur passiert sein? „We’ll on last leave, our love, it’s a specious leave, our love, and be ugly, our love, sincerely yours, my love.“
Clip 1 und Clip 2 sind die filmischen Interpretationen zweier Songs, die Konstantin Gropper alias Get Well Soon gerade auf seinem neuen Album veröffentlicht hat. Die Platte trägt den schlichten Titel „Love“ und setzt sich – man hätte es fast vermutet – mit dem Thema Liebe auseinander. So weit, so gut also. Oder doch nicht?
Wer die beiden Clips gesehen hat, der wird es ahnen: Die Perspektiven, die der 33-Jährige mit seinem vierten Album auf die Liebe wirft, sind – um es mal zurückhaltend auszudrücken – alles andere als alltäglich. Und so sitzen wir heute mit Konstantin bei seinem Label „Caroline International“, um bei dem einen oder anderen Getränk über ihn, seine Musik und die Liebe zu sprechen. Wir sind sehr gespannt.
Jonas:
Mit den Musikvideos zu deinen Songs „It’s Love“ und „It’s A Catalogue“ erzeugst du eine ganz eigentümliche Ästhetik: Bei dem einen Clip findet man sich im Deutschland der 70er Jahre wieder, bei dem anderen hat man fast das Gefühl, mitten in einem Ulrich Seidl-Film zu sitzen. Was fasziniert dich so daran, deine Musik auf diese Art und Weise zu erzählen und visuell zu hinterlegen?
Der Plan war, nicht einfach nur schöne Bilder zur Musik zu produzieren, sondern Filme zu schaffen, die im Kopf bleiben.
Konstantin:
Die beiden Videos waren als Vorboten meines neuen Albums gedacht. Mir ging es darum, den Begriff Liebe auf ungewöhnliche, ja extreme Art zu interpretieren. Der Plan dabei war, nicht einfach nur schöne Bilder zur Musik zu produzieren, sondern Filme zu schaffen, die im Kopf bleiben.
Jonas:
Regisseur der beiden Clips ist Philipp Käßbohrer, mit dem Du schon seit vielen Jahren zusammenarbeitest. Wie sehr warst du selbst in die Entwicklung der Filmideen involviert?
Konstantin:
Ich bin jemand, der relativ ungern kreative Verantwortung abgibt, aber mit Philipp habe ich jemanden, dem ich blind vertrauen kann. Und bei dem ich weiß, dass es gut wird. So war’s auch bei „It’s Love“: Philipp hat mir zu dem Song seine ganz eigene Filminterpretation präsentiert – und ich war geradezu schockiert, wie gut diese Idee zu dem Stück gepasst hat. Bei „It’s A Catalogue“ dagegen war ich ausnahmsweise mal etwas stärker in die Planung eingebunden, weil sich das Video inhaltlich sehr eng am Songtext orientiert.
Jonas:
Was verbindet euch beide?
Konstantin:
Vielleicht die Herkunft. Philipp und ich kommen aus derselben Gegend in Oberschwaben. Vor etwa 20 Jahren haben wir uns in Ochsenhausen im Jugendorchester kennengelernt. Seitdem sind wir einfach gute Freunde. Wir verstehen uns bestens, haben einen ähnlichen Geschmack und müssen einander nicht viel erklären.
Seit 2008 unterstützen wir uns auch beruflich bei den unterschiedlichsten Projekten. Philipp leitet die Kölner Produktionsfirma „Bildundtonfabrik“, eine Art Kollektiv aus Filmemachern, Designern, Animationskünstlern und anderen Kreativen, mit denen ich immer wieder zusammenarbeite.
Jonas:
„It’s Love“ erzählt die Geschichte eines älteren Herrn, der zuhause seine vermeintliche Geliebte bekocht und umsorgt, bis sich herausstellt, dass die junge Frau eigentlich seine Gefangene ist und im Keller versteckt wird. Mit welchen Reaktionen muss man bei der Veröffentlichung eines solchen Videos rechnen? Immerhin haben in den letzten Jahren vergleichbare reale Fälle – Stichwort Natascha Kampbusch oder Josef Fritzl in Österreich – für großes Entsetzen gesorgt.
Konstantin:
Ehrlich gesagt hatte ich mit wesentlich heftigeren Reaktionen gerechnet, als es dann letztendlich der Fall war. Aber der Clip wurde ja bezüglich seiner Ästhetik auch so gefilmt und umgesetzt, dass eigentlich jedem sofort klar wird, dass es sich hierbei um Kunst handelt.
Es gibt da übrigens eine lustige Anekdote: Im Vorfeld des Drehs haben wir parallel mit mehreren Darstellern über die Idee des Films gesprochen, unter anderen auch mit dem österreichischen Schauspieler Karl Markovics. Er sagte, er fände das Konzept richtig gut und man könnte das auch so umsetzen, aber er als Österreicher – das könnte er einfach nicht spielen. (Konstantin grinst)
Jonas:
Während „It’s Love“ in der Jetztzeit spielt, habt ihr die Story von „It’s A Catalogue“ in den 70er Jahren stattfinden lassen. Wie kam es dazu, dass ihr euch speziell für diese Zeit entschieden habt? Ich kann mir vorstellen, dass alleine die Beschaffung authentischer Requisiten aus dieser Zeit eine gewisse Herausforderung war.
Konstantin:
Dafür gibt es zwei wesentliche Gründe. Zum einen mochten wir ganz allgemein die Ästhetik dieser Zeit und fanden, dass eine solche 70er Jahre-Welt sehr gut zum Sound des Lieds passt. Zum anderen war der Sprung in diese Zeit eine Art Hilfsgriff, weil wir nicht wollten, dass der Film wie eine Szene aus einer Tatort- oder CSI-Episode wirkt.
Jonas:
Das Video erinnert schon ein wenig an manche Tatort-Folgen – jedenfalls an die frühen Fälle der 70er und 80er Jahre.
Konstantin:
Stimmt, vor 40 Jahren sah der Tatort tatsächlich noch so aus. Die Visualität der damaligen Zeit wollten wir ja auch aufgreifen – allerdings nach heutigen Maßstäben und auf dem neuesten Stand der Filmtechnik.
Jonas:
Als ihr das Video Ende Januar veröffentlicht habt, habt ihr euch mit folgenden Worten an eure Fans gerichtet: „And now it’s up to you… What exactly happened here?? Put on the forensic glasses and let the investigation commence. You have to watch it at least 10 times to figure it out (or you’re a lot smarter than me).“ Die Story des Films lässt also bewusst offen, was vor Ort tatsächlich passiert ist. Kannst du die Lösung verraten?
Konstantin:
Ich bin mir nicht sicher, ob ich da der richtige Ansprechpartner bin beziehungsweise ob meine Interpretation wirklich eine korrekte ist. Wir haben im Team natürlich immer wieder darüber geredet, was letztendlich passiert sein könnte. Aber ich weiß nicht, ob ich das verraten will. Jeder kann und soll hier seine eigene Theorie aufstellen. Ich finde, dass gerade das die Stärke des Videos ist. Vielleicht muss man den Film einfach nur öfter anschauen und auf die Details achten. Von daher sag’ ich nix.
Jonas:
Vor drei Jahren hast du dich in einem Gespräch mit den Kollegen von „laut.de“ als „bodenständiger Schwabe“ bezeichnet. Ist diese Eigenschaft Grund der peniblen Qualität deiner Arbeit?
Konstantin:
Penible Qualität?
Jonas:
Ja, genau. Sowohl deine Songs als auch die dazugehörigen Videos wirken bis ins Detail ausgearbeitet und durchdacht. Penible Qualität eben.
Musik ist von Natur aus immer ein wenig uneindeutig – aber gerade das ist auch das Schöne daran. Beim Film ist das im Idealfall natürlich auch so.
Konstantin:
Lustig, dass du das sagst. Mit meiner Musik bin ich wirklich sehr penibel. Aber mit den Videos habe ich ja selbst nicht so viel zu tun. Um die Konzeption und Umsetzung kümmert sich – wie ich bereits erzählt habe – hauptsächlich Philipp… Aber der ist ja auch Schwabe. (Konstantin grinst)
Es ist schon so, dass ich jemand bin, der gerne alles kleinteilig durchplant. Ob das letztendlich etwas mit schwäbischer Bodenständigkeit zu tun hat, weiß ich nicht. Ich habe bei mir selbst eher das Gefühl, dass es sich um eine Eigenschaft handelt, die ich auch bei anderen Künstlern beobachten kann – vor allem bei Künstlern, die ich sehr beeindruckend und inspirierend finde. Eines meiner großen Vorbilder beispielsweise ist Stanley Kubrick. Von Kubrick weiß man, dass er auch alles penibel durchdacht und geplant hat.
Jonas:
Auf der Website der Bildundtonfabrik findet man ein interessantes Zitat von Kubrick: „If it can be written, or thought, it can be filmed.“ Glaubst du, dass das ebenso für Musik gilt? Kann alles, was geschrieben oder gedacht werden kann, auch musikalisch transportiert werden?
Konstantin (zögert einen Moment):
Im Prinzip schon, allerdings ist Musik von Natur aus immer ein wenig uneindeutig – aber gerade das ist auch das Schöne daran. Bei Musik ist einfach die emotionale Komponente, die einen gewissen Spielraum für Interpretationen lässt, besonders stark ausgeprägt. Beim Film ist das im Idealfall natürlich auch so. Bei Kubricks Werken etwa gab es nie diese absolute Eindeutigkeit. Bei der programmatischen Musik, die ich mache, versuche ich daher auch, die Inhalte musikalisch immer so umzusetzen, dass jeder darin seinen eigenen Raum für Interpretationen finden kann.
Jonas:
Die programmatische Grundlage deines neuen Albums „Love“ ist das Thema Liebe, das du in insgesamt elf Songs aus völlig unterschiedlichen Perspektiven betrachtest. Wie bist du zu diesen Perspektiven gekommen? Und warum sind es gerade elf geworden?
Konstantin:
Warum es gerade elf Songs geworden sind, kann ich nicht sagen. Das ist einfach so passiert. Und wie ich zu diesen Perspektiven gekommen bin – da bin ich auch nicht wirklich Herr der Lage. Ich denke einfach über irgendetwas nach und dann stellt sich eine bestimmte Perspektive ein.
Dazu muss ich sagen, dass die Platte gegenüber dem Thema Liebe eine eher kritische Haltung einnimmt, die ich selbst in meinem Privatleben gar nicht habe. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich während des Songschreibens wesentlich nachdenklicher und reflektierter bin als im Alltag. So kamen diese unterschiedlichen, extremen Perspektiven auf die Liebe einfach aus mir heraus – als beispielhafte Geschichten diverser Protagonisten, die in den wenigsten Fällen etwas mit mir persönlich zu tun haben.
Jonas:
Das heißt, wenn du einen Song schreibst, ist das so, als würdest du ein Drehbuch entwickeln?
Konstantin:
Ja, teilweise. Bei den Songs, deren Titel auf der neuen Platte mit „It’s …“ beginnt, handelt es sich in den meisten Fällen um fiktionale Geschichten und Charaktäre, die ich für das jeweilige Lied entwickelt habe. Das ist im Prinzip das Gleiche wie bei einem Drehbuch: Man denkt sich eine interessante Biografie aus und erschafft dazu einen passenden Protagonisten.
Daneben gibt es aber auch Texte, bei denen die Figuren nicht frei erfunden sind, sondern sich auf reale Persönlichkeiten beziehen. So geht es etwa in „I’m Painting Money“ um eine Künstlerin, die in der Realität tatsächlich existiert.
Jonas:
Gibt es auf dem neuen Album einen Song, der dir persönlich besonders am Herzen liegt?
Konstantin (überlegt eine Weile):
Das kann ich so nicht sagen. Auf der einen Seite gibt es auf der Platte Songs, zu denen ich inhaltlich einen gewissen Abstand habe, weil sie rein fiktiv sind. Auf der anderen Seite habe ich für „Love“ Stücke geschrieben, zu denen ich ein sehr persönliches Verhältnis habe. Zu diesen Liedern gehört beispielsweise „It’s An Airlift“ – ein Song, in dem es um mein Vatersein geht.
Wie jeder andere ernsthafte Künstler würde auch ich mir natürlich wünschen, dass man meine Musik als Full-Time-Job konsumiert und sie nicht einfach nur so nebenbei hört.
Jonas:
Bei deiner Musik hat man das Gefühl, dass man sich total darin verlieren kann – vorausgesetzt man nimmt sich dafür die Zeit. Leider wird Musik oft nur noch als Konsumgut wahrgenommen und nicht mehr als ein künstlerisches Werk. Musik muss man gut und schnell verdauen können. Und sie muss zur jeweiligen Alltagssituation passen: Ob im Büro, beim Shoppen, Putzen oder Lernen – es gibt scheinbar für alles die richtige Playlist bei Spotify & Co. Wie siehst du diese Entwicklung?
Konstantin:
Wie jeder andere ernsthafte Künstler würde auch ich mir natürlich wünschen, dass man meine Musik als Full-Time-Job konsumiert und sie nicht einfach nur so nebenbei hört. Aber das kann ich natürlich niemandem vorschreiben – mir selbst gelingt das ja auch nicht immer.
Wenn allerdings bei mir Musik eher nebenbei und im Hintergrund läuft, dauert es nicht lange, bis ich sie nicht mehr hören kann. Das kennt wahrscheinlich jeder: Man putzt das Bad, lässt dabei das Radio laufen und merkt plötzlich, dass die Musik, die da gespielt wird, einem total auf die Nerven geht.
Gerade das empfinde ich aber oft als ein gutes Zeichen. Es spricht meiner Meinung absolut für eine bestimmte Musik, wenn sie einfach nicht als Nebengedudel funktioniert, sondern man sich wirklich auf sie einlassen muss.
Jonas:
Gibt es ganz aktuell Musik, in der du dich selbst verlieren kannst?
Konstantin:
Na klar, da gibt es es viele Beispiele. Ich versuche grundsätzlich, Musik immer so zu hören, dass ich mich darin verlieren kann. Neulich bin ich durch Amsterdam geschlendert und habe die neue Dagobert-Platte gehört – von Anfang bis Ende. In dieser Musik kann ich mich emotional total verlieren, das ist wirklich großartig. Dagobert schreibt meiner Meinung nach gerade die besten Liebeslieder. Daneben höre ich relativ viel Klassik, schon alleine deshalb, weil ich dort für mich musikalisch sehr viel finde. Gerade mag ich aber auch die Popmusik der 80er. Talking Heads, Roxy Music – das sind ja auch Platten, für die man sich ein wenig anstrengen muss.
Jonas:
Deine Musik ist auch eine, mit der man sich gerne ausführlicher beschäftigt. Würdest du selbst von dir behaupten, dass du erfolgreich bist?
Konstantin:
Für mich persönlich gesprochen bin ich insofern erfolgreich, dass Musik machen mein Beruf ist und ich davon leben kann. Das finde ich schon irgendwie amazing. (Konstantin lacht)
Jonas:
Wie man so lesen kann, zählst du mittlerweile zu den erfolgreichsten Filmmusikern in Deutschland.
Konstantin (lacht):
Warum auch immer, das stimmt überhaupt nicht.
Jonas:
Es ist doch nichts Schlechtes, wenn man von so einem Positiv-Nimbus umgeben ist.
Konstantin:
Naja, was die Leute so schreiben…
Jonas:
So ganz abwegig ist das ja nicht. Ein Beispiel: Im letzten Jahr hast du den Soundtrack zur TV-Sendung „Schulz & Böhmermann“ geschrieben. Alleine der Titelsong „When You’re Near To Me“ wurde auf Spotify bisher 100.000 Mal abgespielt. Wie kam es zu der Zusammenarbeit mit Jan Böhmermann und Olli Schulz?
Konstantin:
Jan und Olli gehören ja zu dem Kreis an Kreativen, die um Philipp und die Bildundtonfabrik herumschwirren. Da ich schon den Soundtrack zum Vorgängerformat „Roche & Böhmermann“ sowie für die erste Staffel des „Neo Magazin“ geschrieben hatte, war es einfach naheliegend, dass ich mich auch an die Musik von „Schulz & Böhmermann“ setze. Wir haben ja alle irgendwie miteinander zu tun, diese vielen gemeinsamen Projekte sind einfach ein gegenseitiges Aushelfen.
Jonas:
Gab es für den Soundtrack bestimmte Vorgaben, an die du dich halten musstest?
Konstantin:
Bei der Vorgängersendung „Roche & Böhmermann“ gab es seinerzeit den Wunsch, dass der Titelsong auf der „Fuge in g-Moll (BWV 578)“ von Johann Sebastian Bach basieren und im Stil der „Swingle Singers“ – einem US-amerikanischen A-Capella-Oktett aus den 1960ern – interpretiert werden sollte. So eine konkrete Vorgabe gab es bei „Schulz & Böhmermann“ nicht mehr. Die Musik sollte sich einfach irgendwie an dem orientieren, was es davor schon gab. Dabei sollte es trotzdem anders und eigenständig sein. Dass die Titelmusik letztendlich so James Bond-artig wurde, liegt an Kat Frankie, der Singer-Songwriterin, mit der ich den Soundtrack gemeinsam produziert habe.
Jonas:
Ist es nicht interessant, dass es bestimmte musikalische Merkmale gibt, bei denen man sich sofort an bestimmte Filme erinnert fühlt?
Konstantin:
Ehrlich gesagt hatte ich überhaupt nicht darüber nachgedacht, dass da irgendeine Verbindung bestehen könnte. Erst als Kat mich darauf hingewiesen hat, ist es mir aufgefallen.
Es gibt eine ganz bestimmte Phase in meinem Beruf, in der ich immer wahnsinnig große Angst habe: Zwischen dem Tag, an dem ich ein Album fertigstelle, und dem Tag, an dem es veröffentlicht wird, liegen meine Nerven absolut blank.
Jonas:
Gegenüber den Kollegen von „laut.de“ hast du vor drei Jahren auch erwähnt, dass du bezüglich deiner musikalischen Zukunft nicht weißt, „wie lange das alles noch seine Relevanz hat“. Kannst du dir vorstellen, die Musik komplett fallen zu lassen und etwas ganz anderes zu machen?
Konstantin:
Es gibt eine ganz bestimmte Phase in meinem Beruf, in der ich immer wahnsinnig große Angst habe: Zwischen dem Tag, an dem ich ein Album fertigstelle, und dem Tag, an dem es veröffentlicht wird, liegen meine Nerven absolut blank. In dieser Phase schaue ich immer schon vorsorglich auf „ImmoScout“, ob irgendwo eine Kneipe leer steht, die ich übernehmen kann.
Ehrlich gesagt ist es aber schon so, dass ich gar nicht wüsste, was ich anderes machen sollte als Musik. Es ist eben nicht nur das, was ich am liebsten tue, sondern auch das Einzige, was ich wirklich kann. Daher ist meine momentane Berufssituation auch ein absolutes Traumszenario. Warum sollte ich das aufgeben – zumindest freiwillig?
Jonas:
Es gibt viele Künstler, die aus einem ganz normalen Leben ausgebrochen sind, um sich ganz alleine der Musik zu verschreiben und deshalb nicht selten am Existenzminimum leben. Du selbst bist dagegen in einem Elternhaus aufgewachsen, in dem Musik machen und Geld verdienen nicht unbedingt ein Widerspruch war – dein Vater hat als Musiklehrer gearbeitet. Hat diese Situation dir dabei geholfen, gar nicht infrage zu stellen, dass Musik etwas ist, von dem man in irgendeiner Art und Weise leben kann?
Konstantin:
Nein, überhaupt nicht. Ich habe nie ernsthaft in Erwägung gezogen, Berufsmusiker zu werden. Ich dachte, das sei unmöglich. Musik habe ich eher nebenbei gemacht, sowohl während meines Studiums an der Mannheimer Popakademie als auch an der Uni in Heidelberg, wo ich einige Semester Philosophie studiert habe. Auch als ich später nach Berlin gezogen bin und dort mein erstes Album veröffentlicht habe, habe ich mich sicherheitshalber wieder an einer Uni eingeschrieben. Ich hätte nie ohne irgendeinen Plan B alles auf eine Karte gesetzt und von Anfang an nur Musik gemacht. So bin ich einfach nicht drauf. Glücklicherweise hat sich im Laufe der Zeit das Ganze dann so gut entwickelt, dass ich für nichts anderes mehr Zeit hatte und irgendwann auch davon leben konnte.
Für mich bedeuten Landschaft, Wald und ein weiter Blick immer noch Idylle. Und irgendwie ist diese Idylle für mich schon immer ein Sehnsuchtsort gewesen.
Jonas:
Hast du es im Laufe deiner Musikerkarriere jemals als einen Nachteil empfunden, aus einer eher beschaulichen Ecke Deutschlands zu kommen und nicht in einer Metropole „am Puls der Zeit“ aufgewachsen zu sein?
Konstantin:
Das ist reine Geschmackssache. Ich persönlich empfinde das eher als Stärke. Für mich bedeuten Landschaft, Wald und ein weiter Blick immer noch Idylle. Und irgendwie ist diese Idylle für mich schon immer ein Sehnsuchtsort gewesen. Ich glaube, das kann man auch am Cover der neuen Platte ablesen. Wenn ich meine Musik so betrachte, weiß ich, dass es einfach keine Szenemusik, keine hippe Musik ist. Vielleicht liegt das tatsächlich daran, dass ich mit so etwas nicht aufgewachsen bin. Wer weiß. Bei uns gab’s und gibt’s halt keine Szene.
Ich muss gerade mal genau überlegen: Ich glaube, in meinem Freundeskreis gibt es auch fast niemanden, der in einer großen Stadt aufgewachsen ist. Da kommt nahezu jeder vom Dorf – maximal noch von so etwas wie Mannheim. Unser Tourmanager zum Beispiel lebt in Saarbrücken und kann sich nicht vorstellen, von dort wegzuziehen. Ganz im Gegenteil: Er findet es eher doof, dass jeder nach Berlin will. Dort in der Ecke herrscht halt einfach ein großer Lokalpatriotismus.
Jonas:
Es gibt dort ja auch gutes Wasser, gute Luft, …
Konstantin:
… und guten Wein. Ich sehe das mittlerweile ähnlich. Ich würde zwar nicht wieder voll auf’s platte Land ziehen wollen, aber irgendwie weiß man es dort schon zu schätzen, dass man dort einfach Platz hat.
Jonas:
Wirklich lange hat es dich in Berlin ja auch nicht gehalten: Vor einigen Jahren bist du zurück nach Mannheim gezogen. Hat dich die Stadt genervt?
Konstantin:
Nö, eigentlich nicht. Mich nerven zwar schon einige Dinge an Berlin, aber das sind Kleinigkeiten. Ich war und bin immer wieder gerne hier. Mich hat es damals einfach aus privaten Gründen an einen anderen Ort verschlagen.
Jonas:
Wegen der Liebe also.
Konstantin:
Wegen der Liebe, ja. Letztendlich schon.
Konstantin Gropper ist 33 Jahre alt, Musiker und lebt in Mannheim.
www.youwillgetwellsoon.com
www.facebook.com/youwillgetwellsoon
Asbjørn
Interview — Asbjørn
Leading The Dance
Once a fan from Finland asked Danish musician Asbjørn to help him get the girl. No wonder the matchmaker was successful, because his groundbreaking visual storytelling goes straight into our heart. Find out why!
3. Mai 2016 — MYP N° 20 »My System« — Interview: Jonas Meyer, Photography: Steven Lüdtke
Jonas (talking about the recording device):
It looks very old, doesn’t it? But actually it still works. Do you have something that is with you since you’ve had you’re first gigs?
Asbjørn (thinking):
I don’t care that much about this kind of stuff. But it’s funny, it’s this particular thing which is the main item when you do an interview. You look at it every time and you have a relationship to it. I don’t feel like that with any of my gear. But I do have a very old teddy bear that I got just when I was born. Still sleeping with that.
Jonas:
I read that the name Asbjørn is a combination of two words that mean „god“ and „bear“. Is that right?
Asbjørn:
Yeah, exactly.
Jonas (joking):
So the teddy is one part of your name.
Asbjørn (smiles):
Yeah.
Jonas:
Now you just have to find the „god“-part.
Asbjørn:
Yeah, I’m tryin to find that all the time.
Jonas:
A few weeks ago, you published your new record called „Pseudo Visions“. Could you explain what’s meant with this title? Sometimes people have visions, but what is a „Pseudo Vision“?
Asbjørn:
It was a definition that came pretty much out of the blue while I was writing what to me is one of the most important songs that I have written, „The Love You Have In You“. „Pseudo Visions“ became part of the lyrics and I just knew when I sang that out loud that it’s going to be a defining thing for the record. To me it’s about those moments that are so fucking intense that you can not avoid them. You have to be in them even though it seems almost dreamlike or maybe too intense, maybe you can’t deal with it in the moment really. But it’s unavoidable and important, this kind of moment. And that’s what I write songs about basically. Those moments.
Jonas:
So a „Pseudo Vision“ means extra-reality or more than reality.
Asbjørn:
Yeah, exactly. Where the world is surreal in itself and your own head and your own feelings seem like a revalation to you all of a sudden. You look at something in a new light. I think that’s why so many artists write songs about love because that is of course one of the „Pseudo Visions“, that is the kind of intensity. You have to be in it, there’s no way around it. And heartbreak is another, because you have to deal with it. It’s such a clean feeling, that kind of pain. There’s no cleaner pain than heartache.
Jonas:
I asked because „Pseudo Vision“ is the first big word that comes up when one tries to get in touch with you and your music, find out who you are and what you’re doing. And it’s interesting because when you click on your website and you see this name Pseudo Visions, you see that it’s these episodes of videos: every song is combined or related to a video. To me it felt like starting a new Netflix series.
Asbjørn:
Mh-mh.
Jonas:
You start with the first episode, then you can’t stop watching and you watch the next episode, and then the episode after that. And you come to a point when there’s no video left and you think: „Damn! When does the next season come out?“
Asbjørn:
That’s great! To me, it’s like that.
Jonas:
It’s a very innovative way to tell the story of your music. I’ve never seen it before. How did this idea come up?
Asbjørn (laughs):
First of all, I was really drunk…
Jonas:
That’s always the situation for good ideas!
Asbjørn:
…and I was hanging out with some friends of mine called Anders and Thomas that I’ve known for a long time. It was the year before we had made the video for „Strange Ears“ which was part of the first record. We were sitting there, it was really late and we’ve been smoking cigars and drinking Whiskey. I felt really drowsy and I think I was like: “Hey guys, how about just making a shitload of videos?” And they were like: “Yeah cool, let’s do it!” When I woke up the next morning I just knew that it was in fact a good idea, because suddenly I could start making music in a less long-term, less serious way. It was a very quick way to create that concept and say: „I got to just finish four songs, I got to just be happy with them“ and then I make the videos and get it out there. Then you move on to the next chapter where you’re free to do whatever, because especially the way I’ve been making my music takes a long time. I’m so into the whole production part and into testing everything and playing around that it is a very slow process. It’s a fact that if I wouldn’t make a full record in one take, but during two years, the first songs would be in a totally different place than the last songs. That’s what happened as well with „Pseudo Visions“. The whole concept was a way of saying that it’s okay to develop like that.
Jonas:
It can be stressful to work with friends.
Asbjørn:
Yeah, but I always do. And that’s why it’s possible as well. I would never be able to fit into that kind of gameplan of working with the „right“ people who don’t touch me. I’ve been in a lot of situations being put in a studio with a hit producer, having to make a hit song because my „big break“ was supposed to be right there if I just make this one song with this guy. So I’ve been sitting there making a really well-composed song and a very smoothly danceable production, but I didn’t give a fuck about it. And that’s what happens when you’re not fascinated by the people whom you work with – not only with the craft, it has to be the person for me. That’s when you surprise yourself, that’s when you expose yourself and get into some new freaky situation that you haven’t been in before.
Jonas:
There are two sides to the music business: one side is having to create something that sells, that people can approach and that pays your flat rent. The other side is being a serious musician, a real artist. Is it possible to make pop music that sells and to be a serious artist at once?
Asbjørn:
I think it’s about pop being natural or unnatural. For me, pop is very natural, I’m not afraid of pop, I love pop music.
Jonas:
There are people who are afraid of pop?
Asbjørn:
I think it’s getting better. I think we’re actually in the middle of a revolution in pop music. Very few people now actually feel ashamed saying they listen to pop music, whereas I remember growing up and having discussions with all the cool kids in town who were listening to Coldplay, Radiohead and Portishead that I really wasn’t into. And how they kind of shamed me for being such a pop boy because I loved Spice Girls, Backstreet Boys, Britney, Destiny’s Child and all of these extremely poppy artists.
Jonas:
What do you think is the reason why especially young people have a problem with pop music? Is it because it’s not differentiating since everybody is listening to it and they don’t want to be like everybody else?
Everybody is looking for their individuality and that process is so much more open now, also for the major popstars.
Asbjørn:
Of course everybody is looking for their individuality and that process is so much more open now, also for the major popstars. I think nobody is interested in conceptualized manifactured artists anymore. Everybody wants to see something real and that really is a conflict right now because on the one side we have youth culture that wants the real deal and we have the major label part of the industry…
Jonas:
…that wants to sell…
Asbjørn:
…and that wants to find the real raw talent. But then they want to conceptualize it, and there’s a specific kind of „real“ that is the „right real“ and then there is the „wrong real“. That makes it confusing because everybody just wants to be touched I believe. I think it’s becoming easier because artists who are within this major industry are generally more in control and have the chance to show who they are.
Jonas:
I’d like to talk about the very first music video that’s on your website. The first episode or first chapter, „Brotherhood“. The scenery starts with a very nice location somewhere in a small town. Is this where you grew up? Is it comparable to the place where you grew up as a child, as a youth?
Asbjørn:
Actually I lived totally on the countryside. The scene in the video is a very nice kind of neighborhood with the houses all the way down the road. I grew up on the countryside at this boarding school for grown-ups where people went to study music, theater, philosophy or writing for half a year. So I was raised with 130 siblings that went away and came back every half year. I got a totally screwed up relationship to ambition I think, because they went there and they just did something for half a year. They did it so much, there was no stopping them. That’s really where I learned to love music and to do it the way I do it. But of course the whole opening scene of Brotherhood is the transition from reality into surrealism. Chapter one is about surrealism and chapter two is about realism.
Jonas:
Would you say you had a happy childhood and youth or would you say it was complicated to grow up in such a small environment on the countryside?
Asbjørn:
That wasn’t the difficult part, that was the great part about my childhood. Because that was kind of like a mini-Berlin at that school…
Jonas:
…like a bubble.
Asbjørn:
Yeah, very much! And there were no pointy fingers, you just had to let loose and let it happen and anything was good really. Everything you wanted to be was accepted.
Jonas:
It’s very Scandinavian, right?
Asbjørn:
That mentality?
Jonas:
Yes, this very open-minded mentality. Because on the German countryside it’s not that easy for people.
Asbjørn:
Well, it wasn’t the countryside, that’s the thing. It was the school and that philosophy surrounding the school. I think any small town gives the weird kids a hard time, so I did have a hard time going to school but the great thing about it was that I had my oasis at that school where we lived. When I went to my regular school I could deal with anything because I had this strength from the whole vibe of my childhood home.
Jonas:
When and why did you decide to go to Berlin? It sounds very nice and it seems like you have everything that you wanted in this area and in your life there.
Asbjørn:
Adventure. You might see Scandinavia as an open-minded place, I wouldn’t say that it generally is. I would say everything is very much in order. There are no real risks you can take and I think people get lazy in Scandinavia because of that, maybe myself included for a while. It was a very kind of instinctive thing for me that whenever I would tour in Germany and end up in Berlin I would feel at home. I think that’s the same story that every artist that moves there tells…
Jonas:
…every lost person that comes to Berlin.
Asbjørn:
Yeah! The difference is how you deal with that chaos in Berlin. That is definitely one of the things that attract people as well, this overwhelming mass of opportunities and self-destruction and everything that the city has to offer. It totally destroys a lot of people and puts them on a wrong path, but it’s so fucking exciting to flirt with that border within yourself. That’s why artists are here because you have to choose self-destruction sometimes and then, at some point, you have to get back on track.
Jonas:
Sometimes it can be very creative, but you have to be careful. You can get lost in this city.
Asbjørn:
Yeah.
Jonas:
I can’t imagine that you have a problem going back from time to time. I think for you it must be very healthy and mind cleaning to visit your family in Scandinavia. Or is there a growing wall that brings you in the situation where you say: „Okay, I feel home here and I can’t handle my background anymore“?
Denmark is the calm, soothing stimulant that I need sometimes: going to the ocean and cleaning my mind.
Asbjørn:
No, I think those places have an oasis-kind-of-feeling for me. Of course, Denmark is the calm, soothing stimulant that I need sometimes: going to the ocean and cleaning my mind. I think I’m slowly accepting that I won’t ever find that state of mind in Berlin, and that’s cool. I got to find that in people then. Instead of nature or silence, I have to find this calm, soothing feeling in actual human beings, which I think is a great thing.
Jonas:
That’s a wonderful sentence.
(Asbjørn laughs)
Jonas:
I’ve never saw it that way. Berlin is a city of lost people, most people come from small places where they aren’t accepted for who they are, so they escape. They’re alive in this bubble, feel good and can’t imagine to go back. I think that point of view, this sentence of yours could help a lot to feel better in a lost environment where you don’t know anybody.
Asbjørn:
I think exactly the same. There are all these lost little creatures that end up in Berlin and all of us are strolling around each other and meet each other by coincidence. We got to find a way to really make it worthwhile that we’re here at the same time and that we don’t just become people passing each other, that we actually let each other be home.
Jonas:
We could sit in the metro and look at each other as strangers or we could sit anywhere and have an interview. It’s a coincidence.
Asbjørn:
Yeah.
Jonas:
The best thing in a big city is when you have a mutual relationship with your city. You take something and you can give something. Would you say you are in such a mutual relationship with Berlin? And if yes, what do you take and what do you give?
Asbjørn:
Good question.
Jonas:
Because a mutual relationship means having really arrived somewhere.
Asbjørn:
I think I give all of my best and most positive energy to the city and to the people. The city makes me want to give that everytime I go out. It makes me want to make eye contact with people, talk and hear people’s stories, dance. That’s the mutual thing really, because there is this unsaid life rule in Berlin it seems: you got to do it to the fullest, whatever you do. Whether it’s hugging way too much or falling madly in love, dancing: there’s no doing it halfway, you got to really do that move all the way out because that’s the intensity that everybody lives by. That’s why you get fascinated with so many people and the city.
Jonas:
You are in the really happy situation that you grew up in an environment where people were open-minded. In your school, it was okay who you are, who you’re with, what you want to do. There are a lot of young people that grew up in a town, in an environment of family and friends where they had to hide and where they didn’t have the courage to tell people who they are and what they want. So would you say your music or your art is giving these people some courage or power? Or is it too big of a picture?
Asbjørn:
I’ve never intended to do that because I really didn’t have that perspective on anything when I started making music. It was just for me. But what happens along the way when people start reacting to the music and start telling me their stories…
Jonas:
…but you know that there are these stories?
I can’t do anything about the fact that a guy from South Africa writes me that he is madly in love with his classmate but he can never tell him that because his father is a cop and he could get killed for showing this kind of love.
Asbjørn:
Exactly. It’s actually a pretty wonderful thing because a lot of my fans write me about their situations and I feel very lucky and fortunate that they want to tell me their stories. A lot of them are great stories about how they find a power within themselves through listening to a song of mine, which is fantastic. But then it’s always a feeling of powerlessness for me, too, because I can only do so much. I can only write these songs that help me and help some people on some level in their minds, but I can’t do anything about the fact that a guy from South Africa writes me that he is madly in love with his classmate but he can never tell him that because his father is a cop and he could get killed for showing this kind of love. Instead he chose to start a club for all the freaks and all the sexually curious people who don’t fit in the stigmatized world they live in. They meet up there and they listen to music and they talk about real things and give each other strength.
Jonas:
Is it a secret club?
Asbjørn:
Yeah, it has to be. And these stories are very hard to read because I can’t do anything specific to help this guy.
Jonas:
You make music.
Asbjørn:
That’s it, but…yeah.
Jonas:
I read that you said that there’s a lack of emancipation in pop music because there are so many women that have been successful in the last 40, 50 years and there aren’t a lot of men like that. At the moment, there are bands like Years & Years. Olly Alexander is a very good example for a new idea of pop music: a young men who knows exactly who he is and is totally open with it. Sam Smith is another example. They show that maybe pop music can change something.
Asbjørn:
Something is definitely happening, indeed. It’s great because when I started out, there was nothing like this really.
Jonas:
It started just a few years ago.
Asbjørn:
Like five years ago, there was nobody. Basically since I wrote an essay for „Nothing But Hope And Passion“ about this problem of a lack of diversity within the male pop icons, since then it’s just been developing so much and I can only blame it on youth. It’s something that started very naturally from a youth culture that needs a broader perspective in their everyday perception of the world. That’s when boys start to be more open towards themselves and stop worrying as much about the masculinity as this locked down muscly stereotype.
Jonas:
There are people that can change the world with music. Do you have some special musicians in your heart that are very inspiring to you and that belong to this circle of icons that could change something?
Asbjørn:
Well, David Bowie definitely is one of them, and he remains that. I had a really weird day that day, scrolling down the feed and looking at all of these sad RIP posts. I like his latest record, it’s intense. But I was so sad to see that everybody was mourning instead of celebrating. That man has to be celebrated, he was so strong until the very end.
Jonas:
Not only in a music-related way. I mean, he was the guy who said it’s okay to be different, to be a freak. Because that makes you interesting.
Asbjørn:
Yeah, exactly. He’s been so important and he’s going to remain probably the most defining man in pop culture. We just got to remind ourselves to aspire to be just a bit of that now, to continue his heritage. I find weird that, on the female side, we have so many women who have fought for diversity and freedom to be the kind of woman they want to be. That’s been happening for decades. On the other side, we have David Bowie who started around the same time as Madonna and he has in no way defined pop culture in the same way as Madonna has. David Bowie has only defined subculture and underground.
Jonas:
I would say he defined a state of mind.
Asbjørn:
Definitely.
Jonas:
By the way, there’s this wonderful picture that you use in one of your videos: the music tape. I think it’s a very beautiful symbol because it shows that you can give music away. I can donate music to someone I like.
Asbjørn:
Good old mixtapes.
Jonas:
Yeah! I mean, today all the romantic part is gone. When I want to share or give you some of the music I like, I send you a link. Or I create a playlist on Spotify for you. How romantic is that?
Asbjørn:
Yeah, it’s sick.
Jonas:
It’s a little sad, so it was nice to see this picture.
Asbjørn:
I actually have my first tape now as well. It was for this special vinyl box I did for Pseudo Visions. We made like fifty cassette tapes and it was the best feeling to stand with my own tape. Bigger than standing with my first vinyl or CD. It was like: this fucking thing, that’s my childhood. It’s a very romantic, nostalgic feeling because I knew on all my tapes exactly at what second my favorite song started. It was great.
Jonas:
How could you give music today to another person in a very individual, personal way? Is it still possible? Besides sending a link.
Asbjørn:
I think the best way is to go to a show, really.
Jonas:
You mean to take someone to a show?
Asbjørn:
Yeah. I think we did destroy the romance a bit, but going to a show and being so there, so present in that moment – that’s gonna be something you remember. That’s gonna be romantic for sure.
Jonas:
That’s just possible with artists who are still alive. I mean, everybody has three, four music artists in their hearts that they’re still carrying with them their whole life, and most of these artists aren’t alive anymore. So how to share?
Asbjørn:
Are most of your heroes dead?
Jonas:
Some, not all. You would have to take someone to your place and listen to music together.
Asbjørn:
Yeah, or make a Spotify club where you actually listen to albums once a week or something.
Jonas:
From the past to the future: as I already said, you wrote on facebook that you haven’t been out for days because you’re writing new stuff. What is going on in your head at the moment, music-wise?
Nobody is writing me mails, I’m so bubble-minded right now, which is great. I think I’m having a lot of fun on my own at the moment.
Asbjørn:
I think I’ve been surfing on a wave the last six months, pretty much from making the last video to Scandinavian Love, touring and doing the whole album release in Europe. It’s been intense and I never settled down after that whole craziness. So I wake up and I’m just making music every single fucking day and it’s amazing. It’s like the world has finally understood that I don’t want to deal with it right now. Nobody is writing me mails, I’m so bubble-minded right now, which is great. I think I’m having a lot of fun on my own at the moment. It’s the first time that I’m producing a whole record on my own. I think at some point, I’m gonna have to finish it with somebody else because I want to be surprised with this record myself. It shouldn’t be exactly how I want it to be. You want to push it further. So yeah, I’m just working on my masterpiece really.
Jonas:
To me, it seems like you started a new chapter with „Scandinavian Love“, referring to the visual world you’re creating. Everything is very clean, you have a lot of strong pastel colours. Everything seems to be in order. Why did you make this visual mind shift? And is there a relation to the story or to the music?
Asbjørn:
You’re totally right. „Scandinavian Love“ was not really supposed to be on the Pseudo Visions album because I finished it in Denmark and then I moved to Berlin. Scandinavian Love was the first song I wrote and produced on my own here. I just had to include it, there was no way around it, even though I knew that it was a new direction. It’s a bit more in your face, a bit younger, because when I moved to Berlin I found out that I really had to be young still. I’ve been super focused since I started and that was the best thing for me, to allow myself to be young and stupid, more blunt and more direct in my music. There’s a lot of poetry and a lot of universal sense in that teenage kind of feeling that I’m experiencing a bit now. I think everybody relates to that and it’s nice to include all of the less poetic things into something that is art and is just exposing yourself really. There’s a lot of ugly sides to being human as well, a lot of shallow thoughts. I want to include that and I don’t want to be afraid to do that.
Jonas:
I think one of the most intensive ways to express yourself is your dance. As I said, I’ve never seen the idea of doing music videos in this order, chapter for chapter. To be honest, I’ve also never seen a person that is so intensively dancing on a small stage. Is the dance always existing first and then you add your music to it or do you create your music and add a dance to this component?
Asbjørn:
It varies a bit. Starting by being extremely fascinated with pop music and African music when I was a kid, dancing has been very important indeed. To me, those tempers are super exciting to work with: either I dictate the music with my body or I dictate my body with the music. I have to change between the two and I think it’s a great thing because it makes me be very intensively in my head and then let it go and be in my body.
Jonas:
It’s very interesting: when you go to a rock concert, the bands are playing and people in front of the stage start to pogo and dance. When I visited your concert, people were dancing but they weren’t able to dance as intense as you did. So you turned the picture, you know what I mean?
Asbjørn (laughs):
That people should go crazier than me?
Jonas:
It was interesting to see. You were leading the dance.
Asbjørn:
Yeah, indeed. And I can’t help it, if there’s three people in the crowd I would still do it because that’s a part of music for me. It’s impossible not to dance.
Jonas:
But what is happening with you in that moment when you’re dancing on stage and people are in front of you, looking at you. Do you see their faces, do you see what they express, how they react? Or are you in trance?
Dancing is sex basically. I have to look at people, I have to move slowly and have time to feel my body and get inspired by theirs as well.
Asbjørn:
No, I’m always very aware. Dancing to me is a very sensual thing. That’s primarily also why I very rarely go to techno parties here. I very rarely go to Berghain or stuff like that, because to me dancing is primarily about… dancing is sex basically. I have to look at people, I have to move slowly and have time to feel my body and get inspired by theirs as well. And a lot of the time, techno and techno culture doesn’t allow that. That’s the bubble, that’s the trance state of mind that I find boring. To me, it’s about people and exchanging energy and finding your sexuality and your body.
Jonas:
In techno clubs everybody is in their own bubble. It’s very hard to get in contact with people.
Asbjørn:
Exactly, and I don’t want people to feel like that at my show. Of course it’s great to stand at a show and zone out and just being consumed by the whole feeling, but I love when people look at each other and they meet somebody at my show that they connect with via dance. I think that’s one of the greatest situations: dancing with people you know nothing about, because you can tell so much about a person by the way they express their bodies on the dancefloor. If we just let each other in there I think we know each other pretty well already.
Jonas:
Is there a difference between the cities and the people living there related to their reactions or how they dance? Can you see that?
Asbjørn:
Obviously, Berlin is super flamboyant. People are very out-going and express themselves. But everywhere I go, my show is a chance to let go of your brain and your self-consciousness like I do and let your body talk instead of your mind. It happens pretty much everywhere. There are always people letting go and that’s why I love playing. No matter how many people do it, it’s a fantastic feeling when you let go.
Jonas:
You said that you get a lot of reactions, texts or letters. What’s the nicest compliment you’ve gotten?
Asbjørn:
I got a really cute message from a ten-year-old guy from Finland.
Jonas (surprised):
Ten?
Asbjørn:
A ten-year-old guy from Finland who was so in love with this girl in school. She really liked one of my songs, so he asked if I could make a videoclip where I asked her if she wanted to be his girlfriend. (laughs) It was the greatest thing to help that guy out. It worked, she wanted to. It was a very big thing for me to be the matchmaker. I was very honored to have played that role in their lifes. It’s so sweet!
Asbjørn is a 23-year-old music artist living in Berlin.