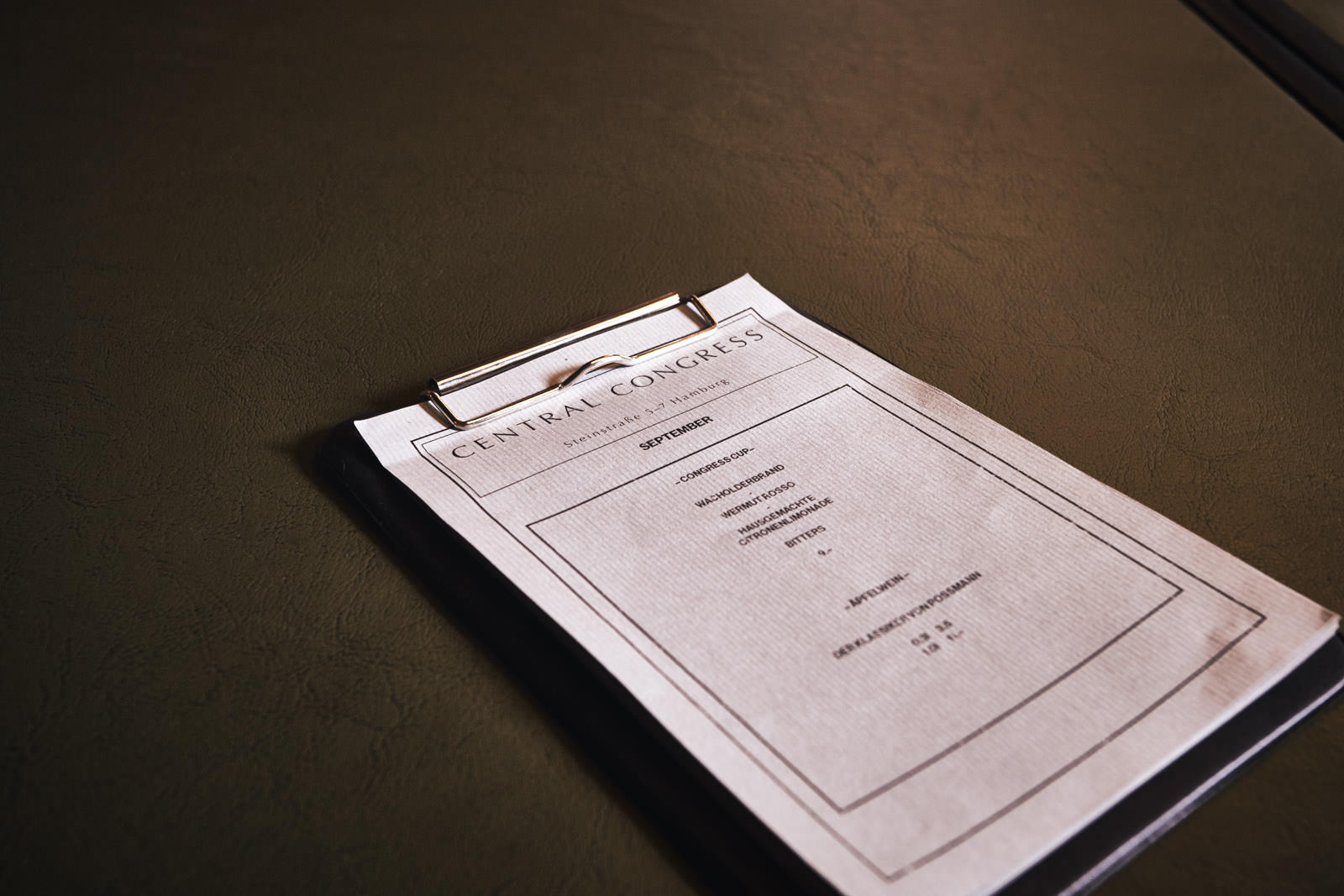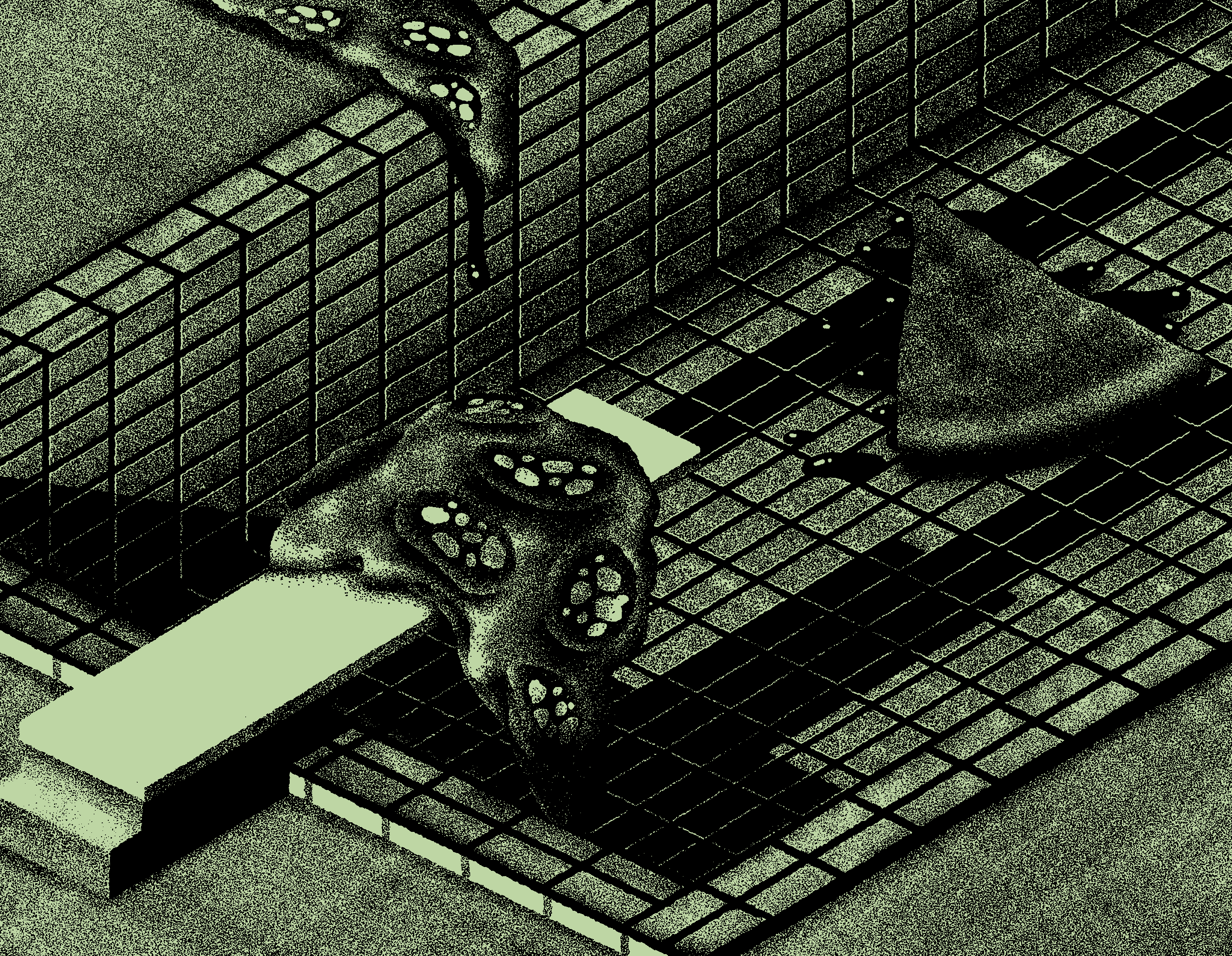Sion Hill
Interview — Sion Hill
Honest Music, Honest Drinking
During a wild night with Irish singer Nathan D. Hollingsworth Johnston, we found out about the roots of his sexy sound and to which song he used to make out in high school. Get your Whiskey Sour ready and get ready to know Sion Hill!
27. November 2017 — MYP N° 21 »Ecstasy« — Interview & Text: Katharina Weiß, Photography: Steven Lüdtke
Can you recall the good ol’ days of Rock ’n’ Roll? No? How about the good ol’ days of journalism? No? Join the club; Irish singer Nathan D. Hollingsworth Johnston, currently touring under the name Sion Hill, and I can’t either. Both born in 1994, we’re just too young. But we didn’t let a tiny detail like that stand in our way of spending a day living it up as they did back in those golden eras of popular culture. That included heaps of live guitar music, non-pretentious lyric improvisation, and a fair amount of whiskey—in short: Honest music and honest drinking!
Since you’re already reading this online, take a second to open Spotify or whatever streaming service you fancy and play Sion Hill’s recently released album Elephant. This interview will be a much better read with the proper soundtrack. Drinking a Whiskey Sour at the same time might not be such a bad idea either…
Elephant is a brilliant, spontaneous-sounding piece of solo-male pop with some 60’s elements and carefully used jazz skills—all wrapped in a handsome-but-never-too-slick dandy look. Johnston’s melodies have a very modern twist to them and there is not a single song in which his voice gets buried under autotune effects. It’s a very straightforward style which showcases the wide range of stories he is able to tell with his guitar (and sometimes on the piano, too!). The sexy, drum-driven intro song Nothing’s Wrong with Loving You might as well be called Nothing’s Wrong with Listening to Sion Hill; the ballad All I Need is You will make you want to call your ex; and when he brings up the song Storm, you’ll be dying to drink a very dirty Martini while doing very dirty things with James Bond. And that’s just the debut album. If you search the internet, you will find an even wider array of tracks, most of them filmed live in a bar or on some street. In a song called Go On And Get It For Me recorded in a barbershop in Dublin, his tongue is so swift, it almost sounds like rapping.
But the best thing about all of this: Nathan D. Hollingsworth Johnston is able to share these feelings without hours of technical constructions. When we meet him at The Ballery in Schöneberg, it takes barely five minutes for him to start jamming on his guitar with the venue’s host, Otto, accompanying him with some Cuban rhythms on the piano. The Ballery, at Nollendorfplatz, is a space for all the beautiful things in life. Directed by British producer & curator Simon Williams and Cuban art director Otto Oscar Hernandez, it’s program features talks, concerts, and exhibitions from a community of influential Berlin-based artists. Sometimes it is a speak-easy, sometimes there is someone playing Schubert and Chopin – and today it’s the place for a private concert by this hot new Irish act.
After a glass of wine and some more improvisation, Johnston and I finish up at The Ballery and move on to the intimate atmosphere of Reza, a smokers café with vintage interior and illustrious guests. What happened there felt less like conducting an interview and more like getting fashionably drunk with someone who has the wit and gall to fill a whole evening with hilarious anecdotes ranging from tales of Catholic all-boys high schools to touring with Pete Doherty. Get your Whiskey Sour ready and get ready to know Sion Hill!
Katharina:
What is the thing with you and elephants, why did you name your first album after them?
Nathan:
When I lived in Berlin, I often played on the streets under that bridge at Hackescher Markt. There was this homeless Polish guy who came up to listen to me every day. And obviously, he never had anything to give me, so he would give me cans of Carlsberg Elephant. You know that one? 12.5 percent, most disgusting beer you could ever drink. But such a nice gesture. I often wondered: What happened to this guy that he got left in this situation, and why does nobody care about him?
Elephant is about hope, about stepping just a little bit away from the mainstream and all this social media culture. We should become more concerned about what happens in our own life and with the people you meet every day. It sounds so preachy, but it is so true. Here in Berlin, there are many people from different cultures, races, generations, all living in this mixed up place. It’s very easy to get lost in a big city, to be left behind, and so many people lose faith when they don’t achieve what they thought they’d achieve. So they give up and get trapped. There are so many stories no one ever tells. Like the story of this homeless Polish guy who brought me cans of Carlsberg Elephant. He was trying his best, I respected that. But maybe it’s a ridiculous reason to name a record!
Katharina:
I think it’s a perfect reason. When did you write most of the songs for the album?
Nathan:
A while ago. The album was ready in 2015, but there was some trouble with my label and changes in management, and so it took me till August 2017 to release it.
Katharina:
The video for the song Beaches was filmed in New York—the same city where Dorothy Parker celebrated some exhilarating parties with her Vicious Circle in the 1920’s. It was a group of people from all classes and creative aspects who came together to get drunk during Prohibition. Which icons would you invite to your own vicious circle for the perfect party mixture?
There is no good party without some interesting girls. Amy Winehouse has to be there. Maybe I would invite Audrey Hepburn for some class. And Ellen DeGeneres. And wouldn’t it be fun to have Rihanna there as well?
Nathan:
Ok, let’s do the men first…
Katharina:
That’s what they all say. Because there are much more famous men…
Nathan:
No no, you do the men first, cause you gotta leave more room for the ladies! There is no good party without some interesting girls. Let’s start: You have to invite this depressed guy who is hilariously sarcastic and ironic. He is not too loud, but his presence is very strong. And he likes to drink. Ernest Hemingway could do the job. Big man there, drinking a whiskey, talking politics and shit. He was insane, he woke up sipping gin & tonics. I once drank in the bar where he used to hang out. More lads! Jimmy Hendrix and Eric Clapton for the style, and we could have a jam. All I can think about is a party where I would invite the Hollywood Vampires (editor’s note: a US-American rock project formed in 2015 by Alice Cooper, Johnny Depp and Joe Perry). Would be a dirty party. Now the ladies: Amy Winehouse has to be there. I listened to her a lot when I was younger, big influence. Maybe I would invite Audrey Hepburn for some class. And Ellen DeGeneres, I would make sure she brings up some Dory quotes. Now there is a picture on that wall in front of me…
Katharina:
Look at that. Halle Berry!
Nathan:
Yes, look at that! She can come. And wouldn’t it be fun to have Rihanna there as well? What a sick crew. That’s a fair collection now. But there are so many famous faces staring at you in this bar. Look over there, Al Pacino. His eyes, man, it’s like he looks right into your soul. So much talent everywhere. How could you ever choose? Even these days, there are so many young artists. In my opinion, music is one of the few things democracy worked very well for. Think about how cheap it is today to buy a guitar. And anybody can do music today and upload it to the internet. Or you can learn to play an instrument on the internet. I learned some music skills on YouTube as well.
Katharina:
But it’s not just all good for young artists today… What are the disadvantages of these changes in the music industry?
Nathan:
It’s much harder to filter out. In the earlier days, only the very talented people got through and of course, those who were manufactured by the record labels. Today everyone can get some attention, but people lose the overview. And of course, you don’t make any money with records anymore, so musicians rely on touring more than ever before… meaning; traveling more often, which can be difficult in holding down a regular job to pay the rent.
Katharina:
But you don’t have to hide when it comes to playing live. It was so much fun to see you jam with the guys at The Ballery.
Nathan:
To be honest, I never really wanted to be a solo artist, I love to work with bands. Being alone means you have a lot of control, but being in a band is always a more collaborative effort. For me as a musician, it’s so great to have other musicians interpret what you do. It’s hard to describe, but working with a band is a much more organic way to do it, than just working with session musicians and producers. You have people to share the journey with and you get to create the music you want to make, no one tells you how to do it.
Katharina:
If I would share a flat with you, what would be the worst thing about it?
Nathan:
I’ve had lots of flatmates. I get the toilet paper when it’s running out, I think I’m pretty ok. Depends on the bed though, right now I have a really loud bed. And there is a door to my flatmate’s room, we can hear every sound the other one makes. Sometimes he and his girlfriend wake up in the morning and they are chatting bullshit for two hours and then they are fucking for an hour. Like who the fuck gets up at 8 o’clock to have sex?
Katharina:
Damn that morning glory. Next drink?
Nathan:
Another Whiskey Sour, for sure.

Katharina:
Let’s talk about your songs in which you get vocal about more serious topics, going beyond sex, drugs, and rock n’ roll. Take Me Back is about money and war, for example.
Nathan:
It makes you feel bad to use those two terms in one breath, but that’s how the world is. It’s more about getting away from the city, away from the grind to make money, from huge TVs and mirrors.
Katharina:
For you, what are the biggest injustices in the world?
Nathan:
I am pretty bothered by the right-wing movements that are happening at the moment. In Ireland, everything is pretty much center-left or center-right. Coming to Germany, it was so interesting to see how wide the gap between both sides is here in comparison to Ireland. But then you have things like the G20. The way that protests happened just pissed me off. You have people cheering and filming burning cars with their iPhones in their brand new Nike Air Max. What’s the point in setting a Volkswagen on fire? Then the company is just getting to sell a new one then. The protesters want change but don’t provide an alternative to all the open questions our society has to ask. That’s not changing anything.
Katharina:
How grown up do you feel?
Nathan:
Not at all. I don’t know what I’m up to. I’m getting it wrong every day.
Katharina:
I sometimes have this feeling of, “oh god, just let me go back to mummy.” Do you get that too?
Nathan:
Not so much, but I’m lacking stability. And a place where everything is calm and you just sit on the couch and not have any worries for two weeks. I suppose that’s what holidays are for.
You can tell so much when you look for a long time into someone’s eyes, you can kinda tell if someone is a bad person. You can see if they hide things.
Katharina:
When you want to think about something beautiful, what do you think about?
Nathan:
Eyes. I tend to be really bad with eye contact because I get distracted very easily. But you can tell so much when you look for a long time into someone’s eyes, you can kinda tell if someone is a bad person. You can see if they hide things. If you can see someone’s true side, when you stare in long enough, I think that’s true beauty… also: Nature.
Katharina:
That one’s cheesy.
Nathan:
No, just think about it. Putting flowers in a room totally changes the room, imagine there here would be some flowers here.
Katharina:
What’s your favorite flower?
Nathan:
Haha, I have no idea about the names of flowers, but most of them look good. Orchids. Roses. Lilies are great, they smell good. A sunflower in the window of my grandmother’s kitchen. And her dog sitting under it, next to his bowl of water, gazing deeply at the press (editor’s note: Irish for cupboard) where he knows she hides his food. That’s beauty, a sense of comforting, a sense of feeling like home. You’re completely another self when you can feel at home somewhere and especially with somebody, looking into their eyes…
Katharina:
It must be important for someone who travels so much to find comfort with many people for short periods of time. Speaking of home, what made you come to Germany, to Berlin in the first place?
Nathan:
I came here by chance in 2015 because my label is based in Germany. But during that time I traveled and played a lot basically everywhere from Hamburg to Havana. But I remember one of the first crazy nights in Berlin, I was out with a friend and we got to a place called Damensalon. They have that drink called Basel Smash.
Katharina:
Sounds deadly.
Nathan:
It is! We could go there if you want.
Katharina:
Definitely…
Nathan:
Stop! No, no! Not good! I’m not happy. I have to sort my shit out. I’m going crazy every day. Every fucking day I want to stick to my plan, but instead, I go to my business appointments and go out with people to the pub afterwards. And then I stay in the pub for five hours. And then I can’t drive again and I’m stuck in someplace.
Katharina:
The hard life of a Rock ‘n’ Roller. Aaaaand here comes our next Whiskey Sour. Which songs are currently on top of your playlist?
Nathan:
Peter Frampton, a song called Do You Feel Like You Do.
It’s hard to be young in this world. If you always try to step up to something that you’re not, it can lead to huge lack of self-belief.
Katharina:
I read in many YouTube comments that you played at a lot of high schools.
Nathan:
Yes, in the U.K. That was weird and great at the same time. I gave talks about confidence and being a musician. It’s hard to be young in this world. I see it with my younger sister. She is coming home and looking at her Instagram watching all these beautiful women and she’s saying, “I will never look like that.” If you always try to step up to something that you’re not, it can lead to huge lack of self-belief and sadly in a lot of cases with young kids and teenagers it can lead to depression.
Katharina:
I’ve met some of these Influencer women, and I think it’s cool that they started their own business and are so independent as self-made-woman. But you don’t go to bars with them. You go to a smoothie bar where they will have a water with lime. To look like that, your lifestyle has to be so defined by fitness and food. And when I read the comments from 15-year-old girls, “I want to live like you” and so on. Then I just think: No. You should dance all night long and make out with other 15-year-old boys who have some baby fat left. And you should create memories, go crazy, and fucking live a big life.
Nathan:
Absolutely. That’s what I tried to talk to these kids about. How can you fulfill your dreams? How can you develop the confidence to ignore bullies and those who put you down and do what you really want to do? I played many songs for them, so they really opened up. I was very open about my story, and so I got them to talk back, that was great.
When we all come back and meet each other again, you come to think so much about each other’s lives and about the people you left behind.
Katharina:
Is there a person that particularly inspired many of your songs?
Nathan:
Yes, my mates from home, my school friends. It’s a pretty great group of lads, they are hilarious. By now everyone is just finishing university and moving abroad, changing cities and countries. When we all come back and meet each other again, you come to think so much about each other’s lives and about the people you left behind. You know this feeling of asking yourself: What are all the lads I hung around with when I was 15 doing right now?
Katharina:
What were you like when you were 15?
Nathan:
Playing guitar! Also, I remember: I was always normal sized, but with 13, everybody got tall and to me, that didn’t happen until much later. In Ireland, rugby is a pretty big sport. Rugby and Gaelic football. To do that you have to be of a somewhat decent size, so it was fucking hard for me, I always got absolutely destroyed.
Katharina:
So instead you played the guitar to get the girls… Did you go to a Catholic all-boys school near Dublin?
Nathan:
Mhmm…
Katharina:
Nothing to be ashamed of. I went to a Catholic all-girls school myself, in the southern Bavaria we have many of them.
Nathan:
Wow, how was that?
Katharina:
Pretty enjoyable. I can’t compare with mixed school obviously. But the boys from the state schools loved our parties—100 percent girls just waiting.
Nathan:
We had these so-called socials. The girls would all come to our school or we would come to their school. We were around 17, 18 years old. At these socials, we would drink beer and wine. And we would have a dance. Like boogie and some twerking. It was basically just an excuse to kiss on the dance floor. In Ireland, we call that shifting. Girls and lads, shifting on the dance floor, doing a slow number.
Katharina:
Do you remember a particular song you made out with girls too?
Nathan:
Yes, this one (starts singing): “Keep bleeding/Keep, keep bleeding love/You cut me open”.
Katharina:
That’s Leona Lewis, Bleeding Love!
Nathan:
Yeah that one, it was always that one. So cheesy.
Katharina:
That was the moment when the girls were ready. My one was Teenage Dream from Katy Perry…
Nathan:
Wow, that’s a fast song. Some aggressive kissing going on there. Eating the faces of each other, that’s what it was as well. Did you know that nightclubs in Ireland play the Irish anthem at the end? I hate it. When the anthem comes on, everybody has to leave. There is this place in Dublin called Coppers which is the last resort because it has a license to be open till 3 or 4 am. There are so many nurses and Irish policemen trying to get it on in the end of the night, it’s fucking weird.
So many people telling you so many great things. But then, you go back to your hotel room, and you’re on your own. And this awful feeling comes over you. Like a blanket of fear.
Katharina:
There is a strange fantasy going on in my mind right now… Speaking of romantic shenanigans, do you prefer to love or to be loved?
Nathan:
I prefer to love other people. Too much adoration and love, and I get fucked up. I can’t deal with it and I get annoyed. That’s hard as a performer, especially after a gig when everybody is coming up to take photos and give me compliments. So many people telling you so many great things. But then, you go back to your hotel room, and you’re on your own. And this awful feeling comes over you. Like a blanket of fear. You start questioning yourself. Am I good enough, do I deserve that adoration? Or am I a fraud?
Katharina:
After every success, I achieved I always thought: when is everybody finding out that I am not actually brilliant at anything. I feel that for creative people it’s especially hard to get the balance.
Nathan:
Of course many can’t handle it well. On the one hand, I love to be loved, everybody does. But I love to give love more than anything. That’s part of why I perform. I remember the second concert I was ever at: I saw Glen Hansard, it was The Frames playing. I had shivers down my spine and the hairs stood up on my arm for two hours after the concert. And all I could think about was: I have to give this feeling back to people. But also in a sexual sense, I love to give love to other people.
Katharina:
What’s the worst thing about being in a relationship with you?
Nathan:
I’m super moody. And I always get in fights with other lads on nights out.
Katharina:
Would you consider yourself old-fashioned?
Nathan:
We should have ordered an Old Fashioned instead of a Whiskey Sour, shouldn’t we? (Editor’s note: We later did.) I think I am old-fashioned. But what does that mean? Are you old-fashioned? You dress like it!
Katharina:
I know I am. And yes, I do wear a lot of vintage clothes even though I dress differently for every occasion. But it would have looked so awkward if I would have stood there next to you on the piano in a Berghain outfit. Which kinds of aesthetics do you like in fashion?
Nathan:
Maybe I am slightly old-fashioned… In my opinion, at the end of the day, a man looks best in a three-piece suit and a woman looks best in a dress.
The rest of the night was drowned in hilarious tales of pub fights, spontaneous singing sessions, and Jägermeister. If you want to learn more about the daily and nightly adventures of Nathan D. Hollingsworth Johnston (alias Sion Hill), you should follow him on Instagram and check out his YouTube channel.
The Drums
Interview — The Drums
Kissing Keon
Eight years ago today, The Drums played their very first concert in Los Angeles. On the same day, they met photo artist and designer Hedi Slimane who portrayed the band for his legendary “Rock Diary”. We had the opportunity to talk with Jonny Pierce about the intimate moments that Hedi Slimane caught with his camera—and found out why Jonny felt like he wouldn’t be enough back then.
16. November 2017 — MYP N° 21 »Ecstasy« — Interview: Jonas Meyer, Photography: Maximilian König
About eight years ago, Hedi Slimane declared his love in an extraordinary and rare way. The renowned fashion designer and photographer not only created a special “I love The Drums” graphic for a band that had only just formed a few months ago. He also published the first of three black-and-white editorials on his blog Rock Diary. The images depict the four band members just a few hours after their very first performance in California—somewhere in a hotel room in Los Angeles on the evening of 16th November 2009.
Obviously, there are quite a few band editorials out there. Heaps in fact. What turns Hedi Slimane’s images of Jonny Pierce, Jacob Graham, Coono Hanwick and Adam Kessler (The Drums original members back then) into a true declaration of love is the melancholic silence, the intimacy and the power they exude. To this day.
We meet up with Jonny Pierce, the creative epitome of The Drums, at the Lido club in Berlin. Berlin—another one of Hedi Slimane’s loves, but that is a topic of its own. Jonny is wearing a blue overall with a logo on the back that reminds one of “IKEA”. In fact, the logo belongs to KIEV, an underground Ukrainian fashion label that is operated anonymously. With its slogan “Love Your Homo” the brand has been supporting LGBTI rights and Jonny tells us he wore this very same overall at The Drum’s concert in Moscow the night before.
Jonny has experienced a lot since the band formed in 2008 and basically has enjoyed all the successes the indie music world has to offer. However, he has also had to endure Adam, Connor, and eventually his co-founder Jacob, leaving the band.
You could say he’s alone now. But he isn’t. Then aside from filling the vacant positions with new and talented musicians, who he is touring the world with at the moment, promoting his new record “Abysmal Thoughts”, Jonny has a new partner at his side—Keon. Keon, and the relationship that Jonny and he have been sharing for almost a year, have given Jonny new hope, strength and courage, especially after having come out of a failed marriage. Keon is also pictured on the cover of The Drums’ new record. And one has to ask; could this also be a love declaration of some sorts?
Jonas:
I have to confess—the very first time I got in contact with The Drums many years ago it didn’t happen by listening to your music. I came across the photo-editorials about your band taken by world-famous designer and photo artist Hedi Slimane for his blog called “Rock Diary”. How and where did you guys meet back then? What was the idea behind that very extensive and close collaboration?
Back then, the band was very intersexual... we were always kissing each other, whether we were gay or straight. It didn’t matter, we were all in love with the gang that we had.
Jonny:
I was in Los Angeles, The Drums were playing their first show ever in L.A., it was in 2009 I think. The World was just discovering The Drums and we were driving towards this placed called “Spaceland”, an alternative rock/indie rock nightclub in the Silver Lake neighborhood, for soundcheck. They got a call from my friend Jacob who was a writer in L.A. and who happened to be friends with Hedi. He said: “Hey, my friend Hedi wants to come and shoot you guys during your soundcheck today.” I didn’t know who Hedi was—I didn’t follow the world of fashion, I followed music. Hedi came to the soundcheck and started snapping photos. He just really fell in love, and we kind of fell in love with him, too.
We shut our soundcheck, and on his way to the door, he said: “You know, I’ve got full plans, but I canceled everything. I have to come see you play.” So he came back to the actual show and went backstage. Afterwards, we all just hung out for a long time and he followed us back to our hotel—we were staying at this shitty little hotel. Hedi started taking photos of us laying on the beds together. Back then, the band was very intersexual… (laughs) like we were always kissing each other, whether we were gay or straight. It didn’t matter, we were all in love with the gang that we had. So we were just all laying on top of each other being very tender. Hedi loved that moment and held it with his camera.
We had done a bunch of photo shoots, so we thought this is just another one and Hedi is just another photo artist. But then he made this graphic that said “I love The Drums”, an American flag graphic that was custom-made for his blog. At first, we just started kidding like “These fashion people, they are calling and everyone is going crazy.” But then, our record and band became bigger and bigger and in all the fashion capitals, they suddenly wanted to pick us up for photos. So really it was a good source of encouragement and became very, very different. Every time we are in L.A., we hang out in his house or go on holiday together. He has become a very loyal friend and somebody that is just always so encouraging. Normally this business is a sick cold world where people come in and out and try to take what they can from you. Once they feel like they can’t get more, they disappear. But Hedi is a stable friend.
Everyone says that he hates labels—but everyone also wants to be labeled. People want you to understand who they are, I understand that. But I also like the very blurry, dream-like moments. Unfortunately, it’s mostly gone today.
Jonas:
After seven years and seen from a today’s perspective, what do these photos mean to you? What do they say?
Jonny:
When I see them, I appreciate the really delicate and kind of more sensitive moments of being in a band—especially the photos where we were like holding hands or being intimate, it’s very sensual. It was just a moment when we decided to let it happen. Hedi didn’t have this plan and we didn’t talk about it, it just happened. That’s something that couldn’t happen now—and that couldn’t happen even a week after. I appreciate that and am very grateful that there was that small little window of openness, sensitivity, and living within the nuances of life. Now everything seems so black and white sometimes like “Oh I’m straight”, “I’m gay” or this or that. Everyone says that he hates labels—but everyone also wants to be labeled. People want you to understand who they are, I understand that. But I also like the very blurry, dream-like moments. Unfortunately, it’s mostly gone today.
Jonas:
Do you miss these moments of familiarity and intimacy that the photos express?
Jonny:
Of course! Since these moments are so rare in life. I would say 99.9 percent of the people will never have an experience like that. And 99.9 percent of the bands will never have an experience like that—even if they are all gay (laughs). That was a moment when we all dropped our egos and just loved each other. It’s the rarest the world has. There was a level of innocence, intimacy, and naivety—all kind of pushed together, that was The Drums in that moment. Hedi captured the most profound, unique and special moments I think I’ve had in the history of The Drums.

I don’t look at family in a blood-relation term sort of way. It’s wonderful when that happens, but I don’t think a lot of people get that lucky.
Jonas:
The photos look like a family coming together—the word “family” has a very special meaning to you, am I right?
Jonny:
Hell, yeah! Good and bad (laughs). It depends on what kind of family you’re talking about: About my biological family—I don’t have the most wonderful thoughts about it. Or about my chosen family—people who I have decided to let into my life. I don’t look at family in a blood-relation term sort of way. It’s wonderful when that happens, but I don’t think a lot of people get that lucky. Family is really complex, we are born with this sort of stigma about parents that they have all the answers and they are wise because they’re older. If there’s anything I have learned, getting older doesn’t mean having all the answers. We’re still little kids, we’re still afraid of dying, we all get jealous. And when you stop being afraid of something, you start being afraid of something else. We’re all just trying to get through life.
Jonas:
Being afraid, maybe the most human emotion.
Jonny:
Yes. And desire, wanting love. People just want love and want to feel accepted. I didn’t get that with my family, mainly because I’m gay. So I really look at my heart—and I think our heart is like a house. It has so many rooms, there’s like a kitchen, a living room, a basement, a master bedroom, a smoke room, an attic and a little garage on the side. People go into those rooms and you only have so much space. Most of my life, I was reserving the master suite for my parents like “Oh they’re gonna one day accept me!” or “No, you can’t come into my life because I’m holding space for them!”
It happened very recently that I decided to unlock that door and open it up—and amazing people rushed in. Now the house is full of love. I don’t want for more, I’m ok. It’s a beautiful lesson for me to just forget about this. But anyhow, it’s hard because the relation to your parents is the most primary relationship in life.
At the end of the day, we all are raw animals that are heartwired and attached to a biological mother and a biological father. But simultaneously we are an elevated species. We can reasonably think and we can rise above the primal instincts—that’s what makes us human. And we can choose. It feels good in a primal sense to be hugging my mother even though she doesn’t love me. It feels good that I can elevate my mind and honor that I’m human which enables me to make a choice for something that is actually correct.
Jonas:
I’m sure your boyfriend Keon has conquered most of the rooms in your heart…
Jonny (laughs):
Haha, he owns the whole house.
Jonas:
Is Keon the highest level of family you’ve ever reached in your life?
Jonny:
He is certainly someone that I would call family. I’ve been dating him for a year, he is the most important person on the planet. He’s a soulmate for me. It’s a very beautiful relationship for many reasons. An important reason is that he was Mormon when I first met him. He was still wearing his undergarments, he had never had sex, and he never had a coffee, tea, soda, or something like that. He and I met at a little sucky bar in New York. When we started talking, he revealed to me that he was Mormon. It peaked my interest: Outside of him just being sexually attractive, I felt like “Here’s somebody that is amazing, so I can actually help because I’ve been through this—detaching proper religion when you’re so deep in it.”
Keon has been a great support to me, too. It’s rare to find someone who has gone through something so similar. I mean, you meet a lot of people that say: “Oh, my parents are religious, too.” In most cases, that type of religiousness means going to church every Christmas. I don’t think these people understand the kind of experience Keon and I made. Our parents are religious in a very extreme way—with the tiny difference that his parents were extreme and loving, mine were extreme and not loving. Nonetheless, there is so much overlapping that I can share with him when I’m super sad. When I talk to him, he gets it.
By the way, Keon actually did his two-year-mission as a young Mormon in Germany. He was living in Berlin and in Hamburg, so he speaks fluent German.
Jonas:
The cover of your latest record “Abysmal Thoughts” shows a photo of Keon sniffing a shoe, so he must have influenced you in a certain way. Would this record sound different without him being in your life?
Jonny:
No, because I met him when my record was pretty much done.
Jonas:
But the artwork would have been very different.
Jonny (laughs):
Hahaha, yes!
Jonas:
You created a major part of “Abysmal Thoughts” in Los Angeles. Is this place responsible for the wicked title of your record?
Something important that I’ve learned from L.A. is that I need clouds and rain in my life. I grew up in Upstate New York, so I need seasons.
Jonny:
Los Angeles is kind of a dark place for me. I went through a divorce there, I got really deep into drugs. I’m not generally anti-drug, but I am anti-drug when it comes to the point where I let it take over my life and let it shrink to numbing a lot of pain.
I had a really dark year and a half in L.A. and simultaneously, the sun never stopped shining. You lose your sense of time because every day looks the same. So something important that I’ve learned from L.A. is that I need clouds and rain in my life. I grew up in Upstate New York, so I need seasons—like in Berlin.
Jonas:
Berlin, the city of sin.
Jonny (laughs):
Yeah, we’re getting in trouble already.
Jonas:
In the last decade, you created a lot of songs that by now, have reached millions of people and have let them dance. Some of them have become regular classics and let your fans ecstatically flip out. What are the moments in your life that make you ecstatic personally?
Dating Keon has been a little bit helpful because he has a really innocent, naive and sweet side. And I kind of tap into it sometimes—sometimes I look at life through his eyes and so I feel a little child-like in that way.
Jonny:
Kissing my boyfriend, I guess. I don’t really experience abysmal moments anymore. I’m more learning like what makes me happy. At the same time, I’m learning that my highs aren’t so super high and my lows aren’t so super low as they were a couple of years before—I’m numbing as I get older if I’m really honest. And I hate that. I wish to try my inner child out. But the voice of my inner child is like waning. I wanna get that back, but I’m not really sure how.
Dating Keon has been a little bit helpful because he has a really innocent, naive and sweet side. And I kind of tap into it sometimes—sometimes I look at life through his eyes and so I feel a little child-like in that way. I really don’t get much ecstasy or bliss anymore. But I think I prefer that over having a really high-high and a super low-low, and then, in the middle of these feelings, it’s scrambled, like spinning circles. At least I have at this point more of a center, I feel like I can understand who I am a little bit more.
Jonas:
Let’s go back to the photography of Hedi Slimane: Comparing the visual black-and-white narrative that Hedi created in the early days of The Drums, with the colorful and energetic photos on your official Instagram account today, it seems that, over the years, you kind of merged from a melancholic and withdrawn world to a happy and hilarious one. Do you feel like you’ve arrived in your life?
I felt like I wouldn’t be enough. And maybe I was right, maybe I was wrong, I don’t know. But it’s definitely not a healthy mindset.
Jonny:
It’s a slow and constant process that is still going on. But today, I know myself better than I have before, I think. I feel calm—I never felt calm in my life. Today I went to a radio interview all by myself without a shred of panic. I just walked in. Normally I would need like a manager, a friend, a group of people to make me feel supported. That’s how I formed the band in beginning: I was making all the music myself, but I didn’t feel that the world would care if it was just me—like “Hey, I’m The Drums!” or “I’m Jonny Pierce!” I felt like I wouldn’t be enough. And maybe I was right, maybe I was wrong, I don’t know. But it’s definitely not a healthy mindset.
Anyway, it worked and people loved it. But for me, the band was a support system that I needed. And now that it’s just me, I’m telling the whole world that I made all the music, something I have never done before. I’m just stepping into who I am, which feels beautiful. It’s not just the music, the recording and what I’m saying. It’s overflowed with the artwork, it’s overflowed onto stage. I used to feel like I had to do backflips and summersaults just to keep everyone in the room like “Oh, I have to entertain, I have to be juggling and I have to be crazy!”
And now I just say to myself: “Take a deep breath, go on stage, dance if you want, stand still if you want, do what you want.” The only thing I’m actually afraid of is: Will people embrace that? I’m only wondering if this really enriches the shows if the fans can read the genuine aspect of all of this. You know, just being yourself, that’s hard to do.
Jonny Pierce is the founder of the band The Drums.
thedrums.com
facebook.com/wearethedrums
@thedrumsofficial
@jonnypierce
Alex Cameron
Interview — Alex Cameron
Not From This World
Don’t let yourself be fooled by the name: Alex Cameron’s music act is not just a one-man show… this time around, you’ll be getting two for one. We talked with singer Alex Cameron and saxophonist Roy Molloy about their collective creative goals, wild nights in Las Vegas, and intense orgasms.
11. November 2017 — MYP N° 21 »Ecstasy« — Interview: Jonas Meyer, Text: Katharina Weiß, Photos: Maximilian König
The two Aussies might be crazy—but there is a method to their madness. Alex Cameron and Roy Molloy want to tell stories about personal tragedies, lost loves and failures through their music. In an abstract and other-worldly manner, they perform shows around the world, in front of audience members, who may constantly be asking themselves, if the show is some form of high-concept art or just a result of massive drug abuse. We met Alex and Roy during their European tour and amongst other things found out what inspiration lies behind their ecstatic performances.
Jonas:
Roy, a couple of hours ago, you posted a long and serious statement on Facebook. You said that you guys are sick of everything going on in the world right now, especially in the U.S. You called the current situation a very dangerous one and talked a lot about the right-wing ideology that seems to foster it. Do you guys feel like you have a special responsibility to express yourselves as musicians in these trying times?
Roy:
I think you have to be aware of your reach and you have to be knowledgeable in general. It´s a matter of consistently expressing how you feel. I think that I focus on having a message but I don’t know if that’s the job of a musician.
Jonas:
You seem to be very outraged?
Alex:
Yeah, anyone with half a brain is pretty outraged by what’s happening. It’s a fucking travesty, it’s just blightingly wrong.
Jonas:
You guys spent months traveling the States now. Did you come back in desperation or with hope?
Alex:
There is just work to be done. There is no time to contemplating the future, you have to stay active in the present.
Playing in front of a few hundred or a few thousand people is pretty similar to taking ecstasy.
Jonas:
Which moments of your journey caused real ecstasy for you?
Roy:
The early tours in the States and in particular the early tours in Europe as well. We realized people were actually paying attention to us! That was a revelation for me—playing in front of a few hundred or a few thousand people is pretty similar to taking ecstasy. Especially compared to our modest beginnings when we were playing in restaurants, where no one was there to actually see us. The few guests were seeing us by accident while having their meal.
Jonas:
Your new record sounds like the soundtrack of a road movie. Listening to it feels like being on the road with you and Roy, sitting on the backseat of this ’88 Cadillac Coupe DeVille that you call “Duchess” and that can be seen in the video of your song “She’s mine”. Do you still own this car? And what kind of stories do you want to tell with your new record?
Alex:
It’s a collection of stories, for sure. Based on characters and myths I wanted to tap into. It’s the way I see the world—especially from certain perspectives, like personal tragedies and things like that.
Roy:
The Cadillac story is actually a tragic one as well: It’s been impounded by the state of California. At the time, we did not have the money to release it… So it has been crushed into a cube, it’s now scrap.
Jonas:
You travelled together for thousands of miles around the U.S., mostly in this car. It probably takes a good friendship to be spending so much time with just one other person am I right?
We’re both pretty committed to the idea of reflecting our current respective situation and having a body of work that echoes this and functions as our broadcast.
Alex:
You are right, I’ve done other tours and the relationship has not been as creative as I’ve hoped for. This one with Roy has—we are both using what we’re doing at the moment as inspiration for more writing and for other types of work. There are a few things that keep us going. The first thing is that we both need to work for food and accommodation. The second thing is that we’re both pretty committed to the idea of reflecting our current respective situation and having a body of work that echoes this and functions as our broadcast. It’s a living and breathing journal.
Jonas:
How long have you known each other for?
Roy:
It’s been a long time, 23 years.
Jonas:
What has changed since then?
Alex:
We left all the friendship drama behind us, from when we were kids and teenagers and now we are business partners.
Roy:
Once you’ve cleared a couple of hurdles as friends, it gets very smooth.
We saw a very different side of Las Vegas. Mostly, we did not go out and get shitfaced.
Jonas:
You also made it through wild nights in Vegas together and you filmed a video there, how did the city inspire you?
Alex:
We were just there doing work; we got asked to stay there and write songs! I think we saw a very different side of Las Vegas. Mostly, we did not go out and get shitfaced. Everything I basically have to say about Vegas is in a post, which I put on Facebook when I released „Candy May“:
I flew to Vegas with a deep seeded fear of a dormant syphilis.
I left with negative blood test results, an inflamed body rash, and a brand new music video.
If you’ve ever bought a car for $300 off a guy with cuts all on his face, or if you’ve ever traded tales of recent infidelities with the one person you promised you’d never betray, then this one’s for you.
If you’ve ever raised your voice in anger together with your sweet one at a bus stop like a bag of groceries about to split, then this one’s for you.
If you feel like you’ve been let down by love, or like you’re owed respect, then get your life in order and start behaving like an adult.
This is a song about falling apart.
Jonas:
In your Instagram stories, I often saw you hanging out with Brandon Flowers from The Killers. And now one can hear his voice on your new record. How did you meet each other and how was working with him on the new album?
Alex:
We’d just played a show for about eight people at a record store and we were driving our rental car through Florida. During that same time, we received an email from Brandon Flowers. He was interested in meeting us. So we went and paid him a visit to Las Vegas, stopped by his studio and I guess the magic was in the room because we were able to write a couple of songs very quickly.
Jonas:
Besides Mr. Flowers, there is another very interesting collaboration on the record with Angel Olson. You were touring with Angel in U.S. What can you say about working with all of these well-known artists? Especially after you played your first shows in restaurants with just a few people watching?
Roy:
At the end of the day, we’re trying to stay focused, and we’re so lucky to be working with more and more people we deeply respect. We’ve been fortunate that they’ve contacted us. For someone to reach down and offer a hand up to their level is both very flattering and – I hope – a sign that you’re doing something worthy and important.
I remember a particularly intense orgasm with a total stranger that left me giggling uncontrollably.
Jonas:
The main topic of this issue is „ecstasy“—in which moments in your life, do you remember feeling truly blessed by the enchantment of ecstasy?
Roy:
What a lovely topic. When I think about ecstasy I think about a few different things. The first time I felt mutual love, that feeling of shock that someone could love you like you love them, your heart being squeezed just when you look at them. I remember a particularly intense orgasm with a total stranger that left me giggling uncontrollably. Heroic moments in sport. I think about some super powerful ecstasy I took with friends in a town called Mollymook in 2014 and I just sat there looking at the shiny hair on my arm. Man. Cool topic for a magazine issue you guys.
Jonas:
Talking about the high times in life, it´s also part of the human experience to face the low ones. As an artist, how deeply are you in touch with your dark moments?
Roy:
Very in touch. I think the records speak for themselves in that way.
Jonas:
Some of your fans love the atmosphere of insanity around your stage and video performances—what inspired these unique acts of expression?
Roy:
I think that atmosphere comes from a few places. Initially, I mean, for the first two years or so, we were operating completely under the radar. Even by Australian standards, we were unknowns. The saying „dance like no one’s watching“ comes to mind. So there was a reckless feeling of anonymity that came from that. Then there’s also a very conscious desire to perform the music as we think it should be and a bit of something that’s inherent to who we are. We really put a lot of our personality into it, and I don’t think that’s very common in a lot of musical performances these days.
There's a lot of different types of love and if you take the abstract out of it, it'd probably just be a chemical reaction in your brain.
Jonas:
In songs like „She’s Mine“ you sing about love in a very abstract manner—is there anything concrete to say about that topic?
Roy:
There’s a lot of different types of love and if you take the abstract out of it it’d probably just be a chemical reaction in your brain. Same as being depressed or elated or proud. The abstract is what gives it personal meaning and allows us to try and explain what we’re feeling or tell a story about it. So let’s keep the talk fluid on that topic for now.
Jonas:
You probably have many amazing projects ahead of you… can you tell us where the journey is heading to next?
Alex:
Right now the priority is to work. To tour the album thoroughly, perform it as best we can, and continue bringing people into our world. We’re the kind of guys who a day off is a curse for. So, for now, we’re just going to keep working hard and playing shows. We’re feeling good.
Alex Cameron and Roy Molloy are two friends and business partners making music.
Mark Benjamin
Editorial — Mark Benjamin
Not My President
A year ago today, thousands of people across the U.S. and around the world were protesting the election of Donald J. Trump. In New York, protesters converged at Trump Tower in Midtown Manhattan, chanting slogans such as “Not our president”. New York-based photo artist and creative director Mark Benjamin caught some of these moments with his camera.
9. November 2017 — MYP N° 21 »Ecstasy« — Photography: Mark Benjamin
Mark Benjamin is a photo artist and creative director living in New York City.
mark-benjamin.com
rain-mag.com
facebook.com/markbenjaminphoto
@rainmagazine_
@artallout
Justin Peters
Submission — Justin Peters
Parallelwelt
8. November 2017 — MYP N° 21 »Ekstase« — Bilder und Text: Justin Peters
Pablo Picasso hat einmal gesagt: „Alles, was du dir vorstellen kannst, ist real.“ Für mich ist das wie ein Leitsatz.
Seit einigen Jahren versuche ich, meine Vorstellungen in Photoshop zu verwirklichen – mithilfe verschiedener Objekte, die ich auf eine Art und Weise kombiniere, die man so in der Realität nicht finden kann.
Wenn ich ein Bild kreiere, scheint die Welt um mich herum zu verschwimmen. Gleichzeitig wird die Situation, die ich gerade vor Augen habe, für mich immer realer – sie wird zu einer Parallelwelt. In diese Welt kann ich auch den Betrachter eintauchen lassen. Es ist eine Welt, in der alles möglich scheint.
Justin Peters ist 22 Jahre alt und lebt in Stuttgart.
facebook.com/jstnptrsofficial
jstnptrs.myportfolio.com
behance.net/jstnptrs
@jstnptrs
Maximilian König
Editorial — Maximilian König
Fremont Street
In Downtown Las Vegas sind die Straßen leerer als im neuen, aufpolierten Teil der Stadt – dabei hat hier mal alles angefangen. Auch wenn die wilden Jahre längst vorbei sind: Durch Downtown weht immer noch ein Hauch jener Ekstase und Verruchtheit, die einst den Mythos von Las Vegas begründeten. Fotograf Maximilian König hat sich auf Spurensuche begeben – entlang von Hochzeitskapellen und Pfandleihhäusern.
6. November 2017 — MYP N° 21 »Ekstase« — Fotos: Maximilian König
Maximilian König ist Fotograf und lebt in Berlin.
www.maximilian-koenig.com
facebook.com/maximiliankoenigberlin
@mxmln_kng_ftgrf
Alina
Interview — Alina
Kehrseite der Einsamkeit
Sechs Jahre lang hat Alina an ihrem Debut-Album „Die Einzige“ geschrieben, jetzt ist es endlich da. In ihren Liedern erzählt sie schonungslos offen von Selbstzweifeln, Enttäuschungen und der Angst vor Einsamkeit. Dabei ist ihr mit Abstand wichtigster Song beim Wäschewaschen entstanden.
24. Oktober 2017 — MYP N° 21 »Ekstase« — Interview: Jonas Meyer, Fotos: Steven Lüdtke
„CM 7151“ ist ein wahrer Schatz. Das elegante Mikrofon, das zu DDR-Zeiten im RFT Funkwerk Leipzig entwickelt und gefertigt wurde, gilt heute als echte Rarität – vor allem, wenn es mit „M7“ kombiniert ist, einer ebenso eleganten Mikrofonkapsel aus dem Hause Georg Neumann. In tadellosem Zustand bringen es die beiden Klassiker auf einen Wert, der vergleichbar ist mit dem Kaufpreis eines Kleinwagens.
Zu den Wenigen, die einen solchen Schatz besitzen, gehören die Betreiber der Berliner Noize Fabrik. Ihr fast neuwertiges „CM 7151“ steht zusammen mit „M7“ in ihrem sogenannten „Live Room“, einem kleinen Aufnahmestudio, das man stundenweise mieten kann. Das Besondere am „Live Room“ ist die vollverglaste Wand, die es Musikern erlaubt, ihre Recordings auch für Publikum zu öffnen und damit eine ganz besondere, fast intime Nähe herzustellen. Studio-Session und Live-Auftritt – zur selben Zeit und aus einer Box. So nahbar lässt sich Musik in Szene setzen.
Die Musik, um die es heute geht, ist die von Alina. Die junge Künstlerin, die aus Konstanz am Bodensee stammt und mittlerweile in Berlin lebt, hat bereits vor sechs Jahren damit begonnen, an ihrem Debüt-Album zu schreiben. Die Platte, die am 20. Oktober das Licht der Welt erblickt hat, trägt den Titel „Die Einzige“: In sehr emotionalen und persönlichen Songs legt die Musikerin das Innerste ihrer Seele offen. Dabei singt sie von Selbstzweifeln, Enttäuschungen und Angst vor Einsamkeit.
Diese Themen haben sich im Laufe der Jahrzehnte auch in das Gedächtnis von „CM 7151“ und „M7“ gebrannt. Wie viele Stimmen es wohl waren, die ihre Versionen von Glück und von Trauer, von Liebe und von Einsamkeit, von Hoffnung und von Schmerz in die elegante Mikrofoneinheit gesungen haben?
Ansehen kann man es ihnen nicht. Die beiden Geräte wirken noch immer so frisch, als hätten sie das Wissen um die Widrigkeiten des Lebens nie als schwere Last begriffen – eher als eine nützliche Erfahrung, die ihnen den Rücken stärkt und sie für die Zukunft rüstet. Ob das bei Alina ähnlich ist? Wir bitten sie im „Live Room“ zum Gespräch.
Jonas:
Vor vier Jahren hast du in unserem Magazin einen selbst verfassten Artikel zum Thema „Meine Stille“ veröffentlicht. Der Text trägt die Überschrift „Innerlich laut“, es finden sich darin Sätze wie „Meine Stille ist wie ein wild gewordenes Kind“, „Meine Stille macht mir Angst“, „Meine Stille ist eine Illusion“ oder „Wenn ich still bin, bin ich tot.“ Stehst du mit der Stille immer noch auf Kriegsfuß? Oder hast du mit ihr mittlerweile deinen Frieden gemacht?
Alina:
Für mich ist Stille immer noch etwas, das in meinem Leben nicht so einfach um die Ecke kommt. Aber im Vergleich zu damals suche ich die Stille heute viel bewusster, viel aktiver: Je lauter es um mich herum wird, desto mehr suche ich die innerliche Stille.
Jonas:
Würdest du sagen, dass du nach außen hin lauter geworden bist?
Alina:
Wenn man die Frage auf meine öffentliche Sichtbarkeit als Künstlerin bezieht, würde ich sagen ja. Ich glaube aber, dass ich als Mensch – in meiner extrovertierten Art – eher ruhiger geworden bin. Ich merke einfach, dass meine Energie begrenzt ist. Mit den Jahren entwickelt man ja auch ein immer besseres Feingefühl für sich selbst.
Jonas:
Du hast in deinem Artikel damals sehr stark mit Sprache gespielt und viel von deinem Innersten preisgegeben. Diese schonungslose Offenheit findet man auch in den Texten deiner Songs. Nicht viele Menschen sind in der Lage, sich gegenüber anderen so zu öffnen, vor allem nicht in der Öffentlichkeit. Fühlst du dich dadurch nicht sehr angreifbar und geradezu nackt?
Vielleicht bin ich auch so offen, um meine eigenen inneren Konflikte und meine Traurigkeit zu lösen und in Musik umzuwandeln – um mich gewissermaßen davon zu heilen.
Alina:
Auch für mich gibt es solche Momente, in denen ich das Gefühl habe: Das kann ich eigentlich nicht. Aber unterm Strich ist das für mich die einzige Art und Weise, Musik zu machen – Musik, die für mich selbst interessant ist und einen Anspruch hat. Mit dieser Art von Musik kann ich erzählen, dass das innerlich Wahrhaftige auch äußerlich wahrhaftig ist. Für mich ist das die beste Möglichkeit, mit anderen Menschen eine Verbindung herzustellen und zu erreichen, dass sie sich verstanden fühlen. Das ist das Ziel jedes einzelnen Songs von mir.
Vielleicht bin ich auch so offen, um meine eigenen inneren Konflikte und meine Traurigkeit zu lösen und in Musik umzuwandeln – um mich gewissermaßen davon zu heilen. Ich würde mit diesem eigennützigen Vorhaben aber nicht auf die Bühne gehen, wenn ich nicht auch der festen Überzeugung wäre, dass meine Musik den Menschen eine Möglichkeit gibt, sich in bestimmte Situationen und Gefühlszustände hineinzuversetzen.
Jonas:
Wie hast du gelernt, so offen durchs Leben zu gehen? Ist das etwas, was man von zu Hause mitbekommt, oder hast du dir diese Eigenschaft im Laufe der Jahre antrainiert?
Alina:
Ich glaube, das habe ich von meiner Oma. Als Kind ist sie nach dem Krieg aus Danzig vertrieben worden und in ein kleines Dorf im Schwarzwald geflohen. Noch heute weist sie ausdrücklich darauf hin, dass sie dort eigentlich nicht hingehört, sondern in eine Großstadt. Meine Oma hat schon immer das Herz auf der Zunge getragen und sagt einfach gerade heraus, was sie denkt. Diese Direktheit habe ich definitiv von ihr.
Was meine Musik angeht, hat es durchaus einige Jahre gedauert, bis ich mir dort diese Offenheit und Direktheit zugetraut habe. Diesen krassen Zugang zu meiner Seele hätte ich vom ersten Tag an nicht so einfach legen können.
Jonas:
Dafür kann es heute passieren, dass du mit deiner Musik andere Menschen dazu ermutigst, auch eine gewisse Offenheit zu entwickeln und mehr von ihren Gefühlen preiszugeben. Erinnerst du dich selbst an Musik, die für dich im Laufe deines Lebens eine solche Mutmacher-Funktion hatte?
Am stärksten berührt ist man ja, wenn man etwas hört, das man selbst in gleicher Weise erlebt hat – und sich dadurch total verstanden fühlt.
Alina:
Ja, immer! Es gibt zwar nicht den einen Künstler oder das eine Lied, das beispielhaft dafür stehen würde, aber Musik hat mir immer etwas erzählt und hat mich immer vorausblicken und erahnen lassen, welche Dinge vielleicht auch in meinem Leben passieren können.
Am stärksten berührt ist man ja, wenn man etwas hört, das man selbst in gleicher Weise erlebt hat – und sich dadurch total verstanden fühlt. Dann bricht plötzlich der Damm! Dieser Moment ist es, den ich auch selbst immer versuche einzufangen: Bei meiner Musik will ich mich und den Zuhörer so erwischen, dass zwischen uns eine Verbindung entsteht. Und wenn mir dann jemand nach einem Konzert sagt: „Du, ich war in Tränen aufgelöst!“, ist es das größte Kompliment, das man mir machen kann.
Jonas:
Vor ein paar Tagen habe ich mal in der Timeline deiner offiziellen Facebook-Seite gestöbert und bin auf ein Foto gestoßen, das dich mit einem T-Shirt von Guns n’ Roses zeigt. Sofort hatte ich wieder die 90er Jahre vor Augen und in den Ohren. Ist Guns n’ Roses eine Band, die dich in deiner Kindheit und Jugend musikalisch sozialisiert hat?
Alina:
In den 90ern hat mich wirklich sehr viel Musik gecatcht. Damals war ich wahnsinnig aufnahmefähig und habe mich quer durch alle Genres gehört: von Nirvana über Aaliyah und Eminem bis zu Blümchen – kein Scherz! Ich habe alles aufgesogen, was es um mich herum gab. Bis heute hat sich das eigentlich auch nicht verändert, musikalisch bin ich gegenüber allem nach wie vor sehr offen.
Besonders haben es mir in meinem Leben aber die großen Diven angetan: Whitney Houston, Celine Dion – für mich war es immer schon außergewöhnlich, was diese Frauen mit ihrer Stimme anstellen können und wie toll sie ihre Musik inszenieren. Ich mag einfach das große Drama! Eine meiner größten Inspirationen ist dabei Mariah Carey, die ich bereits Anfang der 90er für mich entdeckt habe und bis heute liebe. Sie und ihre Musik haben mich extrem geprägt.
Jonas:
Wenn man in der deutschsprachigen Musik nach solchen Diven sucht, wird man am ehesten in den 1950er und 60er Jahren fündig. In der jüngeren deutschen Musikgeschichte scheint diese Art von Künstlerin völlig ausgestorben zu sein.
Frauen wie Hildegard Knef, Marlene Dietrich oder Zarah Leander waren nicht nur schön: Das Faszinierende an ihnen ist, auch heute noch, dass sie so selbstbestimmt waren.
Alina:
Ja, das stimmt. Ich erinnere mich zum Beispiel an Alexandra, eine deutsche Sängerin aus den Sechzigern, deren Musik ich als Kind sehr viel gehört habe. Ich weiß aber nicht, ob man sie wirklich als Diva bezeichnen kann. Aus dieser Zeit fallen mir viel eher Persönlichkeiten wie Hildegard Knef, Marlene Dietrich oder Zarah Leander ein. Diese Künstlerinnen habe ich erst Ende der 90er für mich entdeckt und mich dann intensiv mit ihnen beschäftigt. Diese Frauen waren nicht nur schön: Das Faszinierende an ihnen ist, auch heute noch, dass sie so selbstbestimmt waren – und das zu einer Zeit, in der das alles andere als selbstverständlich war. Sie waren ihrer Zeit weit voraus und hatten dadurch sehr bewegte Leben, dramatische Leben. Dadurch hatten sie wirklich etwas zu erzählen, nicht nur in ihrer Musik.
Jonas:
Was glaubst du, warum sind diese Diven in der deutschsprachigen Musik nach und nach verschwunden?
Alina:
Ich weiß es nicht. Aber diese Frage beschäftigt mich sehr, auch weil ich in den letzten Jahren immer wieder nach solchen Rollenbildern gesucht habe. Eine Ute Lemper beispielsweise, die ich durchaus als Diva bezeichnen würde, hat sich aus Deutschland zurückgezogen, weil ihre Art hier einfach nicht ankam – sie wurde in ihrer Divenhaftigkeit nicht akzeptiert. Vielleicht ist es daher einfach mal wieder Zeit für eine deutsche Diva. (Alina lächelt)
Jonas:
Vielleicht hatte man in Deutschland auch einfach jahrzehntelang Angst vor selbstbewussten Frauen.
Alina:
Ich hoffe nicht. Aber das wäre auf jeden Fall eine Erklärung.
Jonas:
Eine Diva wird man nicht von heute auf morgen, das braucht einen langen Anlauf. Wann in deinem Leben wusstest du, dass du Musik machen willst?
Eine ältere Dame streckte mir einen Kinderriegel ins Gesicht und sagte: »Das hast du ganz toll gemacht.«
Alina:
Rückblickend habe ich das schon immer irgendwo tief in mir drin gewusst und eine besondere Faszination für Musik verspürt. Ich erinnere mich an zwei Schlüsselmomente in meiner Kindheit, die aus heutiger Sicht ein Hinweis darauf waren, welche Richtung mein Leben einmal einschlagen wird.
Der erste Moment bezieht sich auf eine Situation, als ich etwa vier Jahre alt war. Meine Eltern hatten sich gerade mit einem kleinen Bürofachhandel selbstständig gemacht und ein Ladenlokal übernommen. Während sie damit beschäftigt waren, den Laden zu renovieren, saß ich alleine im Treppenhaus direkt nebenan. Ich war so gelangweilt, dass ich angefangen habe, irgendwelche Laute von mir zu geben. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich meine Stimme in einem Raum wahrgenommen und den Hall gespürt! Das hat mich total in Trance versetzt und begeistert. Ich weiß noch, wie ich da auf der Treppe saß, immer wieder neue Melodien erfand und nach und nach merkte, welche Kraft meine Stimme hat. Irgendwann – ich hatte mich so richtig verloren in meiner Welt – tippte mir jemand auf die Schulter. Eine ältere Dame, die ebenfalls in dem Haus wohnte, streckte mir einen Kinderriegel ins Gesicht und sagte: „Das hast du ganz toll gemacht.“
(Alina lacht)
Schlüsselmoment Nummer zwei ereignete sich kurze Zeit später, als ich mit meiner Familie eine Vorstellung von „Das Phantom der Oper“ in Basel besuchen durfte. Anne-Marie Kaufmann spielte damals eine der Hauptrollen – schon wieder eine starke Frau. Ich war total geplättet: diese Musik, diese Opulenz, dieses Drama! Noch vor Ort kaufte mir mein Vater die Musical-CD, die in den nächsten Wochen ständig bei uns lief. Sobald die CD eingelegt war, habe ich performt, auch im Ladenlokal. Das war für die Kunden, die in unseren kleinen Bürobedarf-Laden reinkamen, immer ein Highlight. Es gibt da diese eine berühmte Arie, in der die Stimme immer höher und höher wird – diese Arie konnte ich mitsingen! Und zwar bis zum höchsten Ton.
Jonas:
Du bist dann aber nicht als Kinderstar durchgestartet, sondern hast ganz klassisch studiert: Literatur-, Kunst- und Medienwissenschaften an der Uni Konstanz – mit Nebenfach Verwaltungswissenschaften.
Alina:
Oh Gott, ich habe keine Ahnung, wie ich die Prüfung in diesem Nebenfach geschafft habe. Den Studiengang habe ich mir hauptsächlich wegen der Medienwissenschaften ausgesucht, Literatur und Kunst haben mich am Anfang eher weniger interessiert. Dann wollte es das Schicksal aber so, dass mein Literatur-Professor irgendwie auf mich aufmerksam wurde und mich fragte, ob ich als Tutorin arbeiten möchte – im Fach „Einführung der Literaturwissenschaften I“. Ich habe einfach ja gesagt und im nächsten Moment gedacht: Um Gottes Willen, was hast du dir da eingebrockt? Vor anderen Menschen zu reden und Vorträge zu halten, das war für mich eine absolute Horrorvorstellung. Aus heutiger Perspektive war das aber eine sehr gute Schule: Nachdem ich mir den Stoff draufgeschafft hatte, war es supercool, mit und vor den Studenten zu reden. Das hat mir bis heute Einiges gebracht.
Jonas:
Mitte Juni hast du auf Facebook einen Post veröffentlicht, in dem es heißt: „Das Schicksal hat mich vor fünf Jahren nach Berlin gebracht, meine Stadt aus Gold.“ Was genau hast du damit gemeint? Was in deinem Leben war damals so schicksalhaft?
Ich habe mich irgendwie wie ein Kind gefühlt, das keine Berührungsängste hat – als Kind war ich furchtlos, auch auf der Bühne.
Alina:
Es gab in meinem Leben nicht diesen einen Schicksalsschlag, sondern eher ein großes Erwachen. Die Geschichte fängt damit an, dass ich vor etlichen Jahren in Konstanz nach einer Location für meine Geburtstagsparty gesucht habe und per Zufall an eine Künstlergruppe geraten bin. Diese Gruppe bestand aus Schauspielern, Musikern, Designern und Kreativen aus aller Welt, die unter anderem ein eigenes Theaterstück auf die Beine gestellt hatten und in der besagten Location regelmäßig spontane Konzerte und Jam-Sessions abhielten – so auch an dem Abend, an dem ich dort mal vorbeigeschaut habe, um die Räumlichkeiten für meine Party zu begutachten. Plötzlich fand ich mich inmitten eines kleinen Jazz-Konzerts wieder. Aus dem Publikum heraus habe ich spontan mitgesungen – und als die Band das mitbekommen hat, hieß es kurzerhand: „Sing du doch mal und komm nach vorne!“
Bis zu diesem Moment hätte ich mir nie vorstellen können, einfach so auf die Bühne zu gehen und zu improvisieren, ohne mir vorher den Text anzueignen oder den Song einzuüben – ich war eine Person, die immer akkurat vorbereitet sein musste. Dementsprechend war das ein großes Aha-Erlebnis für mich, ich hatte das Gefühl, als wäre in mir eine riesige Tür aufgegangen. Die positive Reaktion der Leute, die Euphorie, das Glücksgefühl – es war so wunderschön, sich einfach in diesen Moment fallen zu lassen.
An dem Abend habe ich mich irgendwie wie ein Kind gefühlt, das keine Berührungsängste hat – als Kind war ich furchtlos, auch auf der Bühne. Als ich dieses besondere, überwältigende Kindheitsgefühl gespürt habe, habe ich mit jeder Zelle meines Körpers gewusst: Musik ist genau das, was ich machen will in meinem Leben. Denn eigentlich war Musik schon immer meine größte Kraft und meine größte Leidenschaft. In meinem Studium fühlte ich mich eh irgendwie verloren, alles dort hatte mich nur noch so ein bisschen interessiert. Und so war klar: Es ist die Musik. Also machen wir Musik!
In den folgenden Wochen und Monaten habe ich zusammen mit einigen Straßenmusikern überall in Konstanz Musik gemacht, das war eine tolle Zeit. Ich habe dann relativ schnell herausgefunden, dass die Popakademie in Mannheim ein Ort wäre, der mich interessieren könnte und wo ich mich gerne bewerben möchte. Also habe ich angefangen, auf diese eine Bewerbung hinzuarbeiten: Ein ganzes Jahr lang habe ich nichts anderes getan, als Songs zu schreiben, diese in Eigenregie aufzunehmen, eine Band zu organisieren oder Videos zu drehen. Am Ende hat sich die Mühe gelohnt, ich wurde angenommen – Gott sei Dank, denn einen alternativen Plan hatte ich nicht in der Tasche. Ich würde sagen, das war die Geburtsstunde meines Weges.
Drei Jahre später hatte ich schon wieder das Gefühl, dass ich weiterziehen muss – und irgendetwas tief in meinem Inneren sagte mir, dass ich nach Berlin gehen sollte. Dieses Gefühl hat sich absolut richtig angefühlt, also habe ich in Mannheim alle Zelte abgerissen und bin schließlich vor fünf Jahren nach Berlin gezogen.
Jonas:
Du hast für deine Musik einen sehr individuellen und prägnanten Stil entwickelt. Hattest du vom ersten Tag an eine konkrete Idee davon, in welche Richtung du mit deiner Musik willst? Oder hat sich dieser Stil erst im Laufe der Jahre ergeben?
Es ist wichtig herauszufinden, was man nicht will. Man kommt schneller ans Ziel, wenn man Dinge für sich ausschließen kann.
Alina:
Für einen Künstler ist es die größte Herausforderung, Antworten auf bestimmte Fragen zu finden, wie zum Beispiel: Wie klingt meine Stimme? Was ist mein Sound? Welche ist meine Sprache? Welche Geschichten erzähle ich mit meiner Musik? Auch für mich war es das große Ziel, das Musikalische herauszufiltern und meine eigene Identität zu finden – und zwar in dem Moment, in dem ich mich entschlossen habe, Musik zu machen, und an der Popakademie angenommen wurde. Dementsprechend hat sich mein Stil mit der Zeit erst entwickelt.
Rückblickend kann ich sagen, dass es bei einem solchen Findungsprozess wichtig ist, sehr viel auszuprobieren – und vor allem herauszufinden, was man nicht will. Man kommt schneller ans Ziel, wenn man Dinge für sich ausschließen kann. Wenn man sagen kann: Das gefällt mir nicht, das bin ich nicht.
Jonas:
Wie etwa auf Englisch zu singen?
Alina:
Ja, genau. Ich habe bis vor sechs, sieben Jahren nur auf Englisch gesungen, bis ich mich schließlich im Deutschen gefunden habe. Diese Reise zu gehen, hat mir vor allem die Popakademie ermöglicht. Ich habe dort herausgefunden, dass ich im Englischen sprachlich eher so lala bin und dazu keine wirkliche Verbindung herstellen kann. Im Deutschen, meiner Muttersprache, gelingt mir das viel besser: Mit dieser Sprache kann ich alles bauen und alles genauso sagen, wie ich es will. Ich glaube, das war noch so ein Schlüsselmoment in meinem Leben.
In all den Jahren zuvor hatte ich verschiedenste Genres ausprobiert und irgendwie versucht diese zu erfühlen. Ich hatte Jazz gesungen, mich in die Klassik begeben und mich mit Hip-Hop, RnB und Soul auseinandergesetzt. Aber nie konnte ich eine echte Verbindung aufbauen.
Für mich war es eine krasse Erfahrung, dass meine Musik im Deutschen auf einmal eine ganz andere Farbe hatte, stimmlich wie inhaltlich. Das erste Lied, das ich dann auf Deutsch geschrieben habe, war der Song „Kind sein“. Dieses Lied hat den Grundstein gelegt für die Identität, die ich heute als Künstlerin habe, und war für mich wie ein Geschenk: Der Song sprudelte plötzlich aus mir heraus, als ich mit verschiedenen Sounds herumprobiert habe und über ein Celeste-Thema gestolpert bin, das mich sehr stark an meine Kindheit erinnert hat und mich nicht mehr loslassen wollte.
Ich dachte nur: Wow, wo kommt das denn her? Welche Seite von mir ist das? Und warum fühlt es sich so richtig an? Während mir in meinen ersten Jahren an der Popakademie noch nichts so richtig gelingen wollte, wusste ich mit diesem Song genau, wohin ich will. Von da an hat es ziemlich genau sechs Jahre bis zur Fertigstellung meines ersten Albums gedauert.
Jonas:
Dein Album trägt den Titel „Die Einzige“ und ist nach dem gleichnamigen Song benannt, der wohl der schonungsloseste und intimste auf der ganzen Platte ist: Du besingst darin das Gefühl, nicht gut genug zu sein, und erzählst von der Angst, ein Leben lang alleine zu bleiben. Wie ist dieses Lied entstanden?
Alina:
Vor knapp zwei Jahren hatte ich geplant, eine eigene EP herauszubringen – zusammen mit dem kleinen Label meines Managements, auf dem ich damals gesignt war. Den Showcase, den wir dazu veranstaltet haben, hat sich auch Tom Bohne angesehen, der President of Music bei Universal Music Deutschland ist. Tom wollte mich noch am selben Abend kennenlernen und sich mit mir unterhalten. Das war ein wirklich tolles Gespräch, denn Tom hat mir ein so differenziertes und professionelles Feedback gegeben, wie ich es vorher noch von keinem erhalten hatte. Irgendwie habe ich mich dadurch total von ihm gesehen gefühlt.
Unser Gespräch gewann immer mehr an Tiefe und irgendwann sagte Tom: „Du, Alina, ich finde es ja toll, dass deine Songs so persönlich sind. Ich glaube aber, dass es da noch Themen gibt, an die du dich noch gar nicht herangetraut hast.“ Das hat richtig gesessen! Und schon wieder ging in mir eine riesige Tür auf. Nicht nur, weil jemand wie Tom, der für mich so etwas wie eine lebende Legende im Musikgeschäft ist, mir diese große Aufmerksamkeit gewidmet hat. Sondern auch, weil ich instinktiv das Gefühl hatte, dass da was dran ist.
In den nächsten sieben, acht Tagen drehten sich in meinem Kopf ununterbrochen die Rädchen. Ich fragte mich ständig: Gibt es da noch irgendwelche Themen? Habe ich irgendetwas in mir übersehen? Und plötzlich – ich war gerade dabei, meine Wäsche zusammenzulegen – schoss mir folgende Frage durch den Kopf: „Ey, sag mal, bin ich eigentlich die Einzige, die für immer alleine bleibt?“ Auf einmal war nicht nur das Thema da, nach dem ich die ganze Zeit gesucht hatte. Mit dieser Frage hatte ich dazu gleich auch die wichtigste Songzeile in der Hand.
Eigentlich pocht dieses Thema ja schon seit Jahren in meiner Brust und ist omnipräsent in meinem Leben. Ich rede mit meinen engsten Freunden ständig über gescheiterte Dates, unglückliches Verliebtsein und die Angst, alleine zu sein. Dennoch ist es mir jahrelang nicht in Sinn gekommen, dieses Thema künstlerisch anzupacken – obwohl es so offensichtlich war.
Jonas:
Hast du eine Erklärung dafür, warum du an diesem offensichtlichen Thema so lange vorbeigelaufen bist?
Wer stellt sich schon gerne hin und sagt: »Juhu, ich bin Dauersingle!« Man möchte sich ja nicht selbst demütigen.
Alina:
Vielleicht weil das Thema nicht wirklich sexy ist. Wer stellt sich schon gerne hin und sagt: „Juhu, ich bin Dauersingle!“ Man möchte sich ja nicht selbst demütigen. Daher hatte ich vor dem Thema wahrscheinlich richtig große Angst. Aber beflügelt durch mein Gespräch mit Tom war ich nun absolut offen dafür.
Jonas:
Der oder die Einzige auf der Welt zu sein, das sagt sich so schnell. Dabei gibt es womöglich Millionen andere Menschen, denen es ganz genauso geht.
Alina:
Ich mag es, mit großen Begrifflichkeiten zu arbeiten. Songtitel wie „Die Einzige“, „Schönheitskönigin“ oder „Mit Größe gehen“ sind zwar große, schwere Worte. Sie alle haben aber eine inhaltliche Kehrseite. Und die Kehrseite kann ich am besten erzählen, indem ich die glanzvolle Fläche auf der Vorderseite nutze. Diese Herangehensweise hat es mir auch ermöglicht, den Song „Die Einzige“ zu schreiben, ohne mich dabei lächerlich zu machen.
Jonas:
Mit einer einzelnen Zeile, die man beim Zusammenlegen der Wäsche textet, hat man noch lange keinen fertigen Song. Wie hast du daran weitergearbeitet? Immerhin war ja nun endlich das gesuchte Thema da.
Alina (lacht):
Stimmt! Als plötzlich dieser Satz da war, konnte ich nicht einfach so mit der Wäsche weitermachen. Ich wollte so schnell wie möglich den Song entwickeln. Leider hatte ich in diesem Moment kein Instrument zur Hand. Also habe ich mein Handy genommen und aus dem Nichts heraus improvisiert.
(Alina stimmt die Melodie des Refrains von „Die Einzige“ an)
So ist die Melodie des Refrains entstanden. Das war einer der seltenen Momente im Leben, in denen sich ein Song richtig aufdrängt und endlich aus einem heraus will. Als ich den Refrain hatte, habe ich mein Handy wieder zur Seite gelegt, mich um die nächste Ladung Wäsche gekümmert und mir dabei Gedanken darüber gemacht, wie ich in die Strophe reinkomme. Ich habe mich wieder an das Gespräch mit Tom erinnert, der damals zu mir sagte: „Manchmal ist es ein gutes Stilmittel, Fragen zu stellen.“ Also habe ich Fragen gestellt. Und hatte bald die erste Strophe zusammen.
Mit diesem Gerüst aus Refrain und Strophe bin ich in eine erste Session mit meinem heutigen Gitarristen Robert gegangen. Ich hatte vorher nie mit ihm gespielt und habe daher vorgeschlagen: Wir können jetzt bei Null anfangen oder wir spielen diesen Song – den muss ich unbedingt zu Ende bringen. Gott sei Dank war Robert dafür total offen. Und so haben wir gemeinsam ein wundervolles Arrangement erarbeitet und ich habe die zweite Strophe geschrieben.
Leider hatten wir keine Möglichkeit, den Song in einer halbwegs ordentlichen Qualität aufzunehmen. Wir hatten nur eine krakelige Aufnahme, die alles andere als optimal war. Diese Aufnahme habe ich zu meinem ersten offiziellen Meeting mit Tom Bohne bei Universal Music mitgenommen, aber habe mich erst mal nicht getraut, sie ihm vorzustellen. Erst ganz am Ende unseres Gesprächs sagte ich: „Tom, du hast mich zu einem Song inspiriert, den würde ich dir gerne vorspielen.“
Dann habe ich mein Handy an seine Anlage angeschlossen und war mehr als peinlich berührt: Die Aufnahme war wirklich unterirdisch, der Song krakelte nur so durch die Boxen. Die Situation war so unangenehmen, dass ich permanent aus dem Fenster gestarrt habe, um irgendeinen Punkt zu finden, an dem ich krampfhaft meinen Blick festmachen konnte. Als das Lied zu Ende war, sagte Tom mit tiefer Stimme: „Krass!“ – man muss wissen, dass er nicht die überschwänglichste Art hat (Alina lacht). In diesem Moment war klar, dass es irgendeine Zusammenarbeit geben würde.
Als wir uns einige Wochen später zu einem zweiten Meeting trafen, hatte das Lied intern bereits Wellen geschlagen. Man muss wissen, dass Toms Assistentinnen und Assistenten immer alles mitbekommen, was Tom so abspielt. Eine seiner Mitarbeiterinnen umarmte mich und sagte: „,Die Einzige’, ,Die Einzige’! Das ist mein Lied! Mir geht’s genauso!“ Und nicht nur die Mädels im Vorraum haben über den Song gesprochen, auch die Abteilung nebenan hat irgendwie Wind davon bekommen. Dort fragten sie sich nur: „Sagt mal, warum findet sie denn keinen?“
Dadurch, dass der Song so schnell seine Runden gemacht hatte, war für mich klar: Das ist das Lied des Albums. Die eigentliche Kraft des Songs besteht ja darin, dass er sich anfühlt wie eine Trost spendende Umarmung. Wie du bereits gesagt hast: Im Grunde gibt es unzählige Menschen auf der Welt, denen es ganz genauso geht, die das Gefühl haben, der oder die Einzige zu sein.
Jedes Lied, das man auf dem Album findet, ist in einem sehr intimen Moment entstanden – in einem Moment, in dem ich zu mir selbst sehr ehrlich war und mich sehr alleine gefühlt habe.
Jonas:
Und weil „Die Einzige“ das Lied des Albums ist, hast du auch das Album selbst so benannt?
Alina:
Nicht ganz. Warum auch das Album „Die Einzige“ heißen muss, ist mir erst später klar geworden: Jedes Lied, das man auf dem Album findet, ist in einem sehr intimen Moment entstanden – in einem Moment, in dem ich zu mir selbst sehr ehrlich war und mich sehr alleine gefühlt habe. In jedem dieser Momente kam es mir vor, als wäre ich der einzige Mensch auf der ganzen Welt, dem es so geht. Daher heißt nicht nur dieser eine Song so, sondern auch das gesamte Album.
Jonas:
An diesem Album hast du ganze sechs Jahre lang gearbeitet. Hast du mit der Gewissheit, dass dein musikalisches Baby nun endlich geboren wird, auch deine Selbstzweifel besiegt?
Alina:
Selbstzweifel wird es in meinem Leben immer geben. Die Frage ist nur, woran genau ich zweifele. Als Künstlerin habe ich in den letzten Jahren sehr viel an Selbstbewusstsein gewonnen, das freut mich natürlich. Für mich ist es der allergrößte Erfolg, diese Platte gemacht zu haben. Dass sie genauso auf die Welt kommen darf, wie ich es wollte und geplante habe, macht mich sehr, sehr zufrieden.
Als Mensch ist es nochmal eine ganz andere Nummer. Dass man plötzlich ein glücklicherer Mensch wird, nur weil man eine Plattenfirma gefunden hat und endlich ein Album veröffentlichen kann, ist eine Illusion. Auch das ist mir in den letzten Jahren klar geworden. Glück zieht man nicht aus irgendeinem Erfolg, sondern aus anderen Momenten. Und die kann man nicht planen.
Trotzdem: Diesen Moment der vollkommenen Zufriedenheit und Glückseligkeit, den ich gerade erlebe, möchte ich so lange wie möglich konservieren und mir irgendwie erhalten. Ich weiß, das ist sauschwer, denn mein Leben schreibt sich kontinuierlich weiter – meine Musik schreibt sich kontinuierlich weiter. Da ich in meinen Songs immer das verarbeite, was ich gerade erlebe, bin ich eigentlich schon ein paar Schritte weiter. Und daher ist es auch schön, das Ganze nach sechs Jahren loszulassen.
Alina ist Musikerin und lebt in Berlin.
www.alinamusik.de
www.facebook.com/alinaoffiziell
@alinaoffiziell
Hair & Make-up: Luiza Simor / @luizasimor
Leonard Scheicher
Interview — Leonard Scheicher
Abschied vom Wilden Westen
Leonard Scheicher beschreitet als junger Boxer in „Es war einmal Indianerland“ die Täler der Liebe und die Gipfel der Ekstase. Rasend schnell und unglaublich intensiv erzählt dieses moderne Märchen vom letzten Wimpernschlag der Jugend.
18. Oktober 2017 — MYP N° 21 »Ekstase« — Interview: Katharina Weiß, Fotos: Roberto Brundo
Wer erinnert sich noch an die erste verbotene Hausparty? Den Einbruch ins Freibad? Die besoffene Prügelei mit dem besten Kumpel? Damals, als alles nach Ausbruch schrie, dauerhaft ein erregter Seufzer auf den Lippen lag und der kleinste Kiez die größten Abenteuer bereithielt! Der Spielfilm „Es war einmal Indianerland“ hat sich zur Aufgabe gemacht, dieses Gefühl auf Leinwand zu bannen. Und wer sich mit der Hauptfigur Mauser auf den cineastischen Streifzug begibt, wird während dieses psychedelischen Großstadt-Westerns mehr als einem nostalgischen Gedanken nachhängen.
So ungewöhnlich und originell wie „Es war einmal Indianerland“ ist auch Hauptdarsteller Leonard Scheicher, der in seiner bisherigen Karriere ein bemerkenswert glückliches Händchen für bizarr-unterhaltsame Filmstoffe bewies. Er verbringt mit uns den letzten schönen Herbsttag in Kreuzberg: Wir teilen heiße Schokolade, selbstgedrehte Zigaretten und jede Menge wunderbarer Jugendgeschichten. Ein Gespräch über Ekstase und Erotik, Verzweiflung und Verwandlung – ganz großes Kino eben.
Katharina:
Der Autor des Romans „Es war einmal Indianerland“, den ihr in ein cineastisches Feuerwerk verwandelt, hat sich bewundernd über die „mörderische Disziplin“ geäußert, die du an den Tag legen musstest, um der Boxer-Physis deiner Rolle gerecht zu werden. Wie hat sich diese Metamorphose vollzogen?
Ich stand schon oft vor dem Spiegel im Fitness-Studio und hatte Tränen in den Augen, weil ich dachte: Verdammt, ich kriege das nicht hin.
Leonard:
Einen Boxer zu spielen war gleichzeitig Traum und Herausforderung. İlker Çatak, der Regisseur, meint, wir müssten andere Filme machen und neu erzählen! Er denkt groß und eigen, und da hatte ich so Lust drauf! Diese Rolle musste ich unbedingt spielen. Also bin ich vor dem Casting zum Boxtraining gegangen und habe mich im Fitnessstudio angemeldet. Als ich die Rolle dann bekam, war klar: Ich höre jetzt auf zu rauchen und zu trinken. Ich trainiere wirklich sechsmal die Woche, gehe zum Boxen und Gewichtheben. Ich bin normalerweise ja eher ein Strich in der Landschaft. Ohne eiserne Disziplin wäre das nicht möglich gewesen – einige Fitness Coaches meinten zuvor sogar, es sei unmöglich, diese Verwandlung in vier Monaten hinzubekommen… Da gibt es auch stille Momente der Verzweiflung. Wenn dir Mal wieder einer sagt: „Du schaffst das nicht.“ Ich stand schon oft vor dem Spiegel im Fitness-Studio und hatte Tränen in den Augen, weil ich dachte: Verdammt, ich kriege das nicht hin.
Katharina:
Welcher Verzicht war am härtesten?
Leonard:
Süßigkeiten! Crêpes und Croissants… Es ist ein sehr einsames Leben: Du stehst auf, isst, gehst zum Trai-ning, dann kaufst du ein, um das richtige Essen im Kühlschrank zu haben, und gehst früh schlafen. Es war unbedingt notwendig für mich, durch diese Veränderung des Körpers auch der Rolle näherzukommen. Ich wollte, dass man meiner Figur, dem Mauser, abnimmt, Sportler zu sein. Er sollte kein aufgepumptes Viech, sondern ein drahtiger Boxer in meiner Gewichtsklasse werden. Als ich dann die ersten deutlichen Erfolge sehen konnte, hat es sich auch total verändert, wie ich durch die Straßen gehe – man geht auf Konfrontationen anders ein.
Katharina:
Hast du dich geprügelt in dieser Zeit?
Leonard:
Nein, aber das Selbstbewusstsein wächst! Man weiß, dass man sich notfalls wehren kann… Ähnlich wie beim Schauspiel geht es viel um Räume: Wann und wie betrete ich den des anderen – und wie kann ich Reaktionen vorhersehen?
Katharina:
Hast du dich dann auch als #gymboy auf Instagram profiliert?
Leonard:
Instagram habe ich gar nicht. Diese Social Media-Technik hatte ich noch nie so raus. Aber natürlich konnte ich da jede Menge spannender Leute im Fitnessstudio beobachten. Zum Beispiel die eine Jungs-Gang mit den aufgepumpten Armen, die Freitagabend direkt vom Gewichtheben in den Club gehen. Ich hab’ meine Verwandlung dann eher im Privaten mit Stolz hergezeigt. Von diesem harten täglichen Training ist aber nach Drehschluss nicht viel übrig geblieben. So schnell die Muskeln da sind, so schnell sind sie auch wieder weg. Und abseits der Rolle genieße ich ein ungeplantes Leben viel zu sehr!
Zu Mauser passt am besten der Satz, mit dem er sich auch im Film beschreibt: »Da, wo ich herkomme, ist ein Wort ein Wort.«
Katharina:
Deine Figur Mauser verliebt sich in die wunderschöne und wohlstandsverwahrloste Jackie. Deine Schauspielkollegin Emilia Schule beschreibt sich im Film als „eitel, zickig und unkeusch“ – mit welchen drei Worten würdest du dich vorstellen?
Leonard:
Privat? Ehrlich, offen und zurückhaltend. Zu Mauser passt am besten der Satz, mit dem er sich auch im Film beschreibt: „Da, wo ich herkomme, ist ein Wort ein Wort.“
Katharina:
Mauser wird im Buch und im Film von einem stillen Indianer verfolgt – ein erzählerisches Sinnbild, das Mausers abstrakte Seelenlandschaft einfängt. Welcher Indianer verfolgt dich?
Leonard:
Das Bauchgefühl. Bei mir hat das was mit großem Wollen zu tun, das begleitet mich ständig. Für jede Figur entwickle ich zum Beispiel ganz am Anfang eine Idee – die verfolge ich dann mit dem vollen Risiko, nie zu wissen, ob diese Idee am Ende aufgeht.
Katharina:
Deine Figur macht am Anfang des Film etwas sehr aufregendes: Mauser ritzt sich die Handynummer seines neuen Schwarms Jackie in den Handrücken. Hast du schon mal etwas ganz Verrücktes für die Liebe gemacht?
Leonard:
Ich war eher so der Typ, der Gedichte geschrieben hat. Deswegen hat mich diese Arbeit auch so erfüllt: Dieses große Suchen „Wo ist Mauser in mir?“ war wahnsinnig spannend.
Katharina:
Spannend ist auch die Filmbeziehung zwischen dir und Kumpel Kondor – hattest du ebenfalls so draufgängerische Freunde, die dich in verbotene Abenteuer hineingezogen haben?
Leonard:
Wilde Freundschaften, in denen man sich behaupten muss? Ich erinnere mich an einen… der war älter und auch im Fußballverein – das alles war ganz schön ellenbogig. Er hatte schon Erfahrung mit Sexualität und diesen Dingen, im Gegensatz zu ihm sahen wir anderen ganz klein aus. So einem will man daher immer wieder genügen und beweisen, dass man auch cool ist. Obwohl einem die ganze Zeit bewusst wird, wie klein und süß man eigentlich noch ist.
Aber so einen ganz extremen Typ wie Kondor kannte ich nicht, den gab’s in meinem Umfeld einfach nicht. Allerdings habe ich mich oft von Mädchen mitreißen lassen, so wie es im Film der Figur Mauser mit der unnahbaren Jackie passiert. Ich glaube, jeder hat in seinem Leben eine Jackie – oder einen James!
Damals war ich oft verliebt in solche Mädchen wie Jackie – ich war aber natürlich viel zu schüchtern.
Katharina:
Hach, der eine „Bad Ass“-Typ aus der Parallelschule… Aber zehn Jahre später denkt man sich oft: Jetzt, wo er nicht mehr so unerreichbar ist, ist er nicht mehr so begehrenswert.
Leonard:
Später im Leben drehen sich diese Dynamiken meistens um, da ändert sich nochmal ganz viel. Damals war ich oft verliebt in solche Mädchen wie Jackie – ich war aber natürlich viel zu schüchtern.
Katharina:
Erinnerst du dich noch an den Geruch des ersten großen Party-Verliebtseins?
Leonard:
Ja, es hat unfassbar nach Wodka Bull gerochen. Und man hatte den Shisha-Rauch noch in der Nase, es lief Chartmucke…
Katharina:
…und der Raum war erfüllt von süßlichem Mädchendeo.
Leonard:
Uhja, auf jeden Fall!
Katharina:
Das Zitat „Mädchen riechen gut“ zieht sich ja auch durch den Film – für Mauser einfach der Geruch von Abenteuer. Ein bisschen hat mich die Wild-West-Thematik von „Es war einmal Indianerland“ daran erinnert, dass man in der Pubertät unerschlossenes Land betritt – und erobert.
Leonard:
Für mich liegt die Betonung des Filmtitels eher auf „Es war einmal“. Es geht um den Moment, in dem man den wilden Westen und die Spielzeuglandschaft hinter dich lässt. Das Indianerland ist vorbei, jetzt beginnt so langsam das Erwachsenwerden.
Die Abizeit – mein Gott, war das schön! So sorglos, so behütet und doch so wild.
Katharina:
Erinnerst du dich noch an die Phase, als du angefangen hast, der Jugend hinterher zu trauern?
Leonard:
Das passiert ziemlich oft. Vor allem, wenn ich in München alte Leute aus der Schulzeit treffe und wir gemeinsam an die Abizeit denken. Mein Gott, war das schön! So sorglos, so behütet und doch so wild. Danach bin ich ja nach Berlin an die Schauspielschule gegangen – und musste schon Steuererklärungen machen!
Katharina:
Wie es der Zufall will, habe ich bisher alle deine Filme gesehen. Von „Die Quellen des Lebens“ über „Finsterworld“ und „Das Romeo-Prinzip“ hast du ein eigenartig glückliches Händchen für deine Rollenauswahl bewiesen – alle sehr ungewöhnliche und einzigartige Filme, die ein sehr spezielles Bild des neuen deutschen Humors zeichnen. Wie hast du es als junger Darsteller geschafft, um die klischeehaften Brötchen-Jobs herumzukommen?
Leonard:
Zum einen hatte ich Glück, von Anfang an für solch große Produktionen spielen zu dürfen, zum anderen liegt es an der Auswahl: Zu welchen Castings geht man und zu welchen nicht. Ich habe öfter Nein gesagt – weil ich mich nur für Dinge engagieren kann, die mich wirklich interessieren. Ich habe ja auch noch keine Verpflichtungen anderen gegenüber, muss keine Familie ernähren und kann daher freier wählen. Als ich nach meinen ersten beiden Filmen und dem Schulabschluss von Bayern nach Berlin gezogen bin, um an der Hochschule Ernst Busch Schauspiel zu studieren, hatte ich auch eine Zeit, in der ich mich ausschließlich auf das Theater konzentrieren konnte. Ich hatte nur dort vorgesprochen – mein Alternativplan wäre Wasserbauingenieur gewesen. Ich wollte Brunnen in Afrika bauen und Flüsse begradigen.
Katharina:
Kannst du dich mit dem extrem schrägen, morbiden Humor dieser Filme identifizieren?
Leonard:
Ja, tatsächlich. Trocken und irgendwie vielleicht auch intellektuell, diese Art von Humor mag ich besonders. Aber ich stehe auch auf solche Witze wie: „Zwei Eier im Kühlschrank, sagt das eine: Boah, rasier’ dich mal! Darauf das andere: Ich bin ’ne Kiwi, du Idiot!“
Katharina:
Gerade dein erster Film – „Die Quellen des Lebens“ – hatte einen außergewöhnlichen Cast, dort traf sich das „Who is Who“ der deutschen Schauspielszene. Wie war es damals, als absoluter Anfänger so einen Start zu erleben?
Leonard:
Moritz Bleibtreu spielte meinen Vater, Jürgen Vogel meinen Großvater, Meret Becker meine Oma – das war schon echt ein Traum. Ich weiß auch noch: Bei meinem zweiten Casting bei Oskar Roehler wollte ich ein Autogramm von ihm haben. Er ist auf die wunderbarste Weise verrückt.
Katharina:
Du siehst in jedem Film grundverschieden aus – eine Wandlungsfähigkeit, die gute Schauspieler auszeichnet. Spielst du auch im Privaten gerne mit verschiedenen Rollen und Accessoires?
Leonard:
Überhaupt nicht. Ich hab nicht viele Klamotten – und die trage ich, bis sie zerschlissen sind. Ich sehe eigentlich immer gleich aus.
Katharina:
Aber ein paar Fashion-Jugendsünden werden doch auch bei dir dabei sein? Du kommst ja wie ich aus München, da war in unserer Pubertät „Ed Hardy“ ganz in…
Leonard:
„Ed Hardy“? Tatsächlich nicht! Ich war Indie-Rocker. Knallenge Röhrenjeans, ein Katzenshirt und darüber ein zu kurzes Jackett. In diesem Outfit bin ich zur Schulzeit oft mit einem Kumpel nach Berlin gefahren. Und dann sind wir in den „Bang Bang Club“ gegangen, der war damals am Hackeschen Markt unter der S-Bahn-Brücke. Da kam man schon mit 16 Jahren rein, für zwei Euro – was für einen Münchner der Wahnsinn war. Und da konnten wir dann immer mit irgendwelchen Mädchen rumknutschen, das war das Höchste. Das war das Pendant zum „Atomic Café“ in München. Legendär, aber jetzt leider geschlossen. Die Erinnerungen an diese Zeit sind wie ein großer Strudel und nicht linear erzählbar. Genau das wollten wir auch mit „Es war einmal Indianerland“ umsetzen. Der Film hat bewusst keine klassische Zeitstruktur, weil sich auch die Jugend nicht chronologisch erzählen lässt.
Ekstatisches Arbeiten. Verzweifeln und dann doch unfassbar befriedigt sein, bis man nach der Vorstellung ein Lob bekommt und ganz kurz denkt: Yeah, ich bin der Größte!
Katharina:
Was waren für dich als Jugendlicher Momente absoluter Ekstase?
Leonard:
Zum einen: Die ersten Male tanzen gehen, mit allem was dazugehört. Zum anderen: Auf der Bühne sein, dass empfand ich immer wie einen Rausch. Bis spät in die Nacht arbeiten, oft an eigenen Sachen, viel reden, viel trinken… und dann völlig verschlafen in der Schulbank sitzen, um nachmittags wieder zur Probe zu gehen um mit ganz vielen Freunden ein Stück auf die Beine zu kriegen. Ekstatisches Arbeiten. Verzweifeln und dann doch unfassbar befriedigt sein, bis man nach der Vorstellung ein Lob bekommt und ganz kurz denkt: Yeah, ich bin der Größte! Aber man erlebt diese Ekstase in der Gemeinschaft, das ist ganz besonders.
Katharina:
In “Es war einmal Indianerland“ landet der asketische Mauser ja mehr oder weniger unfreiwillig auf diesem irren Festival. Dort probiert er eine LSD-ähnlichen Drogen und wird von Jackie in den Sog dieses Partyabenteuers gezogen. Wie erinnerst du dich an diese Szene?
Leonard:
Mauser ist ja ein eher zurückgezogener Typ. In diesem Teil der Geschichte konnte ich ihn zum ersten Mal körperlich groß spielen, theatral und extrem. Wir hatten richtige Choreografien, alles war abgefahren – vom Licht bis zu unserer Stimmung. So wie es jetzt für den Zuschauer aussieht, hat es sich auch angefühlt.
Katharina:
Damit befasst sich auch eine andere, sehr einprägsame Szene: Mauser ist im Drogenrausch und es bahnt sich ein verstörender und doch seltsam erregender Liebesakt zwischen dir und Schauspielkollegin Emilia Schüle an.
Leonard:
Für mich war das immer eine Fast-Vergewaltigung…
Katharina:
…die für mich als Zuschauerin gerade noch so im richtigen Moment aufgelöst wurde, um die Sympathien mit der Hauptfigur nicht vollkommen zu verlieren.
Die Szene enthält Gewalt, aber auch ehrliche Sexualität. Da denkt man als Zuschauer fast schon an den Reiz von BDSM.
Leonard:
Dieser Moment im Film ist sehr ambivalent: Er enthält Gewalt, aber auch ehrliche Sexualität. Da denkt man als Zuschauer fast schon an den Reiz von BDSM. Alles gedreht in einem engen Zelt, darin nur wie beide und die Kamera – sehr intensiv.
Katharina:
Dieses Netz aus Zärtlichkeit und Aggression blieb mir stark im Gedächtnis. Hat euch der Regisseur die Kamera im Zelt gelassen und gesagt: „Macht mal!“ Oder wie choreografiert man das?
Leonard:
Ein „Macht mal!“ bei solchen Szenen ist eine Katastrophe für Schauspieler. Dann wüsste man gar nicht, wohin mit sich. Wie spielt man? Oder lässt man sich von seinem Gefühl, also seinem Trieb leiten? Das wäre wirklich peinlich. Nein, nein, wir haben uns da Wochen vorher eine Choreografie überlegt und diese dann so gut wie möglich gefüllt.
Katharina:
Ihr habt ja auf dem polnischen „Garbicz Festival“ gedreht – während sich in diesem Hipsterparadies die echten Festivalbesucher ringsherum ausgelassen mit Techno und Drogen vergnügt haben. Wie wild darf man sich so einen Dreh ausmalen?
Leonard:
Es ist ein Spielplatz für Erwachsene, abseits jedes Berufsalltags – ein Ort, an dem man träumen kann. Und für mich auch das allererste Festival, auf dem ich je war. Die Umsetzung dort war zum Teil sehr anstrengend, weil sich in dem Zustand natürlich keiner filmen lassen will. Es gibt keine Spiegel dort – und wir kamen da mit Kameras an. İlker Çatak kannte aber viele, die auf dem Festival gearbeitet haben. Und der Komponist der Filmmusik, Acid Pauli, hat dort aufgelegt und ein paar Freunde mit vor die Kamera geschleppt.
Katharina:
Und wie ging es nach Drehschluss weiter?
Leonard:
Was auf dem „Garbicz“ passiert, bleibt auf dem „Garbicz“. Aus unserer kleinen Crew ist so eine eingeschworene Gemeinschaft geworden – wir hatten eine super Zeit!
Katharina:
Was steht bei dir gerade an?
Leonard:
Als nächstes kommt „Macht euch keine Sorgen“: Ein Film über einen jungen Mann, der in den „Heiligen Krieg“ des IS zieht. Sein Vater und sein älterer Bruder, verkörpert von mir, reisen ihm nach, um ihn zurückzuholen. Dafür haben wir auch eine Woche in Palästina gedreht. Ein Land, umgeben von Stacheldrahtzäunen und einer neun Meter hohen Mauer. Man sieht den anderen gar nicht mehr – ein wahnsinnig eindringliches Erlebnis.
Katharina:
Mit der Geschichte einer Mauer beschäftigt sich auch dein zweites neues Projekt „Das schweigende Klassenzimmer“.
Leonard:
Der Film handelt von einer Schulklasse 1956 in Storkow. Junge Abiturienten hören auf einem Westsender, wie brutal der Aufstand in Ungarn niedergeschlagen wurde. Daraufhin hält diese Klasse während des Unterrichts eine Schweigeminute ab und gerät dadurch in die Mühlen des Stasi-Systems. Wir erzählen die Geschichte, wie diese Klasse gegen alle Erpressungsversuche zusammenhält.
Bei dem gegenwärtigen Rechtsruck ist es unbedingt nötig, sich ständig zu informieren.
Katharina:
Bist du politisch interessiert?
Leonard:
Ich versuche es zu sein. Ich bin nicht damit aufgewachsen, aber bei dem gegenwärtigen Rechtsruck ist es unbedingt nötig, sich ständig zu informieren. Ich bewundere auch Künstler, die da direkt Stellung beziehen.
Katharina:
Und welche Künstler bewunderst du aus schauspielerischer Sicht am meisten?
Leonard:
Ein sehr extremes Spiel fasziniert mich. Das können oftmals und besonders die Schauspieler, die vom Theater kommen. Einige Zuschauer empfinden das als unglaubwürdig, aber für mich hat das eine Virtuosität, die mich unglaublich begeistert. Auf der anderen Seite schätze ich Unmittelbarkeit – direkt, natürlich, locker. Letzteres können vor allem die Amerikaner: Immer aus der Hüfte, das begeistert mich sehr.
Katharina:
Die Amerikaner haben jetzt mit dem „Harvey Weinstein-Skandal“ ein ganz schönes Branchenproblem aufgedeckt. Wäre so etwas hier in Deutschland auch möglich?
Leonard:
Ja, davon bin ich überzeugt. Auch wenn ich als Mann weniger damit konfrontiert werde: Diese Zeichen von Machtausübung und was man mit Macht alles anstellen kann, durchdringen jeden Bereich der Gesellschaft.
Katharina:
Wo wir gerade bei den Schattenseiten der menschlichen Seele angelangt sind: In „Es war einmal Indianerland“ passiert ein Mord – neben den zwei Boxkämpfen ein weiterer stilistischer Kniff. Wie muss man mit dem Stilmittel Gewalt in so einem Film umgehen?
Leonard:
Wir arbeiten da eher mit Andeutungen, die Gewalt ist nicht so bildlich wie bei „Game of Thrones“. Zeigen durch Verbergen: Ein altbewährtes Stilmittel der Kunst, das zwar intellektuell fordert, aber auch Projektionsflächen für den Zuschauer eröffnet. Hier verbinden sich Fantasie und Fallhöhe.
Leonard Scheicher ist 25 Jahre alt, Schauspieler und lebt in Berlin.
Aaron Hilmer
Interview — Aaron Hilmer
Spiel mit Extremen
Der Hamburger Schauspieler Aaron Hilmer gilt im deutschen Film als Spezialist für die Rollen markanter Underdogs, zuletzt war er im Kino als ultrareligiös erzogener Teenager zu sehen. Im Interview verrät uns der 18-Jährige, wie er sich am Set in Ekstase versetzt, warum er keine Angst vor dem Erwachsenwerden hat und wieso seine Generation alles andere als unpolitisch ist.
9. Oktober 2017 — MYP N° 21 »Ekstase« — Interview: Jonas Meyer, Fotos: Steven Lüdtke
Als Oliver Hörr vor etlichen Jahren nach Hamburg zog, wollte er sich nicht so recht wohlfühlen in der Stadt. Irgendetwas fehlte ihm. Der 49-Jährige, der im Laufe seines Lebens die ganze Welt bereist hatte, hätte sich eigentlich pudelwohl fühlen müssen hier in Hamburg, dem sogenannten Tor zur Welt, mit all den aufregend-anrüchigen Bars, Clubs und Etablissements, in die seit Jahrzehnten, ja seit Jahrhunderten jeder einkehrt, der aus der kleinen und der großen Welt mal eben zu Besuch ist.
Hamburg versteht es auf besondere Art, den Besuchern und Zugezogenen seinen ganz eigenen, in Lokalkolorit getauchten Stempel aufzudrücken: auf der Reeperbahn versacken, Fischbrötchen essen, Anker tätowieren. Aber umgekehrt? Was, wenn die Stadt nicht zum eigenen Stil, zum eigenen Leben passt? Was, wenn es keinen Ort gibt, an dem man sich richtig wohlfühlt, wenn man abends seine Freunde auf ein Getränk treffen will?
Für Oliver lag die Lösung auf der Hand: Wenn es einen solchen Ort nicht gibt, muss man ihn schaffen. Und so entstand vor wenigen Jahren in der Steinstraße der Central Congress – eine Bar, die so ganz anders ist als das, was man vor Augen hat, wenn man an Hamburg und Nachtleben denkt. Mit klar gezeichneten Stühlen und Tischen, die wie in einem Konferenzsaal arrangiert sind, und holzvertäfelten Wänden lässt die Bar die zurückhaltende Eleganz aus Zeiten der Bonner Republik wiederauferstehen. Stilvoller kann man die Sachlichkeit der 1960er Jahre nicht inszenieren.
Hier im Central Congress haben wir uns heute mit dem Hamburger Schauspieler Aaron Hilmer verabredet. Zuletzt war der 18-Jährige im Kinofilm Einsamkeit und Sex und Mitleid von Regisseur Lars Montag zu sehen, in dem er einen verschüchterten jungen Mann namens Johnny spielt. Davor hatte er als Kleinkrimineller einen schlagkräftigen Auftritt im Berliner Tatort und spielte an der Seite von Frederick Lau in der Komödie „Schrotten!“. Drei Charaktere, die sich irgendwie nicht damit abfinden wollen, dass ihre Umwelt von ihnen eine gewisse Anpassung verlangt. Passt ja eigentlich ganz gut, hier im Central Congress. Also auf zur Konferenz mit Aaron Hilmer!
Jonas:
In „Einsamkeit und Sex und Mitleid“ hast du die Rolle des Johnny übernommen, der in einer sektenartigen Religionsgemeinschaft aufgewachsen ist und unter der autoritären Herrschaft seiner Mutter leidet. Was hast du für diesen Charakter empfunden, als du dich mit dem Drehbuch befasst hast?
Aaron:
Johnny war mir viel näher, als ich vermutet hätte – diese Nähe ist bereits beim allerersten Lesen entstanden. Ich habe ihn als einen wahnsinnig liebevollen, aber gebrochenen Charakter wahrgenommen und großes Mitleid empfunden. Dieser Figur steht meiner Meinung nach der Part „Mitleid“ am meisten zu. „Sex“ natürlich auch, aber hauptsächlich „Mitleid“.
Johnny ist eigentlich ein richtig guter Kerl und total harmlos, er hat sein Herz am rechten Fleck. Leider ist sein Leben komplett von den Umständen geformt, in denen er aufgewachsen ist. Dadurch steht er im Zwiespalt mit sich selbst: Auf der einen Seite versucht er, die Regeln der Sekte einzuhalten – Sexualität gilt als große Sünde. Auf der anderen Seite ist er ein ganz normaler Jugendlicher, der sich für Mädchen interessiert und sich ausprobieren und endlich Sex haben will. Irgendwo dazwischen versucht er sich zu finden.
Bei jemandem, der mir im echten Leben begegnet, kann ich nicht erahnen, welche Hintergründe, welche Abgründe er hat.
Jonas:
Wenn du in der Realität, beispielweise in der Schule, einem Menschen wie Johnny begegnet wärst, wäre da eine ähnliche Nähe entstanden? Hättest du für ihn dasselbe Maß an Mitleid empfunden?
Aaron:
Nein, ich glaube nicht. Wenn ich so einen Menschen im echten Leben getroffen hätte, wäre er mir wahrscheinlich nicht so nah gewesen wie Johnny. Und ich hätte weniger Mitleid gehabt. Das liegt aber daran, dass mir das Drehbuch des Films gleich auch die gesamten Lebensumstände von Johnny mitgeliefert hat – das passiert in der Realität eher selten. Bei jemandem, der mir im echten Leben begegnet, kann ich normalerweise nicht erahnen, welche Hintergründe, welche Abgründe er hat. Plakativ gesagt: Ich würde immer nur einen Johnny sehen, bei dem ich nichts von der grauenvollen Mutter oder der Sekte wüsste.
Ganz allgemein bin ich aber jemand, der andere Menschen gerne dazu anregt, aus sich herauszukommen – in der Schule, im Freundeskreis, wo auch immer. Die Hintergründe der Leute spielen da zuerst einmal keine Rolle, man kann sie einfach wegfallen lassen.
Jonas:
Im Leben des Johnny ist alles verboten, was für andere alltäglich ist: Liebe, Sex, Ausgelassenheit, Freiheit, Individualität. Das ist fast so, als wäre es einem untersagt zu atmen. Wie hast du dich auf eine Rolle vorbereitet, der jede Selbstverständlichkeit eines normalen Lebens fremd ist?
Aaron:
Ich mache mir im Vorfeld eher wenige Gedanken darüber, wie ich so eine Rolle konkret angehen kann. Wenn ich spiele, bin ich sehr impulsiv und lasse mich von meinem Instinkt leiten. Ich komme dann in eine Art Tunnel und höre auf zu denken. Das klappt natürlich nur, wenn ich in meinem Text sicher bin und den Charakter, den ich spiele, verinnerlicht habe. Anhand der Fakten, die mir das Drehbuch liefert, versuche ich nachzuvollziehen, wie es der Figur in der entsprechenden Situation gehen muss. Und dann setze ich mir diesen Charakter Stück für Stück zusammen.
Was mir speziell bei Johnny sehr geholfen hat, war seine Körperhaltung: Er steht nie aufrecht, ist in sich zusammengesackt, verspannt und verängstigt. Alleine mit dieser Körperlichkeit kann man den Charakter sehr gut erzählen.
Als ich das gespielt habe, war ich mit meinen Gefühlen irgendwo ganz anders.
Jonas:
Durch seinen inneren Kampf wird Johnny letztendlich dazu gebracht, sich auszupeitschen, um sich für seine „sündigen Gedanken“ zu bestrafen. Dabei gerät er in einen Modus irgendwo zwischen Fanatismus und Ekstase. Hast du dich bei dieser Szene ebenfalls von deinem Instinkt leiten lassen?
Aaron:
Als ich das gespielt habe, war ich mit meinen Gefühlen irgendwo ganz anders. Das war ein echtes Erlebnis! Ich liebe diese Momente, in denen man emotional ganz aus sich heraustritt und sich in seinem Spiel in eine Art Ekstase begibt. Das Schwierige dabei ist, trotzdem die Kontrolle über seine Technik zu behalten, um das, was man gerade tut, irgendwie lenken zu können. Das ist ein echter Balanceakt – und war bei Johnny eine große Herausforderung.
Jonas:
Wie war das erste Treffen mit Regisseur Lars Montag? Hattet ihr beide eine ähnliche Vorstellung von der Rolle?
Aaron:
Ich glaube, bei diesem Charakter gab es für mich gar nicht so viel Spielraum – was in Johnnys Leben passiert, ist dafür einfach zu eindeutig. Ohnehin war es auch nicht so, dass mir Lars zuerst erzählt hat, wie er sich die Figur vorstellt, und ich dann meine Gedanken dazu präsentiert habe. Das war eher ein Prozess. Johnny ist Stück für Stück entstanden und mit jeder Idee gewachsen, die dazukam.
Jonas:
Johnny scheint im Film die einzige Figur zu sein, die ein reines Herz hat – er ist der Einzige, der keine Schuld daran hat, dass er so ist, wie er ist. Allen anderen Charakteren haftet irgendein selbst verursachter Makel an, weil sie sich falsch verhalten oder eine Tat begangen haben.
Aaron:
Er ist auch eine der wenigen Figuren, die sich über den Film stark entwickeln. Neben ihm gelingt das nur Robert Pfennig – dem Vater des Mädchens, in das sich Johnny verliebt. Robert wird übrigens gespielt von Rainer Bock, den ich wirklich sehr bewundere. Die anderen Figuren, beispielweise die beiden Polizisten, schaffen diese große Entwicklung nicht.
Jonas:
„Einsamkeit und Sex und Mitleid“ erzählt im Großen und Ganzen die Tragik des menschlichen Lebens und beschreibt dabei Situationen, die man eher im fortgeschrittenen Erwachsenenalter als in seiner Jugend erlebt. Du selbst warst bei Drehbeginn gerade einmal 17 Jahre alt. Hat es dich beängstigt, welchen Ausblick der Film auf das Leben gibt?
Aaron:
Nein, überhaupt nicht. Jeder hat doch so seine Baustellen und wird immer wieder vor Probleme gestellt. Daher hat mich die Vorstellung auch nicht schockiert, wie es vielleicht später einmal sein könnte. So weit denke ich auch gar nicht – ich denke eher im Moment und schaue, was jetzt gerade Sache ist. Meine Mutter sagt immer, wenn mir die Dinge zu Kopf steigen: „Aaron, vertrau doch einfach mal.“ Aber auf was genau, das sagt sie nicht.
Jonas:
Was war denn bisher deine größte Baustelle?
Aaron:
Ich hatte eine lange Zeit mit einer starken Gelenkkrankheit zu tun. Und zu Hause war es auch nicht immer leicht. Aber gerade beim Schauspielen merke ich, dass solche Baustellen auch gleichzeitig ein riesiges Geschenk sein können. Ich finde, an so etwas wächst man.
Dass sich alle Figuren meistens falsch entscheiden, macht letztendlich die große Satire des Films aus.
Jonas:
Ganz abgesehen davon, dass „Einsamkeit und Sex und Mitleid“ in seiner gesamten Tragik wahnsinnig lustig ist: Gibt es darüber hinaus noch etwas Positives, das du aus dem Film ziehen kannst?
Aaron:
Absolut! Der Film ermutigt ein Stück weit dazu, in seinem Leben Dinge zu tun, an die man sich sonst nicht herantrauen würde.
Jonas:
Zum Beispiel?
Aaron:
Alle Charaktere setzen sich permanent mit sich selbst auseinander – auf die verschiedensten Arten: Allen Figuren stehen etliche Optionen und Richtungen offen, die sie wählen können. Dass sie sich meistens falsch entscheiden, macht letztendlich die große Satire des Films aus, der ja unsere gesamte Gesellschaft auf überzogene Art und Weise darstellt.
Jonas:
Ist die Darstellung wirklich überzogen?
Aaron:
Nein, eigentlich nicht. Man hat sich hier und da aber definitiv auch Extreme herausgesucht.
Jonas:
Es gibt eine interessante Parallele in deiner noch jungen Karriere: Die Figur Johnny ist sehr stark vom Thema Liebe getrieben und agiert auch dementsprechend. Dasselbe Motiv charakterisiert eine ganz andere Rolle, in der man dich vor einigen Monaten sehen konnte: Im Berliner Tatort „Amour Fou“ spielst du Stipe Rajic, einen Teenager, dessen Handlungen im Wesentlichen dadurch bestimmt sind, dass er unglücklich in ein Mädchen verliebt ist.
Egal woher man kommt, egal wer man ist: Am Ende geht es immer nur um ein Stück Anerkennung und Liebe.
Aaron:
Stimmt. Johnny und Stipe – beide haben eigentlich ein gutes Herz. Beide suchen nach einem Platz, an den sie hingehören, beide suchen die Liebe. Wir alle suchen doch die Liebe! Egal woher man kommt, egal wer man ist: Am Ende geht es immer nur um ein Stück Anerkennung und Liebe. Zwischen beiden Figuren gibt es allerdings einen entscheidenden Unterschied: Während Johnny eher verschüchtert ist und keiner Fliege etwas antut, ist Stipe getrieben von Wut, Aggressionen und Vorurteilen.
Für mich geht es bei der Schauspielerei darum, Missstände aufzudecken und gewissen Problemen eine Bühne zu geben.
Jonas:
Auch „Einsamkeit und Sex und Mitleid“ dreht sich um Vorurteile und gesellschaftliche Konventionen, beispielweise bei den Vorbehalten der Polizisten gegenüber dem jungen Migranten Mahmud oder den aus der Luft gegriffenen Vergewaltigungsvorwürfen des Mädchens gegenüber dem Lehrer. Ist es dir als Schauspieler generell wichtig, an Projekten mitzuwirken, die gesellschaftsrelevante Themen behandeln?
Aaron:
Klar, darum geht’s doch! Ich will nicht sterben, ohne dass ich auf dieser Welt irgendetwas verändert oder hinterlassen habe, ohne dass ich irgendetwas Sinnvolles gemacht habe. Für mich geht es bei der Schauspielerei darum, Missstände aufzudecken und gewissen Problemen eine Bühne zu geben. Daher war es für mich auch eine riesige Ehre, einen Charakter wie Johnny spielen zu dürfen – eine Figur, die einen berührt und in gewisser Weise auch schockt. Wenn man sich mit einer solchen Rolle befasst, erweitert man die eigene Toleranz. Aber man fragt sich auch: Was gibt es nur alles auf dieser Welt?
Ich weiß, dass ich noch lange nicht in der Lage bin, mir aussuchen zu können, was ich machen will und was nicht. Aber wenn mich ein Drehbuch nicht interessiert oder ich mir absolut nicht vorstellen kann, bei einem Projekt mitzuwirken, dann sage ich ab. Es gibt gewisse Formate, die so inhaltslos sind, dass ich das einfach nicht machen kann. Man will mit seiner Arbeit ja auch etwas verändern, etwas anstoßen, die Leute dazu bringen, über etwas nachzudenken. Wenn die Rolle – oder das gesamte Projekt – das nicht hergibt, dann ist es für mich sinnlos, da mitzumachen. So etwas gibt es ja auch schon zur Genüge. Man muss nur mal am frühen Nachmittag den Fernseher anschalten – was da so läuft: Halleluja!
Jonas:
Oder freitagabends, wenn auf Tele5 die „SchleFaZ“ laufen.
Aaron:
Wie bitte?
Jonas:
Die „SchleFaZ“ – die schlechtesten Filme aller Zeiten. Der Sender Tele5 hat daraus ein Format gemacht: Jeden Freitagabend präsentieren Oliver Kalkofe und Peter Rütten die schlechtesten Filme, die ihnen in die Hände geraten sind, und kommentieren sie fortlaufend. Da willst du als Schauspieler nicht landen.
Aaron (grinst):
Wieso? Gerade das wäre doch wieder witzig.
Jonas:
Durch die Filme, in denen du mitspielst, lernt man immer wieder außergewöhnliche Vornamen kennen: Johnny, Stipe oder Kamelle – so heißt deine Rolle in Max Zähles Film „Schrotten!“ aus dem Jahr 2016. Alles Underdogs. Es scheint, als hättest du einen leichten Hang zu diesen sehr speziellen Charakteren.
Aaron:
Ja, für mich ist es auch ein riesiges Glück, dass ich immer wieder solche Extreme spielen darf. Ich liebe Extreme, im Film wie im echten Leben.
Jonas:
Und wo suchst du Extreme im echten Leben?
Aaron:
Beim Feiern! Da geht die eine oder andere Nacht schonmal bis zum nächsten Morgen. Ansonsten beim Sport. Ich mache zwar nicht wahnsinnig viel Sport, aber wenn ich etwas tue, dann spüre ich eine übertriebene Energie in mir, die plötzlich da ist und die mich über meine Grenzen hinausträgt.
Wenn kein Baum in der Nähe war, haben wir unsere Kletterausrüstung geholt und uns an den Balkonen abgeseilt.
Jonas:
Auf YouTube findet man einige Videos, die zeigen, wie Du bereits als kleines Kind vor er Kamera gestanden hast. Wie bist du in so jungen Jahren zur Schauspielerei gekommen?
Aaron:
Da sind wir wieder bei den Extremen: Mein Bruder und ich sind immer auf jeden Baum geklettert, den wir finden konnten. Und wenn kein Baum in der Nähe war, haben wir unsere Kletterausrüstung geholt und uns an unserem Haus an den Balkonen abgeseilt. Einer unserer Nachbarn ist ein erfahrener Kletterer, er hat uns einiges beigebracht.
Dieser Nachbar hat damals bei dem Musical „Tarzan“ als Techniker gearbeitet. Eines Tages meinte er zu mir: „Klettere doch mal bei Tarzan!“ Also bin ich zum Casting gegangen, habe eine nach der anderen Runde absolviert und war irgendwann tatsächlich Tarzan – da muss ich so um die elf, zwölf Jahre alt gewesen sein. Bevor ich aber beim Musical mitmachen durfte, musste ich ein halbes Jahr lang unter der Woche Tanz-, Gesang- und Schauspieltraining nehmen. Erst dann habe ich in den Shows den Tarzan spielen dürfen – ebenfalls ein halbes Jahr lang, bis ich rausgeflogen bin.
Jonas:
Was war passiert?
Aaron:
Ich habe ein einziges Mal meinen Einsatz verpasst und wurde deshalb rausgekickt. Meine Mutter hat zwar noch für eine Derniere, eine letzte Vorstellung, gekämpft, aber danach war’s das. Auch wenn ich nicht mehr in „Tarzan“ mitspielen konnte, war von da an ziemlich klar, dass ich irgendetwas brauche, was mich auslastet. Schule allein hat mir scheinbar nicht gereicht, ich musste mich zusätzlich irgendwo auspowern.
Gott sei Dank kam es kurze Zeit nach „Tarzan“ zu einem weiteren Zufall: Die Ex-Freundin meines Onkel arbeitet als Produzentin an der HMS, der Hamburg Media School. Sie und ihre Kollegen haben Anfang 2012 einen jungen Darsteller für den Zehnminüter „Cowboy & Indianer“ von Jan-Gerrit Seyler gesucht. Jan ist bis heute einer meiner engsten Freunde – für mich ist er Vater, Bruder und Freund in einer Person. Demnächst werde ich sogar Patenonkel seines Kindes! Ihm habe ich so wahnsinnig viel zu verdanken…
Und dann ging’s irgendwie los. Zuerst hatte ich nur irgendwelche Minirollen, bei denen es kaum etwas zu spielen gab – beispielsweise bei der Kinderserie „Die Pfefferkörner“, bei der ich in zwei, drei kleinen Szenen mitspielen durfte. Komparse mit Text sozusagen. Seit etwa drei Jahren kann ich endlich auch größere Rollen übernehmen und damit die Filme ein Stück weit mitgestalten.
Jonas:
Die Fernsehserie „Die Pfefferkörner“ gibt es seit fast 20 Jahren und wirkt wie Durchlauferhitzer: Etliche deutsche Jungschauspielerinnen und Jungschauspieler haben dort ihre Karrieren gestartet.
Aaron (grinst):
Stimmt, „Die Pfefferkörner“ macht irgendwie jeder.
Jonas:
Was kann man dort lernen?
Aaron:
Schauspielerisch kann man da nicht so viel mitnehmen. Aber man lernt die technischen Abläufe beim Film. Und mir persönlich haben „Die Pfefferkörner“ etwas mitgegeben, was mir heute noch hilft: Diese erste Fernseherfahrung hat mir einen Teil der Aufregung vor der Kamera genommen. Von da an war alles, was an einem Set passiert, etwas gewohnter für mich.
Jonas:
Spielt Aufregung für dich überhaupt noch eine Rolle? Du wirkst sehr abgeklärt, sowohl im Film als auch gerade jetzt im persönlichen Gespräch.
Aaron:
Ich bin vor jedem neuen Projekt aufgeregt. Und ich finde, es ist auch gut, eine gesunde Aufregung zu spüren. Oder ist es eher Vorfreude? Ich weiß nicht.
Jonas:
A propos Aufregung: Ich bin auf ein Zitat des Protestforschers Simon Teune aus der Süddeutschen Zeitung gestoßen, das Du Mitte Juli – kurz nach dem G20-Gipfel in Hamburg – auf Facebook geteilt hast: „Das Konzept heißt: die Demonstration zulassen, ihr Raum geben, kleinere Verstöße ignorieren. Vor allem muss das Grundrecht der Versammlungsfreiheit gewährleistet werden. Wenn man versammlungsfeindlich agiert, verhärtet das die Fronten.“ Wie hast du diese Tage in deiner Heimatstadt Hamburg erlebt? Und welchen Blick hast du heute darauf?
Ich verstehe ja, dass viele Menschen das Gefühl haben, nicht gehört zu werden, aber Gewalt ist das falsche Mittel. Immer!
Aaron:
Das ist sehr schwer zu sagen, die gesamte G20-Zeit hatte zu viele Facetten. Auf der einen Seite gab es Menschen, die der Meinung waren, sie würden irgendetwas ändern, wenn sie Hamburg zerstören würden. Auf der anderen Seite konnte man wunderschöne Aktionen erleben – Proteste, die mehr eine Feier waren und bei denen die Kreativität im Vordergrund stand.
Mein Fazit daher, gerade auch zu den Gewaltausbrüchen, die es auf beiden Seiten gab, sprich bei den Demonstranten wie bei der Polizei: ein absoluter Wahnsinn! In Hamburg Krieg zu spielen, während man eigentlich für Frieden und Veränderung demonstrieren will, kann man nur als absoluten Wahnsinn beschreiben. Was soll das? Wir leben doch in einem Land, in dem man offen seine Meinung sagen kann. Ich verstehe ja, dass viele Menschen das Gefühl haben, nicht gehört zu werden, aber Gewalt ist das falsche Mittel. Immer! Wenn Leute durch Hamburg ziehen und Kleinwagen anzünden, muss man sich wirklich fragen: Leute, habt ihr eigentlich irgendwas verstanden in eurem Leben? Was ist los bei euch?
In vielem, was ich in dieser Zeit erlebt habe, habe ich absolut keinen Sinn gesehen. Vor allem weil einige Leute einfach nur Spaß daran hatten, für ein paar Stunden oder Tage ein wenig Anarchie zu zelebrieren – um danach wieder in ihr altes, normales und langweiliges Leben zurückzugehen, als wäre nichts gewesen. Zuerst ziehen sie schwarze, angsteinflößende Klamotten über und ziehen randalierend durch die Straßen. Danach laufen sie um die Ecke, ziehen die Sachen in irgendeinem Hinterhof wieder aus und werfen sie in die Mülltonne. Und plötzlich sind sie wieder die Ottos von nebenan, denen es eigentlich wunderbar geht in ihrem Leben.
Jonas:
Es soll ja Leute geben, die der jungen Generation vorwerfen, politisch eher desinteressiert zu sein. Empfindest du dich selbst eher als eine Ausnahme? Wie erlebst du die Thematisierung von Politik im Klassenzimmer, in deinem Freundeskreis?
Aaron:
Nein, ich bin keine Ausnahme. Es ist nicht so, dass wir nur konsumieren und konsumieren und konsumieren, ohne zu wissen, was hier und auf der Welt abgeht. Ganz im Gegenteil. Ich erlebe, dass alle um mich herum starke politische Meinungen haben und Position beziehen. Mein Freundeskreis ist sehr heterogen, dementsprechend ist auch die Art und Weise, wie sich meine Freunde politisch äußern, sehr unterschiedlich. Manche drücken beispielsweise ihre Meinung über Rap aus. Es ist ihre ganz eigene Art, um zu beklagen, wie ungerecht vieles ist, dass die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer werden. Das ist ein großes Thema bei uns.
Jonas:
Bei der Bundestagswahl in diesem Jahr wirst du zum ersten Mal in deinem Leben wählen. Wie geht es dir damit?
Wenn die Leute einmal die Chance haben, durch ihre Stimme wirklich Einfluss zu nehmen, nehmen sie sie nicht wahr.
Aaron:
Ich fühle mich verpflichtet, wählen zu gehen. Ich finde es immer albern, wenn Menschen darüber meckern, dass die Politik angeblich eh nichts verändert, und sie deshalb auch nicht wählen gehen. Das ist doch grotesk: Sie beschweren sich, dass sie nicht beteiligt werden und man alles über ihre Köpfe hinweg bestimmt. Aber wenn sie einmal die Chance haben, durch ihre Stimme wirklich Einfluss zu nehmen, nehmen sie sie nicht wahr. Mein Gott, springt doch einfach mal über euren Schatten – und informiert euch vor allem! Klickt euch wenigstens mal durch den Wahl-o-mat, wenn ihr keine Orientierung habt! Ist doch eigentlich eine ganz gute Idee.
Jonas:
Orientierung – ein gutes Stichwort. Was gibt dir in deinem Leben Orientierung? Wer hilft dir, deinen Kompass auszurichten?
Aaron:
Meine Mutter – indem sie mich immer unterstützt in dem, was ich tue. Und indem sie mir Freiraum gibt. Sie akzeptiert alle Entscheidungen, die ich fälle. „Mach, was du willst.“ – das ist letztendlich auch eine Richtung. Bei meinem Vater ist das ähnlich, den sehe ich nur nicht so oft. Darüber hinaus gibt mir mein Bruder viel: Von ihm lerne ich, was teilen heißt. Und was es heißt, den Rücken gerade zu machen. Das lerne ich von ihm auf eine sehr besondere Art.
Natürlich lerne ich auch von meinen Freunden, das ist ein ständiges Geben und Nehmen. Und ich selbst gebe mir oft auch eine Richtung. Ich bin für vieles offen und probiere vieles aus. Und dabei finde ich mich – erfinde ich mich – immer wieder neu.
Jonas:
Du hast eben angesprochen, dass du Rainer Bock sehr bewunderst. Was kannst du von ihm lernen?
Aaron:
Generell fällt es mir eher schwer, die Frage zu beantworten, was ich schauspielerisch von jemandem lernen kann. Für mich gibt keine bestimmte Technik, ich tue einfach, was ich tue. Daher kann ich auch bei Rainer nicht genau sagen, was ich von ihm lernen kann.
Ich kann aber sagen, was ich an ihm mag: Rainer ist wahnsinnig fein – menschlich und in seinem Spiel. Er hat eine äußerst warme, liebevolle Ausstrahlung, die er auf seine Rollen überträgt, was wiederum sein Spiel sehr klar und spannend macht. Wie gesagt: Ich weiß nicht genau, was ich von ihm lernen kann. Aber ich schaue ihm sehr gerne zu.
Jonas:
Das ist wahrscheinlich das schönste Kompliment, das man einem Schauspieler machen kann.
Aaron (lächelt):
So war es auch gedacht.
Jonas:
Spannend zu spielen wird umso wichtiger, wenn es einen als Schauspieler in die unspannendsten und trostlosesten Gegenden verschlägt – beispielsweise auf einen entlegenen Schrottplatz in der nordwestdeutschen Provinz: Die Dreharbeiten zu „Schrotten!“ haben dich in eine Welt geworfen, die für viele absolut langweilig und nicht beachtenswert ist: irgendwo draußen auf dem Land, mitten in der Einöde, fernab vom Schuss – das Gegenteil von Hamburg sozusagen. Wie hast du diese Welt wahrgenommen?
In der Provinz sieht man immer nur dieselben Leute, abends kann man nicht um die Häuser ziehen, alles ist sehr eintönig.
Aaron:
Ich bin ganz ehrlich: Vor dem Film habe ich immer nur das Negative an der Provinz gesehen. Wir haben in der Nähe einer Kleinstadt gedreht, in der nicht nur im Film nichts los war. Dort sieht man immer nur dieselben Leute, abends kann man nicht um die Häuser ziehen, alles ist sehr eintönig. Aber während der Dreharbeiten habe ich gemerkt, dass es darum gar nicht geht – sondern um Gemeinschaft. Und um Kleinigkeiten, etwa wenn sich jemand ein neues Auto kauft und sich die gesamte Nachbarschaft für ihn freut.
Ich habe das Gefühl, dass die Menschen in einer solchen Gegend viel mehr von dem mitbekommen, was um sie herum passiert. Und dass sie die kleinen Dinge viel stärker wahrnehmen als die Leute, die in einer Großstadt wie Hamburg leben. Hier wird man ständig von allen Seiten mit Input beballert, die kleinen Dinge gehen viel zu schnell unter. Aber gerade um die geht es doch im Leben, oder?
Aaron Hilmer ist 18 Jahre alt, Schauspieler und lebt in Hamburg.
Max Löffler
Submission — Max Löffler
Eksta...was?
6. Oktober 2017 — MYP N° 21 »Ekstase« — Illustration und Text: Max Löffler
Bin ich in meinem Leben schon einmal in Ekstase geraten? Also so richtig? Weiß ich überhaupt, was Ekstase ist? Ohne vorher die Bedeutung googeln zu müssen? Ob schon mal jemand Ekstase gegoogelt hat, während er oder sie in Ekstase war?
Weiß nicht.
Hat das was mit diesem Ecstasy zu tun? Heißt ähnlich, fühlt sich vielleicht auch ähnlich an? Oder ist das diese ominöse gute Zeit, die man immer haben muss, um Fotos davon auf Instagram hochladen zu können? Gibt es einen total nicht-ekstatischen Instagram-Account, auf dem niemand lacht? Würde ich folgen?
Weiß nicht.
Ist Ekstase dieser kleine flüchtige Moment, in dem für den Bruchteil einer Sekunde etwas Goldenes durch die Risse blitzt, und man erahnt dass es da einen unendlichen Frieden gibt, etwas das größer ist als unser welkes Fleisch – irgendwo – und man ist kurz ein Teil des bunten Treibens?
Weiß nicht.
Ist Ekstase überhaupt erstrebenswert? Wäre es nicht wünschenswert, öfter ein ekstatisches Hochgefühl zu erleben? Impliziert das unbedingte Streben nach diesem Hochgefühl, nach endlosem Spaß, ein momentan nicht so geiles Leben? Flüchtet man dann vor diesem Leben?
Weiß nicht.
Ach Ekstase, altes Haus, weiß nicht, ob ich zu dir fähig bin.
Ich hab‘ aber auch niedrigen Blutdruck. Und bin oft müde und schlecht gelaunt.
Vielleicht liegt’s daran.
Max Löffler ist 28 Jahre alt, lebt in Aschaffenburg und arbeitet als freiberuflicher Illustrator und Grafikdesigner.
www.maxloeffler.com
www.behance.net/maxloeffler
@haxloeffler