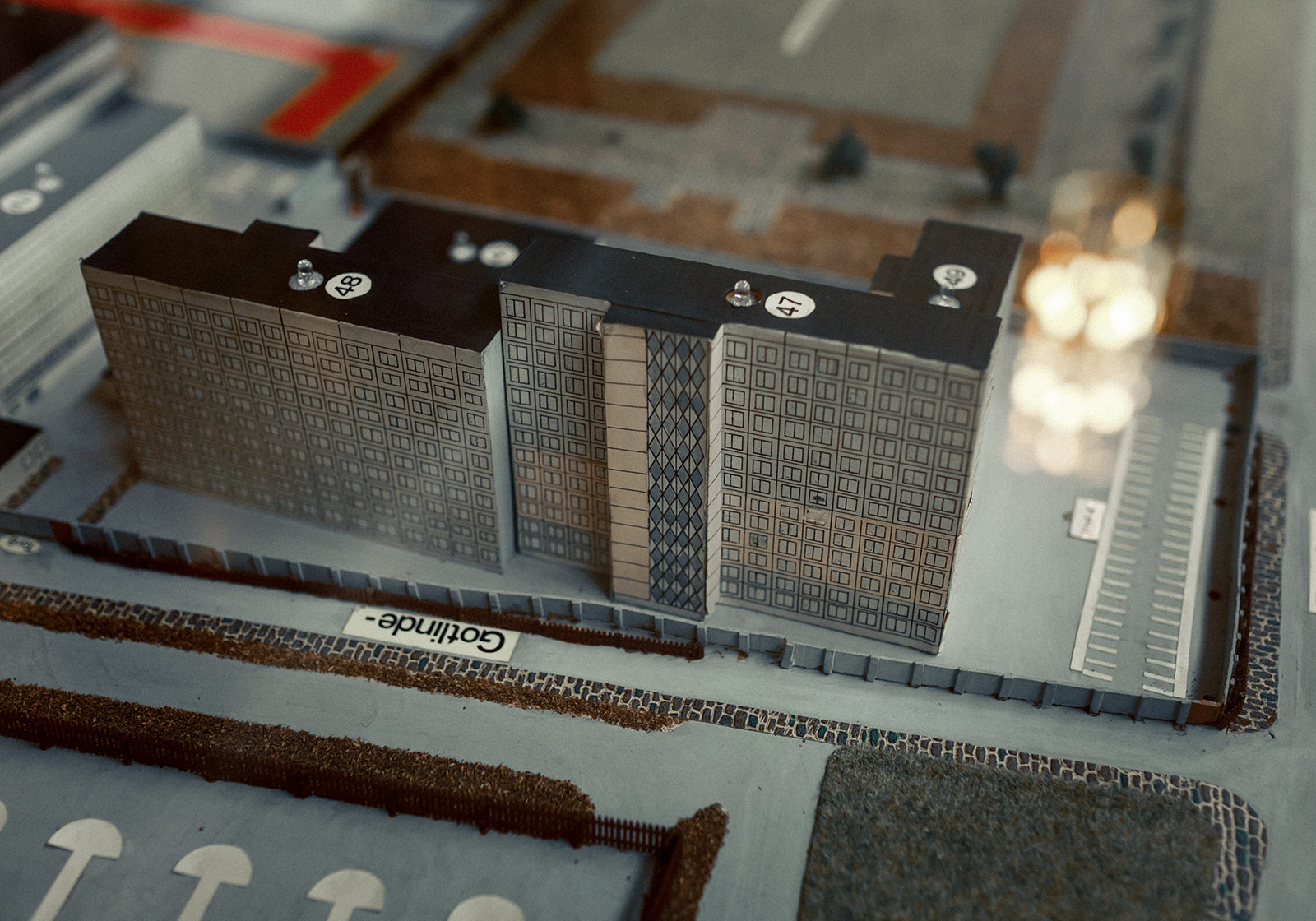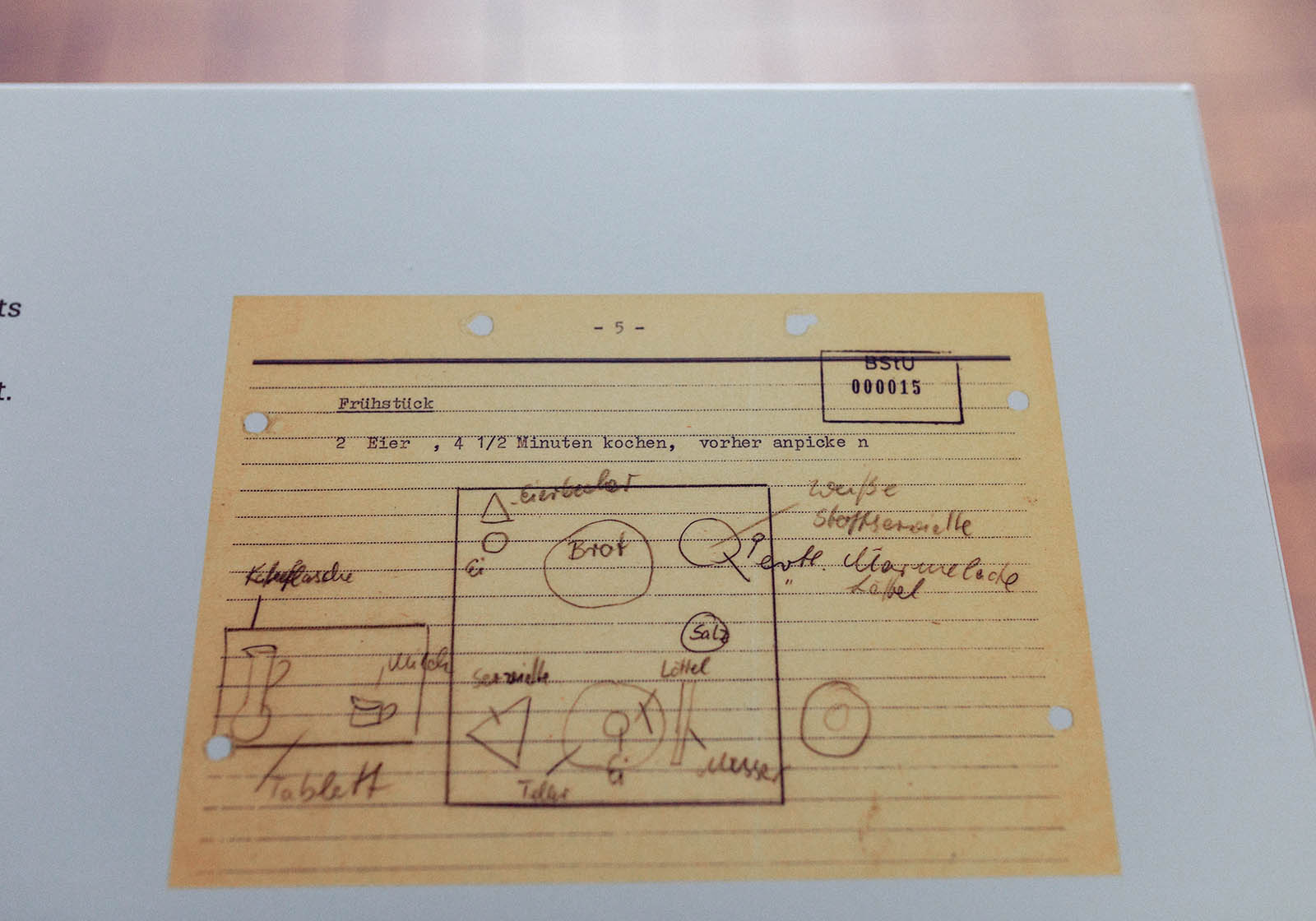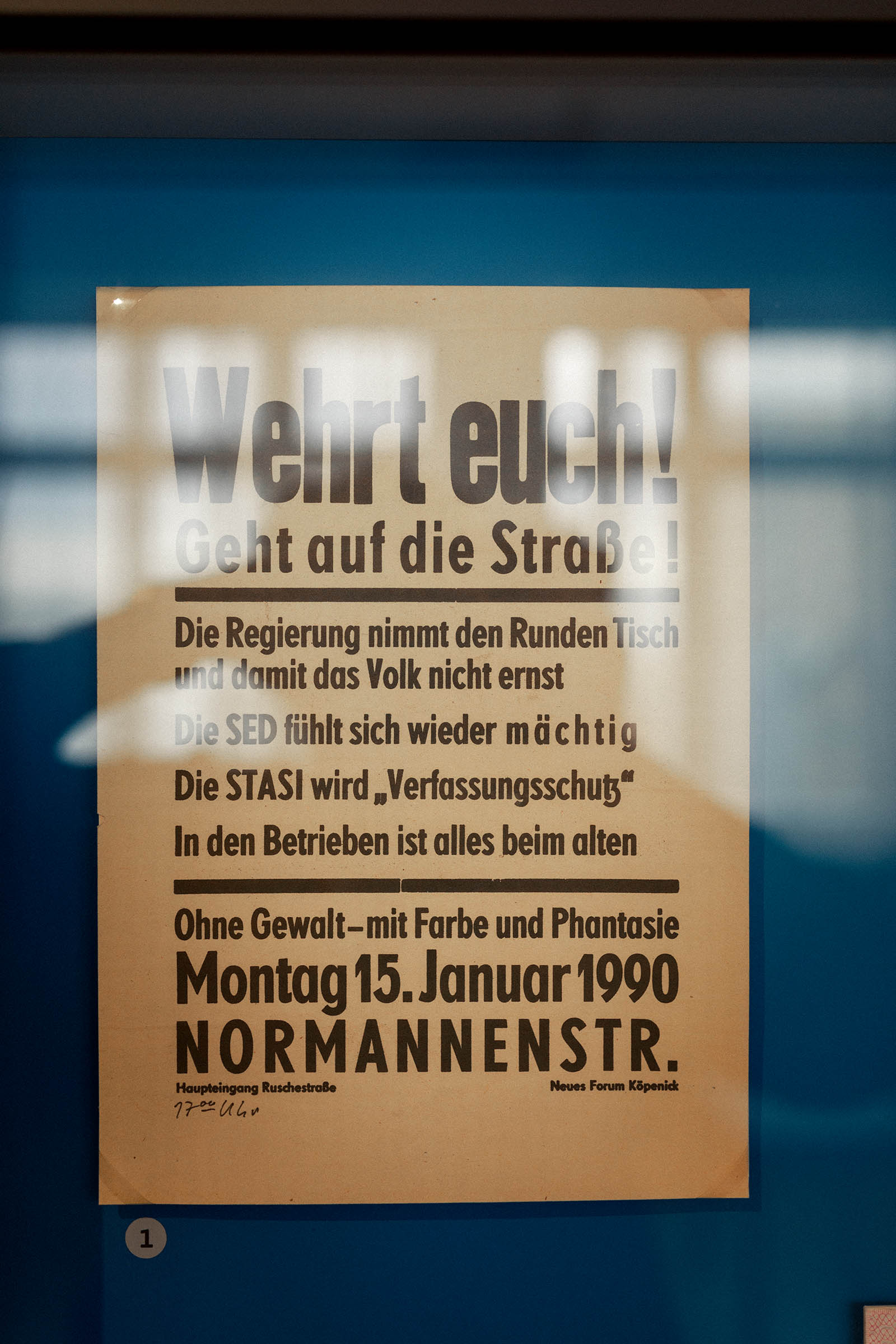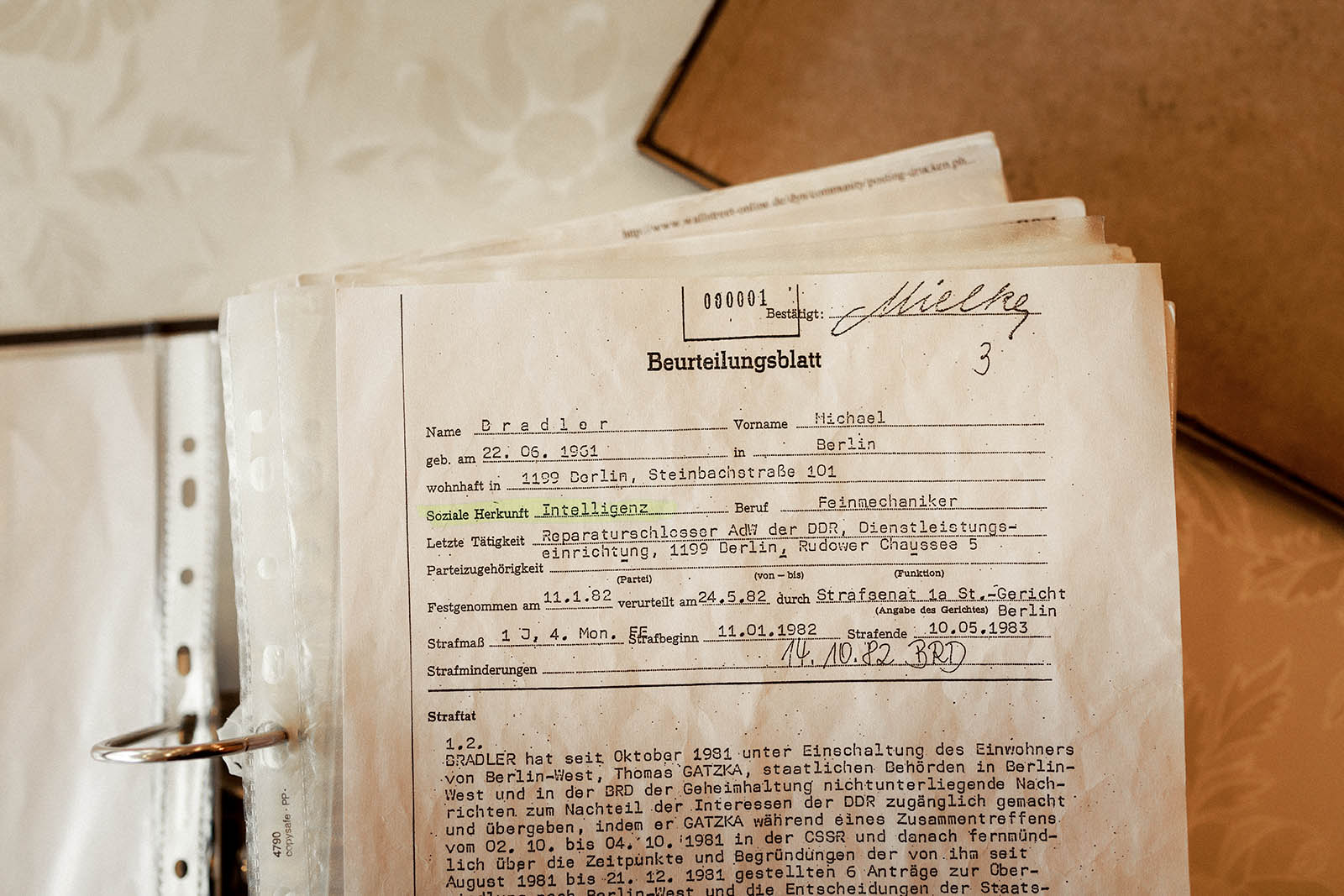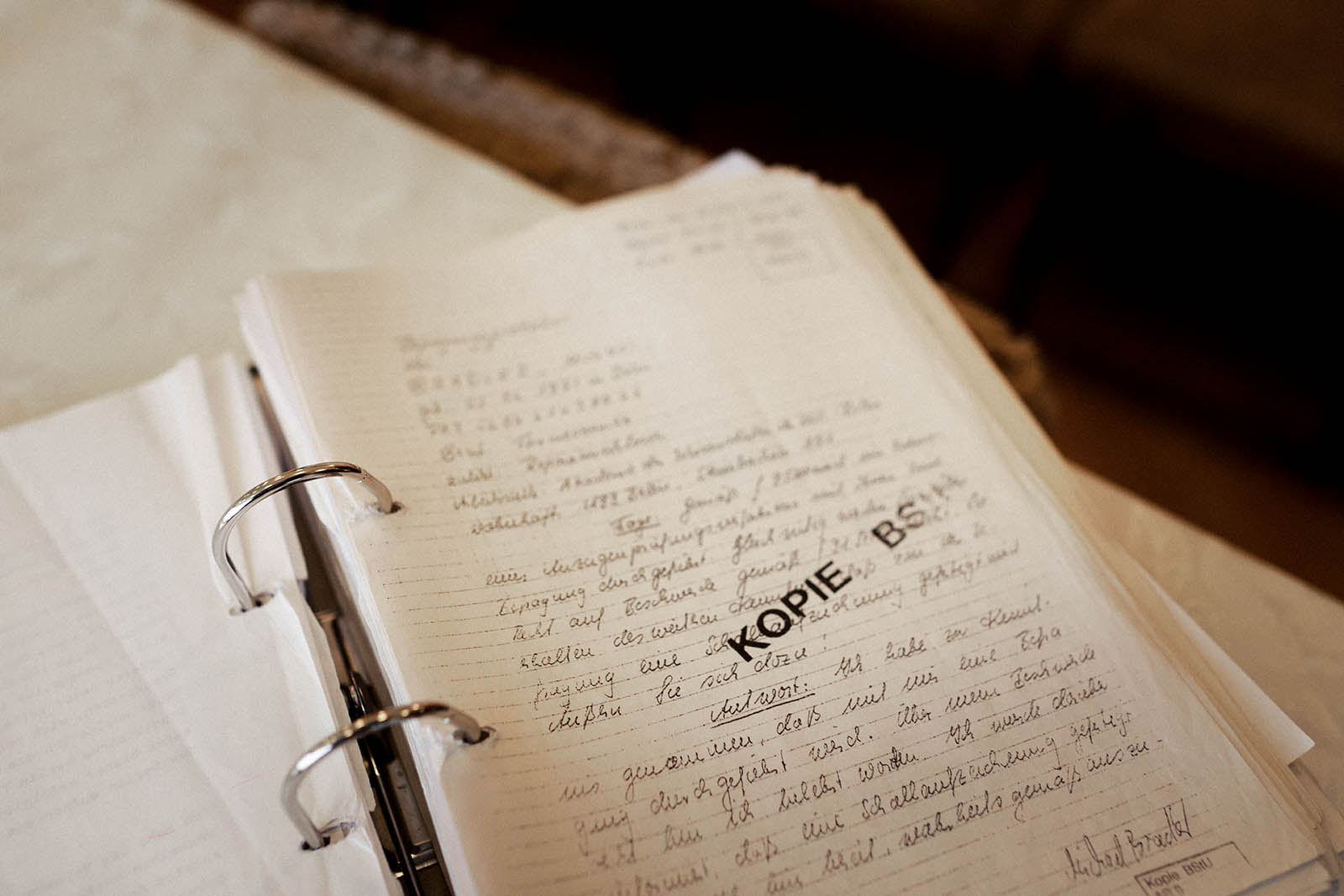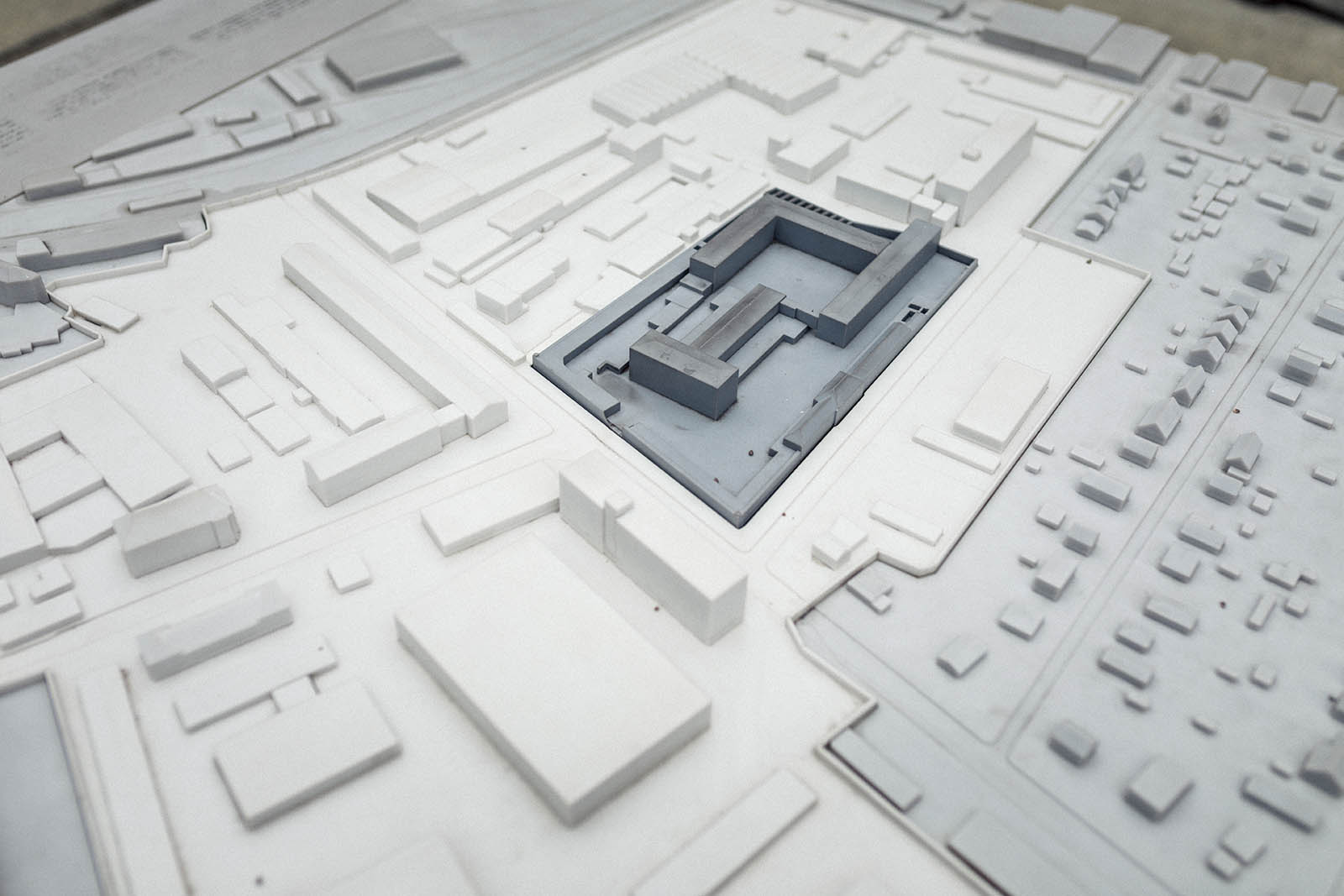Florian Prokop
Interview — Florian Prokop
Online mit Haltung
Florian Prokop bezeichnet sich selbst als Journalencer und richtet sich mit seinen Themen auf Snapchat & Co. gezielt an die Generation Smartphone. Warum es dem überzeugten Europäer dabei nicht nur auf die journalistische Qualität ankommt, sondern auch auf die persönliche Haltung, verrät er uns im ausführlichen Interview.
25. Februar 2018 — MYP N° 22 »Widerstand« — Interview: Jonas Meyer, Fotos: Maximilian König
1988, was war das für ein Jahr! Steffi Graf schrieb mit vier Grand Slam-Siegen Tennisgeschichte, Loriot brachte „Ödipussi“ in die Kinos und Nokia hatte gerade sein allererstes Mobiltelefon vorgestellt. Außerdem führte die Deutsche Börse den Leitindex DAX ein, Tele5 ergänzte als dritter Privatsender die Fernsehlandschaft und „Morris“ wütete als erster Computerwurm im Internet. Und während man in West-Berlin mit der „transmediale“ ein Festival für Medienkunst und digitale Kultur gründete, spielte Bruce Springsteen in Ost-Berlin das größte Konzert, das die DDR jemals erlebt hatte.
Ja, die DDR. Dort war immer noch ein Mann namens Erich Honecker an der Macht. Und auch wenn man aus der Sowjetunion bereits Begriffe wie Glasnost und Perestroika hören konnte, hätte 1988 niemand nur zu träumen gewagt, dass schon ein Jahr später die Mauer fallen würde. Und dass nach drei weiteren Jahren ein wiedervereinigtes Deutschland die Europäische Union mitbegründen würde – mit dem Vertrag von Maastricht.
1988, das war auch das Jahr, in dem im brandenburgischen Cottbus ein gewisser Florian Prokop zur Welt kam, der sich heute, knapp 30 Jahre später, am liebsten auf digitalen Plattformen herumtreibt, die Snapchat, Instagram oder YouTube heißen. Allerdings nicht, um oberkörperfrei irgendwelche Produkte anzupreisen: Florian ist freiberuflicher Redakteur, Reporter und Moderator, unter anderem für Funk, ein Content-Netzwerk von ARD und ZDF für die sogenannte junge Zielgruppe. Darüber hinaus arbeitet er für den RBB-Jugendsender Radio Fritz sowie für ze.tt, eine journalistische Online-Plattform des ZEIT Verlag. Und als wäre das nicht genug, dreht er seit neuestem auch noch Webvideos zu netzpolitischen Themen für den YouTube-Kanal about:blank.
Vor etwa einem Jahr ist Florian Prokop quer durch Europa gereist, um die Einstellung junger Europäer gegenüber der EU zu ergründen und darüber Smartphone-gerecht auf Snapchat zu berichten. Wir haben uns mit ihm im Europäischen Haus Berlin verabredet, das nur wenige Schritte vom Brandenburger Tor entfernt ist. Seit knapp zwei Jahren wird hier „ERLEBNIS EUROPA“ gezeigt – eine multimediale Dauerausstellung, die auf Initiative des Europäischen Parlaments und in Zusammenarbeit mit der Europäischen Kommission ins Leben gerufen wurde.
Die Website der Ausstellung verspricht, dass man vor Ort „ganz neu“ erleben kann, wie europäische Politik gestaltet wird und wie man selbst aktiv werden kann – „und das in 24 europäischen Sprachen!“ Weiter heißt es: „Einen Gruß aus Europa können Sie auch mitnehmen: Schicken Sie Ihr ganz persönliches Foto aus dem ERLEBNIS EUROPA an Ihre Familie und Freunde!“ Das nehmen wir gerne wörtlich – nur dass es bei uns am Ende ein paar Fotos mehr werden.
Jonas:
Du bezeichnest dich auf deinem Instagram-Account als Defluencer. Was genau kann man sich darunter vorstellen?
Florian:
Den Begriff habe irgendwo mal aufgeschnappt und fand ihn lustig. Davon abgesehen passt er aber auch ganz gut zu mir: Defluencer ist das Gegenteil von Influencer – und ein Influencer, der für irgendetwas Werbung macht, bin ich definitiv nicht. Ich halte keine Produkte in die Kamera, das fände ich schon sehr doof.
Grundsätzlich habe ich aber vor dem Begriff Influencer keine Angst, weil Influencer sein auch bedeuten kann, dass man es schafft, Leuten bestimmte Themen näherzubringen, die einen selbst interessieren. Wenn man es aus dieser Perspektive betrachtet, ist es ok für mich, als Influencer bezeichnet zu werden. Vielleicht habe ich genau wegen dieser Ambivalenz auch den Begriff Defluencer übernommen.
Viel passender für mich finde ich mittlerweile das Wort Journalencer – ein Begriff, der mir mal während einer U-Bahnfahrt eingefallen ist und sozusagen eine Mischung aus Journalist und Influencer ist. Für die Arbeit, die ich mache, finde ich diesen Begriff ziemlich passend: Ich arbeite journalistisch und kann meine Themen jungen Menschen näherbringen – sie „influencen“, wenn man so will. Gleichzeitig ist dabei nicht alles im seriösen Tagesschau-Ton gehalten.
Jonas:
Für deine Formate auf Snapchat und Instagram filmst und fotografierst du dich permanent selbst. Bist du daher nicht vielmehr so etwas wie ein Online-Darsteller oder Schauspieler als ein klassischer Journalist?
Florian:
Schauspieler war ich früher einmal, das ist schon einige Jahre her. Was meine Arbeit heute angeht, würde ich sagen, dass sie tatsächlich eine journalistische ist, da mein Job viele unterschiedliche journalistische Tätigkeiten beinhaltet: Für meine Storys, die ich auf Instagram und Snapchat veröffentliche, muss ich Quellen checken und Skripte schreiben. Egal, ob ich bei ze.tt an einer Story arbeite oder bei Radio Fritz meine Sendung vorbereite: Klassisches Journalistenhandwerk ist immer Grundlage dessen, was ich tue.
Allerdings fällt es mir schwer, mich auch tatsächlich als Journalist zu bezeichnen – genauso wie es mir übrigens damals schwergefallen ist zu behaupten, dass ich Schauspieler bin. Beides sind einfach sehr bedeutende Berufskonzepte, vor denen ich Demut habe. Daher sage ich grundsätzlich, dass ich Reporter, Redakteur und Moderator bin. Ich finde, dass diese drei Begriffe sehr konkret sind. Und ganz nebenbei kann ich damit vermeiden, das Wort Journalist in den Mund zu nehmen.
Jonas:
Fällt es dir vielleicht auch deshalb schwer, dich als Journalist zu bezeichnen, weil du gelegentlich die Grenze zwischen Objektivität und Subjektivität überschreitest – etwa, wenn du in einer Story deine Entrüstung über gewisse gesellschaftspolitische Entwicklungen äußerst?
Florian:
Auch das. Wobei es ein meiner Meinung nach ein Irrglaube ist, dass Journalisten nicht auch ihre Meinung sagen dürfen.
»Meiner Meinung nach ist es ein Irrglaube, dass Journalisten nicht auch ihre Meinung sagen dürfen.«
Jonas:
Das heißt, wenn du in einer Story beispielsweise deine Meinung zu bestimmten Äußerungen von AfD-Chef Alexander Gauland zum Ausdruck bringst, fällt das noch in den Bereich des Journalismus?
Florian:
Natürlich läuft man bei solchen Themen Gefahr, sich an der Grenze zwischen Journalismus und Aktivismus zu bewegen. Dennoch würde ich grundsätzlich und in Bezug auf meine tägliche Arbeit sagen, dass ich ein objektiv arbeitender Journalist bin – und jetzt nenne ich mich mal tatsächlich so -, der zwar stellenweise seine eigene Meinung ausdrückt, aber dies auch immer kenntlich macht.
Jonas:
Vor ziemlich genau zehn Jahren, in der Nacht vom 28. Februar auf den 1. März 2008, wurde die deutschsprachige Version von Facebook gelauncht. Damals warst du 19 Jahre alt und hast hauptsächlich als Schauspieler gearbeitet. Hättest du dir in dieser Zeit vorstellen können, dass Soziale Netzwerke mal deinen Beruf formen und definieren würden?
Florian:
Nein, im Jahr 2008 war für mich noch völlig klar, dass ich Schauspieler sein will und irgendwann auch mal sein werde. Ich wusste auch nichts anderes. Es heißt ja immer, dass man – wenn man Schauspieler werden will – nichts anderes tun wollen dürfe als Schauspielerei, ansonsten werde es nichts mit dem Beruf. Im Jahr 2008 sah es in dieser Hinsicht für mich noch ganz gut aus, auch weil wenig später die Dreharbeiten für eine TV-Serie starteten, bei der ich zwei Jahre lang mitgespielt habe.
Jonas:
Anfang 2011 veröffentlichte die Zeitung „Die Welt“ eine Werbekampagne, die sich „Rastloser Planet“ nannte. Auf den Plakaten waren unterschiedlichste Begriffe zu Wortgruppen zusammengefasst, beispielsweise „Afghanistan. Superstar. Fashion Week. I Like.“ oder „Griechenland. Yoga. Mindestlohn. Dschungel.“ Für mich macht diese Kampagne immer noch deutlich, wie sehr sich unser Mediennutzungsverhalten innerhalb nur weniger Jahre verändert hat. Ende der 90er brauchte man noch ein Modem, um online zu gehen, und das Fernsehen fand ausschließlich linear statt – in einer überschaubaren Zahl von Sendern. Informationen und Nachrichten wurden eher sukzessive und hierarchisiert konsumiert: eine nach der anderen und das Wichtigste zuerst. Die Welt-Kampagne dagegen beschreibt den Ist-Zustand von heute: Wir alle sind permanent mit einer so großen Flut an Informationen konfrontiert, dass es uns immer weniger gelingt, sie nach Inhalt und Bedeutung zu ordnen. Und dadurch kann es letztendlich passieren, dass der Krieg in Afghanistan den gleichen Informationswert hat wie die letzte Sendung von „Deutschland sucht den Superstar“. Wie hast du selbst diese Entwicklung der letzten zehn, fünfzehn Jahre wahrgenommen?
Florian:
Was da passiert ist und immer noch passiert, ist natürlich eine Veränderung. Ich könnte mir heute zum Beispiel gar nicht mehr vorstellen, wie es ohne Facebook und Smartphone war. Und genauso schwer fällt es mir auch, mich daran zu erinnern, wie ich früher Nachrichten konsumiert habe – wahrscheinlich ganz einfach über die Tagesschau im Fernsehen. Insgesamt war mein Medienkonsumverhalten eher passiv. Heute hat sich das total gedreht: Ich schaue kein klassisches Fernsehen mehr und ich recherchiere die Themen selbst, die mich interessieren.
Ein Problem in Bezug auf die Gleichzeitigkeit von Informationen sehe ich dagegen nicht. Eher eines der inhaltlichen Hierarchisierung: Facebook sagt uns heute, was am wichtigsten ist. Wenn wir gerne süße Hundevideos liken, ist das die Information Nummer eins. Die Ablenkungs- und Desinformationsmöglichkeiten sind riesig.
»Facebook sagt uns heute, was am wichtigsten ist. Wenn wir gerne süße Hundevideos liken, ist das die Information Nummer eins. Die Ablenkungs- und Desinformations-Möglichkeiten sind riesig.«
Jonas:
Dennoch gibt es nicht wenige Menschen, die sich eine Zeit zurückwünschen, in der nicht alles gleichzeitig stattfand. In der es nicht diese ungeheure Geschwindigkeit wie heute gab, in der die Welt übersichtlicher war, in der man nicht so stark mit der Angst konfrontiert war, nicht mehr mithalten zu können mit der technologischen und gesellschaftlichen Entwicklung. Welche positiven Seiten kannst du dieser fundamentalen Veränderung der letzten Jahre abgewinnen?
Florian:
Klar, man kann aktuelle Entwicklungen kritisieren. Einige Bedenken teile ich auch – etwa, wenn es um Bereiche wie den Datenschutz geht. Aber ich mag es auch sehr, dass ich heute die meisten Dinge einfach von unterwegs erledigen kann. Beispielsweise kann ich auf meinem Weg morgens zu den Fritz-Studios in Potsdam 45 Minuten lang arbeiten oder Musik hören. Ich kann Mails schreiben, vorab mit der Redaktion erste Gedanken austauschen und mir dadurch den Tag verkürzen. Das hätte ich vor zehn Jahren mit meinem alten Nokia nicht gekonnt.
Jonas:
Man könnte dir jetzt unterstellen, dass du die permanente Gleichzeitigkeit von Informationen deshalb nicht als Problem siehst, weil du dich perfekt darin eingerichtet hast.
Florian:
Aus beruflicher Sicht kann ich sagen: Aktuelle Entwicklungen muss man nach Möglichkeit ohne jegliche Verzögerung erfahren, damit man auch möglichst aktuell berichten kann. Da kann es gar nicht schnell genug gehen. Aus meiner persönlichen Perspektive gesprochen glaube ich, dass man – jedenfalls zum größten Teil – immer noch selbst entscheiden kann, wie, wann und in welchem Ausmaß man Information zulässt… oder ich merke einfach nicht, was für ein Smartphone-Opfer ich bin.
Jonas:
Du hast eben die altehrwürdige Nachrichtensendung Tagesschau angesprochen. Spielen solche Formate überhaupt noch eine Rolle in deinem Leben? Wie informierst du dich konkret über relevante Themen und Entwicklungen?
Florian:
Mein Job verlangt von mir, dass ich mich permanent auf dem Laufenden halte. Ich muss ständig überlegen, was meine Zielgruppe interessieren und was für sie relevant sein könnte. Dementsprechend schaue, höre oder lese ich Nachrichten unter einem anderen Aspekt als vielleicht andere.
Bei mir klingelt morgens um fünf vor sieben der Wecker – genauer gesagt der Radiowecker. Dann höre ich nach ein paar Minuten Musik die ersten Nachrichten des Tages. Dabei kann ich bereits überlegen, ob es ein mögliches Thema des Tages gibt, das ich aufgreifen kann.
Und was die Tagesschau angeht: Wenn ich Skripte schreibe oder Themen recherchiere, ist tatsächlich „tagesschau.de“ eine meiner ersten Anlaufstellen. Das, was dort steht, stimmt einfach.
»Ich weiß, was meine Follower interessiert, was sie gerne sehen und womit sie interagieren. Und das ist eben oft nicht die große Außenpolitik.«
Jonas:
Wie zielgruppengetrieben bist du überhaupt in deiner Arbeit? Ist Zielgruppenrelevanz tatsächlich alles? Oder gibt es Themen, bei denen du sagst: „Vielleicht schmeckt das meinen Zuschauern jetzt nicht, aber diese Thematik muss ich einfach mal aufgreifen“?
Florian:
Wenn ich zum Beispiel ein außenpolitisches Thema behandeln will, das mir persönlich wichtig ist, kann ich das tun. Auf der anderen Seite weiß ich aber, was meine Follower interessiert, was sie gerne sehen und womit sie interagieren. Und das ist eben oft nicht die große Außenpolitik, sondern sind ganz andere Themen. Darauf muss ich mich einstellen.
Dennoch weiß ich, dass das, was ich da tue, das Potenzial hat, etwas in meinen Followern auszulösen oder sie zum Nachdenken zu bewegen. Das ist total schön für mich. Ich kann ihnen durch meine Arbeit Nachrichten, Geschichten oder Fakten überbringen, die vielleicht ihr Weltbild verändern oder es – mit einem weniger bedeutenden Wort ausgedrückt – erweitern. Ich kann sie erfahren lassen, was sie interessiert. Aber wenn diese Relevanz nicht gegeben ist, gehen sie woanders hin.
Jonas:
Im Grunde genommen hast du gerade vier Jobs gleichzeitig: Du arbeitest bei „Funk“ als Redakteur, Reporter und Moderator, für „Radio Fritz“ bist du ebenfalls als Redakteur und Reporter tätig und daneben arbeitest du als Redakteur für „ze.tt“. Und seit neuestem drehst du noch Webvideos für den YouTube-Channel „about:blank“. Wie gelingt es dir, deinen Tag zu organisieren?
Florian:
Es gab im letzten Jahr regelmäßig Wochen, in denen ich nicht wusste, wie ich das alles auf die Reihe bekommen sollte. In solchen Wochen, die richtig vollgepackt sind mit Arbeit und in denen tausend Sachen auf einmal zu erledigen sind, kann ich relativ panisch werden.
Meistens wird es dann aber doch nicht so schlimm, wahrscheinlich weil es mir relativ gut gelingt, meine Zeit zu planen. Ich habe unzählige To-do-Listen – handgeschriebene und digitale. Ich schreibe jeden Furz auf, den ich noch zu erledigen habe.
»Grundsätzlich ist es mir erst mal egal, auf welcher Plattform die Infos ankommen, solange der Absender stimmt.«
Jonas:
Die Plattformen, für die du deine Inhalte produzierst – beispielsweise YouTube oder Snapchat -, sind nicht unbedingt dafür bekannt, dass dort klassisch-seriöse Nachrichtenformate veröffentlicht werden. Dennoch erleben wir, dass gerade eine ganze Generation heranzuwachsen scheint, die sich ausschließlich über solche Plattformen informiert. Eine Generation, der nicht nur altgediente TV-Formate wie „Tagesschau“ oder „heute-journal“ fremd sind, sondern die sich auch grundsätzlich nicht mit klassischen Nachrichten auseinandersetzt, wie sie etwa die Öffentlich-Rechtlichen auch online zur Verfügung stellen: Für Viele sind selbst reichweitenstarke Nachrichtenseiten wie „tagesschau.de“ oder „Spiegel online“ große Unbekannte. Dabei ist im Zeitalter alternativer Fakten unabhängiger Qualitätsjournalismus essenziell. Welchen Anspruch hast du an dich selbst, im Umfeld von YouTube und Snapchat eine gewisse journalistische Qualität abzuliefern?
Florian:
Grundsätzlich ist es mir erst mal egal, auf welcher Plattform die Infos ankommen, solange der Absender stimmt. Hinter dem Content, den ich produziere, stehen ja beispielsweise Namen wie „ZEIT online“ oder die Öffentlich-Rechtlichen in Form des RBB, bei denen es Mechanismen gibt, die die Qualität sichern.
Das, was ich tue, verstehe ich auch nicht als Ersatz für das, was man auf „tagesschau.de“ oder „Spiegel online“ finden kann. Es ist vielmehr eine Erweiterung dieses Angebots. Beispielswiese gab es bei uns zur vergangenen Bundestagswahl eine Themensetzung, die für die klassischen Nachrichtenplattformen viel zu niedrigschwellig gewesen wäre. Bei vielen unserer Follower mussten wir inhaltlich von ganz vorne anfangen und erklären, dass man zum Beispiel mit seiner Stimme die Bundeskanzlerin nicht nur wählen, sondern auch abwählen kann.
Wenn ich mit einem lustigen Ansatz Kinder oder Jugendliche irgendwie dazu bekommen kann, dass sie bei der nächsten Wahl die allgemeine Berichterstattung ein bisschen besser einordnen und verstehen können, dann ist das für mich ein großer Erfolg. Und das würde ich auch als meinen Anspruch formulieren. Ich glaube, dass ich für die junge Generation eine Art Schlüssel sein kann, durch den sie überhaupt mit solchen Themen in Berührung kommt.
Jonas:
Im Vorfeld der Bundestagswahl 2013 hat sich Angela Merkel zum ersten Mal von einem YouTuber interviewen lassen, bei der Wahl 2017 waren es gleich mehrere. Was hättest du die Bundeskanzlerin gefragt, wenn du selbst die Möglichkeit gehabt hättest?
Florian:
Ich glaube, ich hätte ihr Fragen zu Gleichberechtigungs- und Genderthemen gestellt – vor allem, weil sie bei der Abstimmung für die gleichgeschlechtliche Ehe Ende Juni 2017 mit Nein gestimmt hatte. Vielleicht hätte ich sie auch gefragt, wie ihre Vision für dieses Land aussieht.
»Ich hätte Angela Merkel Fragen zu Gleichberechtigungs- und Genderthemen gestellt. Und vielleicht hätte ich sie auch gefragt, wie ihre Vision für dieses Land aussieht.«
Jonas:
Wie erging es dir am 24. September 2017 um 18 Uhr, als klar war, dass mit der AfD eine rechtspopulistische Partei in den Deutschen Bundestag einziehen wird?
Florian:
Ich habe an diesem Tag gearbeitet, dementsprechend habe ich das Wahlergebnis rein berufsmäßig wahrgenommen und behandelt. Für hochkant haben wir damals von den Wahlpartys der einzelnen Parteien berichtet: Unsere erste Station war die SPD-Zentrale, in der wir um 18 Uhr miterlebt haben, wie die erste Prognose verkündet wurde.
Nachdem ich bei der SPD noch ein paar „free hugs“ verteilt und die Leute umarmt und getröstet hatte, sind wir zur FDP-Wahlparty gefahren. Egal wen man dort zum Wahlergebnis befragte, die Antworten waren immer die gleichen: So sehr sich die Leute über den Wiedereinzug ihrer Partei gefreut haben, so geschockt waren sie auch über das Ergebnis der AfD.
Zu deren Wahlparty sind wir auch noch gefahren: Die AfD feierte in einem Club am Alexanderplatz, zu dem uns und anderen Journalisten der Zutritt verwehrt wurde. Vor dem Gebäude hatten sich bereits hunderte Menschen zu Protesten versammelt und die Polizei war da, um die Situation zu sichern. Wir sind in der Menge hin und her geflitzt, haben Informationen gesammelt und dann über unsere Kanäle abgebildet, was wir dort erfahren und erlebt haben. Erst später habe ich für mich persönlich geschnallt, dass die Rechten mit knapp 13 Prozent in den Bundestag einziehen werden.
Jonas:
Hat es dir wenigstens etwas Mut gemacht zu sehen, dass sich so viele Menschen spontan vor der Wahlparty der AfD eingefunden haben, um ihren Protest auszudrücken?
Florian:
Da lag wirklich eine spannende Energie in der Luft, als sich die Leute bereits kurz nach der ersten Prognose am Alex versammelten, um ein Zeichen zu setzen. Was mir aber noch mehr Mut gemacht hat, war die Tatsache, dass uns in Deutschland genau das erspart blieb, was etwa in den Tagen nach der Trump-Wahl in den USA oder nach dem Brexit in Großbritannien passiert war. Da dachten nicht wenige Leute, dass sie jetzt die Sau rauslassen und überall im Land ihre rechten Parolen an die Wände schmieren können. So etwas gab es bei uns – so direkt nach der Wahl – zum Glück nicht, jedenfalls nicht in diesem Ausmaß. Das fand ich eher bemerkenswert, denn ich hatte mit Schlimmerem gerechnet.
Jonas:
Dennoch muss man sich leider vergegenwärtigen, dass laut der letzten Kriminalstatistik des Bundesinnenministers die Zahl rechter Gewalttaten in Deutschland erheblich zunimmt.
Florian:
Vielleicht ist es auch einfach ein gewisser Zweckoptimismus, der mir Mut macht.
»Ich fände es cooler, wenn sich in Deutschland mehr Schauspieler aktiv einbringen und positionieren würden.«
Jonas:
Als Barack Obama im Januar 2017 seine Abschiedsrede in Chicago hielt, sagte er unter anderem: „We in fact all share the same proud type, the most important office in a democracy: Citizen. So, you see, that’s what our democracy demands. It needs you.“ Würdest du sagen, dass deine Arbeit, in der du viele gesellschaftspolitische Themen aufgreifst und versuchst, sie einer jüngeren Generation verständlich und erfahr zu machen, ein Form von „active citizenship“ ist?
Florian:
Naja, ich möchte meine Rolle darin auch nicht zu hoch hängen. Heute habe ich beispielsweise eine Story produziert, bei der meine Follower den ganzen Tag lang entscheiden konnten, was ich als nächstes machen soll: ob ich Sport machen soll oder nicht, ob ich mit dem Hund spazieren gehen soll oder nicht, ob ich mir die Haare schneiden lassen soll oder nicht.
Dennoch kommt mein aktueller Job dieser Idee auf jeden Fall viel näher als das, was ich noch in meiner Schauspielerzeit gemacht habe. Als Schauspieler konnte oder wollte ich mich nicht so einfach positionieren, wie ich das heute kann. Und ganz nebenbei gesagt: Ich fände es ohnehin cooler, wenn sich in Deutschland mehr Schauspieler aktiv einbringen und positionieren würden.
Jonas:
Wir beide entstammen einer Generation, die in einer Zeit aufgewachsen ist, in der die großen gesellschaftspolitischen Kämpfe bereits geführt wurden: Ob Aufarbeitung der NS-Zeit, Vietnamkrieg, Ost-West-Konflikt, NATO-Doppelbeschluss, Kernenergie, friedliche Revolution in der DDR oder Abschaffung des Paragraph 175 – wir haben uns sozusagen in ein gemachtes Nest gesetzt und dabei nie so wirklich gelernt, wie man Protest ausübt und zivilen Ungehorsam betreibt. Geraten wir dann wie in den letzten Jahren in eine Situation, in der sich innerhalb kürzester Zeit die ganze Welt zu verändern scheint – Trump, Brexit, Erdogan, AfD -, wissen wir nicht recht, wie wir reagieren sollen. Und dann ertappen wir uns dabei, wie wir auf Facebook irgendwelche gut gemeinten Statements posten, liken oder sharen, die aber unsere eigene Meinungsbubble nie verlassen werden. Hast du einen Ratschlag, wie man sich in unserer heutigen Zeit am besten positionieren und einbringen kann?
Florian:
Wir sind tatsächlich in einer Generation aufgewachsen, in der alles geklärt ist – etwas anderes hat man uns nie erzählt. Aber so ist es eben doch nicht. Die Welt verändert sich ständig und produziert neue Machtverhältnisse, und das in einer atemberaubenden Geschwindigkeit. Manchmal geht alles so krass schnell, dass man sich fragt: Darf ich bitte erst mal die eine Krise halbwegs verstehen, bevor die nächste schon um die Ecke biegt? Wahrscheinlich müssen wir uns daran gewöhnen, dass Krise ein Dauerzustand ist. Trotzdem bin ich fest davon überzeugt, dass die Welt nicht untergehen wird. Mein Ratschlag wäre daher, jede Krise in Ruhe zu ergründen und die Fakten dahinter genau zu recherchieren, um daraus zu lernen und auf die nächste Krise besser vorbereitet zu sein.
»Wie man mit den Rechten reden kann, dafür habe ich auch noch keine Lösung gefunden.«
Jonas:
Aber damit alleine hat man sich noch nicht engagiert. Eines der meistgelesenen Bücher 2017 ist „Mit Rechten reden – Ein Leitfaden“. Ist das nicht ein gutes Beispiel dafür, dass sich die Leute danach sehnen, ein Mittel oder Werkzeug in der Hand zu halten, mit dem sie aktiv auf eine aktuelle Krise reagieren können?
Florian:
Wie man mit den Rechten reden kann, dafür habe ich auch noch keine Lösung gefunden. Vor knapp zwei Jahren ist mir in Estland auf einer Party ein Typ begegnet, der den Holocaust leugnete. Er erzählte mir, dass er auf YouTube ein Video gesehen hätte, das seiner Meinung nach plausibel darstellen würde, dass es den Holocaust nie gegeben hätte – und zwar deshalb nicht, weil in dem Video irgendjemand vorgerechnet hätte, dass es zahlenmäßig nicht möglich gewesen wäre, sechs Millionen Menschen in Konzentrationslagern zu ermorden. Da stehen einem die Haare zu Berge! An dieser Stelle hätte ich wohl in die Diskussion einsteigen müssen. Aber ich hatte einfach keinen Bock, mich mit so jemandem zu unterhalten – ich war auf einer Party!
Wie kann man sich also am besten engagieren? Auch wenn es bei mir selbst offenbar so wirkt, als würde ich mich sozial, gesellschaftlich oder politisch total einbringen, muss ich sagen, dass ich am Ende auch nichts anderes tue als irgendwelche Nachrichten aufzuschreiben und zu verbreiten. Dabei bin ich in der glücklichen Situation, eine gewisse Reichweite nutzen zu können. Und ich habe außerdem das Glück, den ganzen Tag lang nichts anderes tun zu dürfen, als mich solange mit bestimmten Themen zu beschäftigen, bis ich sie weitestgehend durchdrungen habe. Jemand, der das nicht beruflich macht, hat diese Zeit und Reichweite nicht.
Mir liegt in Bezug auf deine Frage eine vielleicht etwas banale Antwort auf der Zunge: Man muss sich vor allem lokal engagieren und genau dort ein Bewusstsein schaffen, wo man lebt und arbeitet. Wenn ich mein eigenes Verhalten ändere, besteht die Chance, dass sich diese Veränderung auch auf die Menschen um mich herum auswirkt.
Jonas:
Im Vorfeld unseres Interviews hast du den Satz gesagt: „Niemand ist nicht politisch.“ Was genau meinst du damit?
Florian:
Fast alles, was unseren Alltag ausmacht, ist irgendwo durch Politik bestimmt und reguliert. Etwa ob man in einer Bar rauchen darf oder nicht. Oder ob ich einen Kotbeutel dabeihaben muss oder nicht, wenn ich mit meinem Hund Gassi gehe. Solche Themen berühren unser tägliches Leben und wir entwickeln ganz automatisch eine Haltung oder Meinung dazu. Auch wenn wir vielleicht nicht parteipolitisch sind: Wir bewegen uns in einer Welt, die durch Politik gebaut ist. Daher ist es gar nicht möglich, nicht politisch zu sein.
»Die wenigen jungen Leute, die wir in Hastings getroffen haben, befürworteten fast alle den Brexit, weil sie hofften, dass es danach wieder bergauf gehen würde mit ihrer Stadt.«
Jonas:
Man stößt auf Facebook und Instagram immer wieder auf Fotos, die dich mit einem knallblauen Pullover zeigen, auf dem der Sternenkranz der europäischen Flagge prangt. Was bedeutet Europa für dich?
Florian:
Ich habe den Pullover gekauft, weil ich es witzig fand, mich damit zu positionieren. Ich mag Europa und finde, dass die Europäische Union prinzipiell eine sehr gute Idee ist. Für „Funk“ habe ich Anfang 2017 zusammen mit Kollegen eine Tour quer durch Europa gemacht. Wir wollten herausfinden, wie es vor allem jungen Menschen in Europa gerade geht, was sie bewegt und welche Einstellung sie gegenüber Europa haben. Gestartet sind wir in Frankreich, wo kurz zuvor die Präsidentschaftswahlen stattgefunden hatten. Zuerst waren wir im Norden unterwegs, genauer gesagt in der Region Nord-Pas-de-Calais, in der Marine Le Pen vom rechtsextremen Front National lange Zeit Generalrätin war. Unsere erste Station war Roubaix, eine 100.000 Einwohner-Stadt direkt an der belgischen Grenze, in der viele Leute Jean-Luc Mélenchon unterstützt hatten, den Präsidentschaftskandidaten der französischen Linken. Danach ging es weiter in die Kleinstadt Hénin-Beaumont, die etwa 40 km südlich von Roubaix liegt. Hénin-Beaumont ist sozusagen die Vorzeige-Nazistadt von Marine Le Pen, in der auch viele junge Leute rechts wählen. Von da aus haben wir uns auf den Weg nach Paris gemacht und sind anschließend nach London geflogen. Dort konnten wir uns mit vielen Studenten unterhalten, die gegen den Brexit gestimmt hatten.
Ganz anders war es dagegen in Hastings an der englischen Südostküste. Hastings war früher mal ein sehr schöner Fischerort, aber in den letzten Jahren wurde daraus eine sehr triste Stadt – mit einem hohen Anteil an Sozialhilfeempfängern und wenigen Perspektiven für Jugendliche. Die wenigen jungen Leute, die wir dort getroffen haben, befürworteten fast alle den Brexit, weil sie hofften, dass es nach dem Austritt Großbritanniens aus der EU wieder bergauf gehen würde mit ihrer Stadt. Anschließend sind wir nach Krakau zur Gay Pride geflogen. Und dann danach ging es über Breslau und Frankfurt/Oder wieder zurück nach Berlin. Das war ein kleiner Europa-Schnelldurchlauf.
Jonas:
Was ist dein Résumé dieser Reise? Wie stehen junge Europäer zu Europa?
Florian:
Das ist wirklich total unterschiedlich. Prinzipiell ist Europa für junge Menschen, die mehr Privilegien genießen, ein toller Ort. Dank Erasmus können sie überall studieren, es gibt keine Grenzkontrollen, man kann einfach für ein paar Tage zu Freunden nach Amsterdam oder Tallinn fliegen.
In Hastings dagegen habe ich einen jungen Zimmermann getroffen, der froh war über den Brexit. Für ihn war es, so erzählte er, ohnehin schon schwierig, Arbeit zu finden. Aber seit Polen Mitglied der EU geworden sei und viele polnische Arbeiter nach Großbritannien eingewandert seien, sei seine Arbeit nur noch die Hälfte wert. Das war seine Realität.
Jonas:
Und wie schätzt du in Deutschland die Einstellung gegenüber Europa ein?
Florian:
Ich glaube, dass Europa für uns Deutsche alleine deshalb schön ist, weil die europäische Flagge eine ist, die man ohne Probleme feiern kann: Die deutsche Flagge wurde ja immer wieder missbraucht, vor allem in den letzten Jahren, wo sie inflationär bei Pegida oder AfD zu sehen war. Die Europaflagge dagegen wirkt unbelastet und positiv. Sie suggeriert etwas Gutes, damit können wir uns vielleicht leichter identifizieren.
Jonas:
Da es relativ viele Fotos von dir gibt, auf denen du mit deinem Europa-Pulli zu sehen bist, unterstelle ich dir mal, dass du der europäischen Einigung gegenüber grundsätzlich positiv eingestellt bist. Oder liege ich da falsch?
Florian:
Ich sehe mich selbst in erster Linie als Europäer und weniger als Deutschen – und ich bin Optimist. Passt also. Dazu kommt, dass ich, seitdem ich diesen Pullover trage, das Thema Europa nochmal mit einem anderen, größeren Bewusstsein wahrnehme als vorher. Ich weiß, dass es viele Krisen auf der Welt und in Europa gibt, die wirklich ernst zu nehmen sind. Aber dadurch wird die Welt nicht untergehen. Und Europa auch nicht. Ich weigere mich einfach, da negativ zu denken.
»In Belarus habe ich zum ersten Mal gemerkt, wie wertvoll unsere Demokratie in Deutschland ist.«
Jonas:
Du warst in den letzten Jahren in etlichen europäischen Ländern unterwegs. Was können wir Deutschen von unseren europäischen Nachbarn lernen? Und was können andere Europäer von uns lernen?
Florian:
In Estland fand ich es toll zu sehen, wie wenig Bürokratie es gibt und wie weit die Digitalisierung fortgeschritten ist – nicht nur in der öffentlichen Verwaltung. Die Esten sind Digital Natives, die Digitalisierung ist Teil ihrer Identität. Das war schon beeindruckend – auch wenn Esten ein etwas anderes Verhältnis zu Daten und Privatsphäre haben als wir.
Auf der anderen Seite habe ich zum Beispiel in Belarus zum ersten Mal gemerkt, wie wertvoll unsere Demokratie in Deutschland ist. Es gibt in diesem Land immer noch eine Diktatur – und wer dagegen protestiert, begibt sich in Gefahr. In Minsk habe ich einen jungen Studenten kennengelernt, der bei einer Demonstration von der Polizei verprügelt wurde und fast hinter Gittern gelandet ist. Wenn man nach einer solchen Begegnung nach Deutschland zurückkommt, merkt man erstmal, was Freiheit bedeutet.
Jonas:
Könntest du dir vorstellen, selbst mal in die Politik zu gehen?
Florian:
Nee! (überlegt einen Moment) Oder vielleicht doch? Eine Zeit lang habe ich mal darüber nachgedacht, in eine Partei einzutreten – aber nicht, um grundsätzlich in die Politik zu gehen, sondern aus dem Bedürfnis heraus, mich engagieren zu wollen und mit meinen Themen auch Handlungen zu verbinden.
Jonas:
Vielleicht funktioniert Politik in Zukunft ja anders – etwa mit mehr Volksentscheiden und weniger Parteipolitik.
Florian:
Ich kann mir nicht vorstellen, dass Politik besser funktioniert, wenn man alle komplizierten Fragen auf Volksentscheide überträgt. Nicht jede gesellschaftspolitische Frage lässt sich auf ein simples Ja oder Nein herunterbrechen. Das würde hauptsächlich den extremen Parteien nutzen, die genau diesen Mechanismus brauchen, um simple Antworten auf komplexe Fragen zu geben. Daher sehe ich gerade wirklich nicht, wie es anders laufen könnte.
Davon abgesehen muss ich gerade auch wieder an Estland denken: Wenn dort Wahlen sind, kann man nicht nur seine Stimme über das Handy abgeben, man hat dafür auch eine Woche lang Zeit und kann sogar seine Entscheidung nochmal ändern. Das wäre auch in Deutschland etwas, womit man mehr Beteiligung erreichen könnte.
»Nicht jede gesellschaftspolitische Frage lässt sich auf ein simples Ja oder Nein herunterbrechen.«
Jonas:
Gibt es Politiker der Gegenwart oder Vergangenheit, die dich inspirieren?
Florian:
Ich höre beispielsweise Gregor Gysi gerne zu, der auch immer ein bisschen schelmisch ist – in Verbindung mit dem Wort Inspiration ist er gerade der Einzige, der mir einfallen würde. Allerdings gibt es auch ein paar junge Politikerinnen und Politiker, die zwar nur wenige Leute kennen, die aber meiner Meinung nach echt gut sind. Sercan Aydilek von der SPD halte ich beispielsweise für einen sehr spannenden Charakter. Oder Nyke Slawik von den Grünen in Nordrhein-Westphalen, die finde ich auch gut – sie hätte die erste Trans-Frau sein können, die in einen Landtag einzieht.
Jonas:
Wenn du in die Zukunft schaust, gibt es etwas, wovor du Angst hast?
Florian:
Angst ist ein sehr großes Wort. Eine konkrete Angst habe ich momentan nicht, zumindest fällt mir keine ein. Ich würde eher sagen, dass ich mir Sorgen mache: davor, dass ich nicht mehr einfach so in meiner Bubble weiterleben kann, in der ich besoffen mit Jungs nach Hause torkeln darf und in der ich meine Freiheiten nicht aufgeben muss. Aber wir alle sind ja handlungsfähig genug und können uns dafür engagieren, dass es nicht so weit kommt.
Jonas:
Dann bleiben wir beim Optimismus: Was passiert in der Zukunft? Wohin entwickeln wir uns als Gesellschaft?
Florian:
Keine Ahnung! Ich hoffe, dass beispielsweise so etwas wie die Präsidentschaft von Donald Trump ein kurzfristiges Phänomen ist, das wieder verschwinden wird. Die Frage ist: Wovon lassen wir uns leiten: von Angst und Hass oder von Liebe und Mitgefühl? Ich bin für Letzteres.
Florian Prokop online:
facebook.com/aboutblankvideo
instagram.com/florianprokop
twitter.com/floprokop
Fotos: Maximilian König
Ausstellungsdesign: ATELIER BRÜCKNER
Naïka
Interview — Naïka
A Uniting Sound
All that is missing is a flower in her hair to give her the perfect hippie flair; Miami-based singer Naïka Richard wants to add more color to her favorite thing in the world: Pop music. We spent a day with Naïka at an unusual urban playground and spoke about her mission.
20. Februar 2018 — MYP N° 22 »Resistance« — Interview & Text: Katharina Weiß, Photography: Steven Lüdtke
I have to be honest: the first time I typed the name of US artist Naïka into Google and saw a picture from the video for her song „Ride“, I thought: Ok, just another half-naked girl singing about shaking her booty on the dance floor. But then I played it and the cute clip really made me smile. The song immediately got stuck in my head and stayed there for the rest of the day.
Besides being well manufactured pop, Naïka slips some unusual twists into her feel-good lyrics „No cheap philosophy / Don’t need designer dreams / It’s all a lot of shit to me.“ The singer has lived on four different continents and her sound is marked by a variety of different influences. Despite seeing many wonders of the world though, the Berlin experience has been new to her. We meet up with Naïka in the empty Universal Music Group building in Friedrichshain. It’s a national holiday and since all of the employees aren’t there we start enjoying ourselves in the unique space just like a bunch of kids who have been left home alone for the very first time.
Naïka is a girl other girls like. Even though she is hauntingly beautiful and blessed with an incredible voice, she is free of pretension and seemingly doesn’t have a boring bone in her body. Her calm sense of humor makes it easy to laugh along with and her work ethic is impressive for a 22-year-old newcomer. During our shoot on top of the roof of the building, the photographer asks Naïka if she could take off her jacket to have a better contrast against the dark Berlin skyline. There I am, freezing in my thick winter coat, as she poses in her white crop top without uttering a single complaint.
We dance and sing along to Beyoncé to keep warm and later move down to the lobby to bask in the simple delight of trying each of Universals swings with huge smiles on our faces. Naïka might not be the biggest signed artist at Universal yet-but she for sure is the only one who’s used their headquarters as her personal playground…
Katharina:
Would you rather be more attractive or more charismatic?
Naïka:
Charismatic. A person that’s just attractive can keep you very bored. Charm goes beyond that. It gets to your soul.
Katharina:
If you could be minister of education for a day, what would you change about music education in schools?
Naïka:
I would impose it. How does the world work without music? People often don’t take music education seriously enough. To be creative in a musical way activates certain areas in your brain, which can also be used for other skills. And it’s healing.
Katharina:
What are your three favorite words in the English language?
Naïka:
Laughter, love, happiness. God, I’m such a cheesy person.
»My favorite English words are: Laughter, love, happiness. God, I'm such a cheesy person.«
Katharina:
What other languages do you speak?
Naïka:
English and French are my first languages and I speak Haitian Creole and a little bit of Spanish. My mum is from Haiti, so I grew up with Caribbean music playing around the house.
Katharina:
That explains why you covered an old Haitian song, „Papa Gede / Bel Gason“-a clip that has over half a million views on your Facebook page.
Naïka:
The reactions were amazing. It is a song that everyone forgot about and it was so much fun bringing it back.
Katharina:
While English is the dominating language in popular cultural, non-white languages and sound influences are often neglected…
Naïka:
I want to change that. Every culture and heritage should be glorified and valued. We should learn from each other’s histories and respect them. I don’t understand this separation that’s going on. I never understood how we can be this way, so full of fear instead of embracing our differences.
Katharina:
You wrote a song about a Syrian child-what inspired you to write about someone so far away?
Naïka:
I came across this video, where I could see this little boy. His home had just crumbled, and he was taken to the hospital but his whole family had died after being hit by a bomb in Aleppo. I want to cry just thinking about it now. I recognized once again, that in the country where I live we all exist in this little bubble. And we see videos like that on the news, thinking it’s something very far away. I don’t think we realize that this stuff is happening in our world and that we have the power to stop it. We are powerful enough to make a difference. Just watching it and saying „Oh so sad!“ before moving on is not enough. We have to help each other, I want to bring awareness to the fact that not everyone has the same privileges as we do. Writing songs like this is my way of trying to change things.
»We have to help each other, I want to bring awareness to the fact that not everyone has the same privileges as we do.«
Katharina:
Is there a song that really changed you?
Naïka:
Michael Jackson’s „We are the World“ and „One Love“ by Bob Marley. Always. I also like a more recent one, „Chained to the Rhythm“ by Katy Perry. I really felt impacted by that song, I actually wish I wrote it.
Katharina:
Speaking about songwriting, do you write all of your songs on your own?
Naïka:
Yes, definitely. I want to be involved in all of my music. I feel then it’s much more personal and that connection is very important to me. The only song I didn’t write on my own is „Call me Marilyn“. A good friend from Berklee College of Music in Boston, where I went to school, pitched it to me.
Katharina:
Do you remember the first song you ever wrote?
Naïka:
A long time ago in South Africa, the track was called „Rise.“ It was about coming together as humanity and not being afraid to rise up. When I look back at it now, it´s incredibly kitschy.
I’ve come a long way, in regard to my voice as well. When I started singing, it was not as good as it is today. It’s a daily effort, still. It’s a mountain to climb. I really want to bring a positive change to this planet. I know, this sounds super cheesy. But like I already said, I am a cheesy person. That’s my biggest motivation: Knowing that I can inspire people and make them feel unique. We’ve created so many boundaries, I want to tear these walls down. We should all try to cherish and appreciate each other.
»We've created so many boundaries, I want to tear these walls down.«
Katharina:
Oooh, you are a little hippie.
Naïka:
Yes, I am a little hippie inside.
Katharina:
What are the little things in life that make you happy?
Naïka:
Food, oh my god.
Katharina:
You don’t look like it though.
Naïka:
I know, because I try to eat healthy. But one of the best things about traveling is to try different kinds of food. I love Vietnamese food. As well as Haitian and French cuisine. I am going to Paris in a few days and since I booked the trip, all I can think about is eating.
Katharina:
Moving on from the happy things in life to some rather sad things. On your YouTube channel you wrote about your song „Snowing in LA (Long distance song),“: „When your boyfriend moves across the country, gotta write a song to deal with the sadness!“ What happened to this relationship?
Naïka:
I was crying for three days in a row, I was really sad. To write a song about it helped me. I was a bit nervous about releasing the song because it is so personal. But on the other side, I was super excited to share it since many people are going through the same thing. Me and my boyfriend are still together. When I move to LA in January, we will be reunited.
Katharina:
Maybe then we’ll get a sequel song from you. Could it be that being separated from people you like is a common trope in your biography? Because you lived in so many different countries?
Naïka:
Yes. My dad’s job made the family move very often. I grew up in Guadeloupe, an island in the Caribbean, and also on an Island in the Pacific Ocean named Vanuatu. Then I lived in Kenya for four years and in Paris for two. The last step was South Africa before we moved back to Miami. Now I think all the moving I had to go through as a child was very rewarding, because I became a person who can easily adapt to new situations. When I look back now, I think of it as a magical childhood. I was exposed to so many different cultures, a variety of sounds, fragrances and so on.
»When I look back now, I think of it as a magical childhood. I was exposed to so many different cultures, a variety of sounds, fragrances and so on.«
Katharina:
Yes, one can hear that this influenced your sound. All the tracks are different, but they are all very well-made pop.
Naïka:
The term I found for myself to describe it is „world pop“. I want to incorporate my roots and all the different cultures in my sound. Plus, I adore pop music, Britney Spears used to be my idol when I was six, I just love pop music. I try to keep it organic. I am not too deep into electronic stuff. I do a little bit of it, to keep my sound modern, but having a variety of instruments is more important to me. For one of the songs I used African drums and my new song „Serpentine“ has an Arabic feel to it.
Katharina:
Do you believe in god?
Naïka:
Yes. I believe in a higher power. I think you attract what you put out, I believe in karma. I have seen the wonders of the world and there is just too much beauty on this earth to not believe in a higher power. With all of the different religions I encountered, I realized that they all end up worshipping the same principles. We all hope for positive things and pray to attract them.
Katharina:
What does it mean to be a modern woman, a modern human to you?
Naïka:
Knowing how to be independent, knowing to rely on yourself. You don’t necessarily need a partner to evolve or to be a better version of yourself. Your individual soul is powerful and if you have a strong will nothing is impossible. A modern human to me also means being aware of what is happening in the world and working towards changing it for the better, to try and bring a positive change to our society.
»You don't necessarily need a partner to evolve or to be a better version of yourself.«
Katharina:
Have you ever rejected an attractive guy for being too chauvinistic?
Naïka:
So many times. There are guys out there who think you are just a piece of meat, a little flower to pick as they please. Not with me. You will not do whatever you want with me and then throw me away when you´re done.
Katharina:
Are you always open about your opinions?
Naïka:
Yes, though I try to not be too blunt, because I don’t like hurting other people’s feelings. But if someone is a prick to me, then I will say something straight to their face. I am not going to keep my mouth shut if somebody is disrespectful to me or anyone else.
Katharina:
Do you remember the last time you really felt a feeling of ecstasy?
Naïka:
I had this awaking phase this year, where I just realized that I can do anything if I set my mind on it. This sounds so basic, but there is always this voice in your head that limits and scares you. So, during this crazy phase I understood that fear is always the main element slowing me down. My path will not be easy. I have had difficult times and I know there are many challenges to come. But now I feel mentally prepared. I always study people who have had successful music careers. And one thing they always say is, that they never gave up no matter how hard it got. I won’t let failure stop me, I can do this-having that realization was an ecstatic moment for me.
More about Naïka:
Photography by Steven Lüdtke:
Hair & make-up by Luiza Simor:
ZETA
Portrait — ZETA
Tiger im Käfig
Für die Studenten der Gangster, für die Gangster der Student: Der Berliner Rapper ZETA fühlt sich meistens so, als säße er irgendwie zwischen den Stühlen. Ein Spaziergang durch Friedrichshain und die Seelenlandschaft des ambitionierten Musikers.
14. Februar 2018 — MYP No. 22 »Widerstand« — Interview & Text: Katharina Weiß, Fotos: Manuel Puhl
Große Gestalt, rasender Rap, massig Muskeln: Müsste man den Berliner Musiker ZETA mit spontanen Assoziationen belegen, wären seine flinke Zunge und die gestählte Physis definitiv das Markenzeichen des 24-Jährigen. Das Konzept des „Tigers im Käfig“ funktioniert bei ZETA nicht nur auf seiner Debüt-EP „Auftakt“, er kann dieses Bild auch nahtlos in seine persönliche Präsenz übersetzen. Das Hadern mit den eigenen Dämonen, der Widerstand gegen die dunkle Seite, ein gefühlter Abstand zwischen dem Ich und der Norm – über genau diese Kämpfe rappt ZETA mit einer Raffinesse, die das HipHop-Magazin Juice als „Silbengemetzel par Excellence“ beschreibt.
Ich treffe den Musiker am RAW-Gelände und beginne mit ihm einen kleinen Nostalgiespaziergang: Bewaffnet mit ein paar Stickern seiner „Auftakt“-EP schlendern wir an den Clubs und kreativen Räumen vorbei, die den gebürtigen Braunschweiger in seinen ersten Berliner Jahren besonders inspiriert haben. „Mein älterer Bruder hat mich zum amerikanischen HipHop der 90er gebracht – das hat bei mir genau in die richtige Bresche geschlagen. Der Vibe, der Flow, die Musik haben mich einfach gecatcht. „Hier“, sagt ZETA und zeigt auf das Schild der Clublegende Cassiopeia, „war ich richtig oft.“ Immerhin ein Sticker des Rappers ziert nun den Eingang des Friedrichshainer Nachtclubs mit Subkulturflair – ob er eines Tages hier auftreten wird, steht noch in den Sternen. Unwahrscheinlich ist es bei dem Arbeitspensum des selbständigen Künstlers aber nicht.
»Ich habe gemerkt, wie stark ich geformt werden soll – für meine Ideen wäre nicht mehr genug Platz gewesen.«
Bisher arbeitet er mit seinem Producer derkalavier auf unabhängiger Basis, Angebote mehrerer Label lehnte er bisher ab. Eine größere Plattenfirma setzte sich mit ZETA zusammen und legte ihm kurz nach der Begrüßung eine Tracklist vor. „Die meinten: ‘Hier machst du ’nen Opener, der kommt krass rein mit einem dicken Beat. Im nächsten Song zeigst du deine Skills, danach machen wir was für die Mädels und gleich im Anschluss einen Track zum Feiern…’ Ich habe gemerkt, wie stark ich geformt werden soll – für meine Ideen wäre nicht mehr genug Platz gewesen.“
Der Widerstand gegen dieses geformt werden ist für ZETA ein Lebensthema. Geboren als Johannes Loock wurde der Sohn einer Kunsthistorikerin und eines Philosophen schon früh mit den Exklusionsmechanismen des Bürgertums konfrontiert. Zuhause wurde Klassik gehört, in der Familie gab es Tendenzen, die stark normieren wollten, wie ein Lebensweg aussehen soll. Und dem distinguierten Habitus der intellektuellen Freunde seiner Eltern waren subkulturelle Ausdrucksformen ohnehin fern. „Einen gefestigten, bürgerlichen, intellektuellen Weg gehen, das war nie mein Ding. Warum ich diese Widerstände auf mich genommen habe? Ich habe einfach früh gespürt, dass es nicht anders geht. Ich wusste: Ich muss das jetzt rauslassen und so sein, wie ich bin.“
»Besonders an der Uni spüre ich stark, dass mich mein Aussehen in eine Schublade katapultiert. Gewisse Fertigkeiten werden mir ab-, dafür Stumpfheit und Primitivität zugesprochen.«
Zumindest seine Eltern unterstützen und respektieren mittlerweile die Kunst des Sohnes. Dafür muss er sich jetzt an der Universität mit Kategorisierungen auseinandersetzen. Seit 2015 studiert ZETA Linguistik an der Humboldt-Universität zu Berlin. Er erzählt: „Besonders an der Uni spüre ich stark, dass mich mein Aussehen in eine Schublade katapultiert. Gewisse Fertigkeiten werden mir ab-, dafür Stumpfheit und Primitivität zugesprochen.“ So können sich Political Correctness und die akademische Sensibilität für die „Race, Class, Gender“-Trinität manchmal in den eigenen Schwanz beißen. Klar, es fällt schwer, bei ZETAs immensen Oberarmmuskeln nicht an Proll und Macho zu denken. Aber er findet, ein unausgesprochenes Vorurteil in offene Ablehnung zu verwandeln, setzt beim Kampf gegen Privilegien an der falschen Stelle an.
Die Geschichte hinter ZETAs Affinität fürs Gewichtheben ist im Übrigen auch eine des Widerstands: „Ich hatte als Kind viel mit Unfällen zu kämpfen: kleinere Brüche, Zahnunfälle und derlei Dinge waren quasi an der Tagesordnung. Besonders einschneidend aber war aber ein ziemlich heftiger Augenunfall, bei dem ich um ein Haar erblindet wäre. Die Ärzte zogen mehrere zentimeterlange Holzsplitter aus meinen Augen. Zwei Wochen lang waren meine Augen nicht funktionsfähig – ich sah, im wahrsten Sinne des Wortes, schwarz. Eine extreme Erfahrung: unbeschreibliche Schmerzen und ein Leben komplett im Dunkeln. Jede noch so alltägliche und selbstverständliche Handlung wurde zur Schwerstaufgabe. Ich hatte aber enormes Glück und konnte dank guter Behandlung mein Augenlicht zurückerlangen. Zwei Jahre später dann ein Beinbruch, der mich acht Jahre beschäftigt hat, weil der Knochen schief zusammenwuchs. Dann musste das Bein nochmal klinisch gebrochen werden, der Heilungsprozess dauerte ewig. Krankenhaus, Rollstuhl, Wartezimmer, Krücken, Physiotherapie. Ich musste mit extremen Schmerzen kämpfen, das kann man kaum beschreiben, es gibt einfach ganz verrückte Levels von Schmerzen. Viele Sachen nicht mehr mitmachen zu können, mehrere Jahre keinen Sport machen zu können, nicht mehr in den Verein gehen zu können, das war sehr prägend.“
Die verlorene Kontrolle über seinen Körper holte er sich sobald es ging zurück. Mittlerweile gehört das Training zu seinem Alltag, ist für ihn wie Meditation: „Egal wie verpennt oder versoffen du bist, du musst dranbleiben und immer wieder hingehen – das hat meinen Charakter in vielen Aspekten stark gebildet. Mir ging es nie wirklich nur um die Ästhetik, sondern viel mehr um das Körpergefühl: Im Kraftsport musst du extrem in deinem Körper drin sein und Atemübungen und Pausen beachten. Alles andere wird ausgeblendet, da bin ich ganz bei mir.“ ZETA wirkt wie das verkörperlichte Klischee der Phrase „Ein Mann, ein Wort“. Es liegt ein Nachdruck in seinem Tonfall, der zum einen dem entschlossenen Charakter des HipHop-Genres zugeordnet werden kann, zum anderen aber auch ein Alleinstellungsmerkmal des Musikers sein könnte.
»Wenn du anderen Menschen gegenüber Aggressionen empfindest, dann sind das immer Projektionen, bei denen es eigentlich um dich selbst geht.«
Dass es auch andere Zeiten gab, deutet er an, als wir über das Thema Aggressionen sprechen: „Die können wichtig und gut sein, wenn man sie in die richtigen Kanäle leitet. Sehr produktiv und energiespendend, aber natürlich auch ein zweischneidiges Schwert, weil sie dich von innen auffressen können und dein Umfeld vergiften. Aggressionen sind meiner Meinung nach immer nach innen gerichtet. Wenn du anderen Menschen gegenüber Aggressionen empfindest, dann sind das immer Projektionen, bei denen es eigentlich um dich selbst geht.“
Während wir uns auf der Simon-Dach-Straße an verstrahlten Hipstern und jungen Familien auf Fahrradtour vorbeischieben, deutet der Musiker an, dass es auch Zeiten gab, in denen er selbst ebenfalls Probleme mit der Balance hatte: „Mittlerweile komme ich gut mit Dingen klar, mit denen ich früher große Schwierigkeiten hatte. Von außen denken die Leute vielleicht: ‚Du kommst aus einem gutbürgerlichen Elternhaus, hast doch alles, was du brauchst, klassisches Mittelstandskind – worüber beschwerst du dich eigentlich?‘ Aber Probleme sind nun einmal subjektiv. Ich bin mir meiner Privilegien durchaus bewusst, aber meine Probleme sind für mich persönlich nicht minder schwerwiegend. Mittlerweile beschäftige ich mich mit diesen Abgründen durch meine Form der Expression: meinen Rap.“
Als Halbstarker, gerade so der Pubertät entwachsen, zeigte sich diese Expression auch in einer gewissen Nähe zu Gangs und Kiffern aus dem kleinkriminellen Milieu – vielleicht, um mutwillig einen Abstand zum Bürgertum herzustellen, vielleicht, um den subkulturellen Straßenwurzeln des HipHop näher zu kommen. „Ich war fasziniert von diesen Menschen, die in unserer Gesellschaft keinen Platz haben, auch weil das in meinem Elternhaus überhaupt nicht repräsentiert war. Natürlich hat mich auch das Böse-Jungs-Image interessiert. Bei den Leuten auf der Straße war ich aber immer als Student gelabelt. Für die Studenten bin ich der Proll und, ganz blöde gesagt, der Gangster – und für die Gangster bin ich der Student. Dieses zwischen den Stühlen Sitzen hat mich oft begleitet.“
»Bewusst irgendwelche No-Gos zu bringen, um zu polarisieren und zu provozieren, ist für mich kein cooler Weg. Aber, leider Gottes, in fast allen Fällen ein erfolgreicher.«
Als wir uns gemeinsam in seinem liebsten Plattenladen, dem HHV_Store in der Grünberger Straße, durch die Vinyl-Regale stöbern, bleiben wir schnell an seinen Helden hängen: Nas, Cypress Hill, Eminem, Wu-Tang Clan. Gute Sachen. Damals provozierten diese Künstler auf die progressivste Weise, die ihnen möglich war. Aber wie funktionieren Provokation und HipHop im Jahr 2017? „Bewusst irgendwelche No-Gos zu bringen, um zu polarisieren und zu provozieren, ist für mich kein cooler Weg. Aber, leider Gottes, in fast allen Fällen ein erfolgreicher.“
Auch wenn ZETA sich an vielen klassischen Stillmitteln des Genres bedient, geht er in mancher Hinsicht neue Wege. Sein Video zu „Murderer“ arbeitet beispielsweise mit einem unerwarteten Geschlechtertausch: Eine tiefe, brachiale, männliche Stimme fängt an superschnell zu spitten – die Lippen, die sich dazu bewegen, gehören einer bunt gemischten Gruppe von Frauen, die die geliehene Stimme erst gegen Ende zurückgeben, wenn der Rapper selbst kurz in Erscheinung tritt. Das Video ist absolut nicht aufreizend, aber es zeigt Persönlichkeit, was wiederum irgendwie sexy ist.
Während wir uns in einem Café niederlassen, frage ich ZETA, welchen Einfluss sexuelle Energien auf ihn haben. „Die sind stark vorhanden bei mir, schwierig in Bezug auf Monogamie. Sexuelle Energie ist etwas sehr Treibendes, eine vitale Strömung, bei der man sich sehr stark spüren kann“, erzählt er. „Ich merke Blicke, ich gucke auch selber. Ich bin 24, also quasi auf dem absoluten körperlichen Höhepunkt. Und wenn das Leben frei von Regeln wäre, dann würde ich mich absolut austoben. Andererseits weiß ich natürlich, dass das Leben immer ein Kompromiss ist. In diesem Sinne muss ich widerstehen, weil ich weiß, dass es das Richtige ist“, kommentiert ZETA mit Hinblick auf seine aktuelle Beziehung.
Andere seiner Geschichten zeugen von einem gewissen Reiz, den das Spiel mit der Enthaltsamkeit und dem Entsagen auf den Künstler ausübt. Nach dem Abitur buchte er sich einen Flug nach Reykjavík, packte den Rucksack und begab sich auf einen sehr spontanen Solo-Survival Trip. Bummelbusse fuhren ihn an den Rand der Zivilisation, von dort aus erkundete er die karg bevölkerte Insel auf eigene Faust. Da das Gepäck vor allem aus Proviant bestehen musste, war nur noch wenig Platz für eine Extrahose, drei Shirts, eine Handvoll Socken und ein paar Unterhosen. Seine Schilderungen der Hygiene- und Schlafqualität klingen für mich weniger nach Traumurlaub und eher nach Horrortrip. Einmal wäre er fast von einer Klippe gerutscht, hielt sich gerade noch an ein paar Wurzeln fest, ein 30m Abgrund unter ihm.
»Ich schreibe meine besten Texte, wenn ich depressiv oder besoffen bin oder gerade den besten Orgasmus meines Lebens hatte.«
„Ob ich diese Reise gemacht hätte, wenn ich das alles davor gewusst hätte? Keine Ahnung, aber es inspiriert mich bis heute. Ich kann nicht sagen, ich schreibe meine besten Texte, wenn ich depressiv oder besoffen bin oder gerade den besten Orgasmus meines Lebens hatte – meine Neugier treibt mich dazu, überall Inspiration zu finden…“ Von diesen großen und kleinen Abenteuern erzählt ZETAs „Auftakt“-EP mit einer nachdrücklichen Ehrlichkeit und Innenansicht. Er hat jetzt alles auf den Tisch gelegt, sich vorgestellt und seine Position erklärt. Wohin der Weg jetzt gehen wird, ist offen. Klar ist für den Rapper aber eines: „Jetzt öffnet sich der Fokus, seid bereit“.
ZETA – „Zeitlose Elaboration Totaler Authentizität“
Katty Salié & Jo Schück
Interview — Katty Salié & Jo Schück
Gegen die Ohnmacht
Katty Salié und Jo Schück beleuchten in »ZDF aspekte« jeden Freitagabend Aktuelles aus Kultur und Gesellschaft. Dabei geben sie auch Menschen eine Stimme, die anderswo vielleicht unterdrückt oder nicht gehört würde. Wir treffen beide im Berliner Kunstquartier Bethanien, wo einst Theodor Fontane als Apotheker arbeitete.
14. Februar 2018 — MYP N° 22 »Widerstand« — Interview & Text: Jonas Meyer, Fotos: Steven Lüdtke
Als das ZDF am 7. Februar 2014 der deutschen Fernsehöffentlichkeit eine neue Ausgabe von „aspekte“ präsentierte, war die Anspannung bei allen Beteiligten groß. Das Format, das seit über 48 Jahren zum festen Repertoire des ZDF gehörte, hatte sich einer konsequenten Frischzellenkur unterworfen. „Das neue aspekte“, so formulierte es einer der Moderatoren, sollte eine „wilde Mischung“ sein, die „anecken“ und „die Leute mitreißen“ will.
Mitreißend fanden das neue „aspekte“ durchaus Viele. Doch bei ebenso Vielen war das aufgefrischte Format ziemlich angeeckt. Und so prasselten – mit dem Start der Sendung um 23 Uhr – unzählige Kommentare auf die Facebook-Seite von „aspekte“ nieder, die von Boykotterklärungen bis zu Beschimpfungen alles enthielten, was das wutentbrannte Social Media-Herz begehrt.
Wer heute, vier Jahre später, an einem Freitagabend den Fernseher einschaltet und dem ZDF nach der „heute-show“ für weitere 45 Minuten treu bleibt, wird feststellen, dass das neue „aspekte“ nicht nur überlebt hat, sondern quicklebendig ist. Moderiert wird die Sendung von Katty Salié und Jo Schück, die in ihrem Studio am Ende einer jeden Woche nicht nur Künstler und Kulturschaffende empfangen, sondern auch Menschen eine Stimme geben, die an anderer Stelle vielleicht unterdrückt oder nicht gehört würde.
Wir treffen Katty und Jo im Kunstquartier Bethanien im Berliner Stadtteil Kreuzberg. Der Gebäudekomplex, der von 1845 bis 1847 an der Nordwestseite des Mariannenplatzes errichtet wurde, diente ursprünglich als Diakonissen-Krankenhaus. Im März 1848, wenige Monate nach der Eröffnung und inmitten der Unruhen der Deutschen Revolution, nahm Theodor Fontane in Bethanien seine Arbeit auf – als Apotheker. Knapp zwei Jahre lang führte er die krankenhausinterne Apotheke und bildete Diakonissen-Schwestern zu Pharmazeutinnen aus, bis er am 30. September 1849 seinen weißen Kittel an den Nagel hängte und beschloss, von nun an als freier Schriftsteller zu leben.
Bethanien überlebte zwei Weltkriege und war noch bis 1970 als Krankenhaus in Betrieb. Bereits zwei Jahre vorher waren Pläne bekannt geworden, wonach der Gebäudekomplex abgerissen und das gesamte Gelände neu bebaut werden sollte. So begann mit der Stilllegung auch der sogenannte „Kampf um Bethanien“, in dem sich Bürgerinitiativen und Denkmalschützer vehement gegen Abriss und Neubebauung zur Wehr setzten. Verschiedene Künstlergruppen waren es dann, die eine Idee für die alternative Nutzung des Gebäudes entwickelten. Mit Unterstützung des Berufsverbands Bildender Künstler und der Berliner Presse konnten sie durchsetzen, dass das Haus im Jahr 1973 als Zentrum für Kultur und Soziales wiedereröffnet wurde.
Im Laufe der Jahre und Jahrzehnte siedelte sich eine Vielzahl von kulturfördernden Projekten und Organisationen in Bethanien an: etwa die Druckwerkstatt, die heute zu den wichtigsten ihrer Art in Europa zählt und Künstler aus aller Welt anzieht. Oder das Internationale Theaterinstitut, das bereits seit 1948 als weltumspannendes Netzwerk und unter dem Schirm der UNESCO dem wechselseitigen Austausch der Theaterschaffenden der Welt dient. Außerdem der Deutsche Akademische Auslandsdienst, eine Musikschule, eine Bibliothek, eine Seniorenbegegnungsstätte und ein Café-Restaurant. Eine bunte Mischung, könnte man sagen.
Die freundlichen Mitarbeiterinnen des Theaterinstituts sind es auch, die sich spontan bereit erklärt haben, uns für unser Treffen mit Katty Salié und Jo Schück ihren Konferenzraum zu überlassen, damit Visagistin Jula Hoepfner die beiden in Ruhe für das bevorstehende Shooting vorbereiten kann. Jula ist seit Jahren für die Maske bei „aspekte“ zuständig, wir treffen also auf ein eingespieltes Team.
Jonas:
Vor ziemlich genau vier Jahren seid ihr mit einem völlig neuen „aspekte“-Format an den Start gegangen. Viele Leute haben sich damals über die neue Form der Sendung entrüstet, vor allem auf Facebook. Wurdet ihr von diesem Grad an Entrüstung überrascht?
Jo:
Nein, wir hatten damit gerechnet – weil man immer eine volle Breitseite abbekommt, wenn man im Fernsehen etwas verändert. Gerade wenn man so ein altehrwürdiges Magazin wie „aspekte“ anfasst und der Zuschauerschaft, die über viele Jahre gewachsen ist, etwas Neues vorsetzt, rumpelt es am Anfang sehr und man stößt auf wenig Verständnis. Sicher, bei uns war auch nicht von Anfang an alles gut, die Entrüstung war daher erwartbar. Aber auf der anderen Seite gab es auch echt viele Leute, die gesagt haben: „Gott sei Dank, endlich erneuert ihr euch mal!“
»Nichts ist leichter, als mal eben auf Facebook einfach so seine Wut rauszulassen. Das muss ich mir einfach nicht antun.«
Jonas:
Warum musste man „aspekte“ denn erneuern?
Katty:
Weil es langweilig geworden wäre. Und weil sich die Sichtweise der Zuschauer verändert hat – in den letzten Jahren sind ja etliche Fernsehsendungen schneller und abwechslungsreicher geworden. Wenn ich mich an das „aspekte“ von früher erinnere, war alles sehr stringent: Ich als Moderatorin habe einen Beitrag angesagt, der von der Redaktion erstellt wurde, dann habe ich wieder einen angesagt, dann wieder, dann wieder. Und dann habe ich Tschüss gesagt. Das neue Konzept dagegen, das letztlich unser Redaktionsleiter Daniel Fiedler erfunden hat, bietet viel mehr Abwechslung. Durch das Aufspalten der Formatstruktur gibt es nun beispielsweise so etwas wie Interviews mit Bands oder Künstlern, die live im Studio auftreten. Dadurch war es uns möglich, uns von der starren Form zu verabschieden und viel mehr zu spielen. Das hat mich überzeugt.
Aber auch mir war klar, dass da eine Riesenwoge an Entrüstung auf uns zukommen würde, weil sich natürlich viele Leute an das alte Format gewöhnt hatten, das ja – wohlgemerkt – auch erfolgreich war. Und wenn wir mal ehrlich sind, haben wir die Quoten auch gar nicht großartig verändert…
Jo:
… wir haben uns ein bisschen verbessert.
Katty:
Auf jeden Fall haben wir unser Publikum ein Stück weit ausgetauscht. Deshalb war klar, dass die, die das Alte gewohnt waren und schön fanden, etwas verärgert sein würden. Von dem, was in der ersten Zeit so auf Facebook geschrieben wurde, habe ich mir aber fast nichts durchgelesen. Ich finde, nichts ist leichter, als mal eben auf Facebook einfach so seine Wut rauszulassen. Das muss ich mir einfach nicht antun.
»ZDF aspekte ist kein Wohlfühlmagazin, sondern eine Sendung, die auch wehtun muss. Das ist unser Anspruch. Die Welt ist eben nicht nur gut.«
Jonas:
Wenn man die Facebook-Timeline eurer Sendung durchscrollt, muss man an die Worte eures ehemaligen Moderationskollegen Tobi Schlegl denken, der im Vorfeld des „aspekte“-Neustarts angekündigt hatte: „aspekte soll eine wilde Mischung sein. Wir wollen anecken und die Leute mitreißen.“ Seid ihr dem Anspruch einer „wilden Mischung“ gerecht geworden? Tatsächlich gibt es in eurer Sendung nicht nur Begeisterndes, sondern auch viele ernsthafte, traurige und bestürzende Themen.
Jo:
„aspekte“ ist kein Wohlfühlmagazin, sondern eine Sendung, die auch wehtun muss. Das ist unser Anspruch – aber nicht, weil es uns Spaß macht, den Leuten wehzutun, sondern weil wir bestimmte Themen behandeln wollen, die dummerweise auch wehtun. Die Welt ist eben nicht nur gut.
Was die Frage angeht, ob sich Tobis Ankündigung eingelöst hat, ist es ganz interessant, mal die Facebook-Kommentare von damals etwas weiter zu verfolgen. In den ersten Tagen und Wochen gab es zwar die besagte Woge der Entrüstung, aber dann gab es auch viele Leute, die über zwei, drei Jahre drangeblieben sind und sich mit der Sendung mitentwickelt haben. Viele Zuschauer haben uns wissen lassen, dass sie am Anfang noch sehr skeptisch waren, aber mittlerweile die vielen Neuerungen – Künstler im Studio, Live-Gespräche, Live-Bands – richtig gut finden.
Beim Fernsehen dauert es ja immer lange. Es heißt, wenn man einen neuen Sender aufbauen will, dann braucht man sieben Jahre, bis irgendjemand mitbekommt, dass es den Sender überhaupt gibt. Das bedeutet: Wenn man eine Sendung umbaut, braucht man ebenfalls einige Jahre, bis die Leute das erstens überhaupt mitbekommen, zweitens das Konzept verstehen und drittens – im besten Fall – sagen: „Das finde ich gut“. Ich habe das Gefühl, das war bei uns auch so, daher sind wir eigentlich ganz guter Dinge und hoffnungsvoll für die Zukunft.
Jonas:
Wenn man auf die letzten zwei, drei Jahre zurückblickt, ist vor allem gesellschaftspolitisch viel passiert – nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt: Donald Trump, Brexit, Türkei, Flüchtlingskrise, AfD, NSU-Prozess, diverse Terroranschläge… man könnte die Liste beliebig weiterführen. Welchen Einfluss hat diese Häufung negativer Ereignisse und Entwicklungen auf eure Sendung?
Katty:
Diese Veränderungen haben insofern einen großen Einfluss auf uns, da wir sie in der Sendung natürlich widerspiegeln. Grundsätzlich ist es so, dass wir am Freitagabend genau das aufgreifen wollen, womit sich der Zuschauer die ganze Woche beschäftigt hat – wie alle Fernsehmacher wollen wir letztlich die Leute da abholen, wo sie gerade stehen. Und da wir unser Publikum so einschätzen, dass sie sich über all die gesellschaftlichen Umwälzungen und furchtbaren Dinge Gedanken machen, die gerade passieren, holen wir sie auch genau an diesen Punkten ab. Dementsprechend war und ist der Einfluss dieser Ereignisse auf uns gigantisch. „aspekte“ ist keine Sendung, die außerhalb der Realität funktioniert. Wir laufen nicht nur durchs Museum.
»Es geht uns darum, die Dinge verständlicher zu machen und einzuordnen. Vielleicht ist das so etwas wie ein kleiner Anker in einer schwierigen und instabilen Zeit.«
Jo:
Gigantisch ist der Einfluss dieser Ereignisse und Entwicklungen auch deshalb, weil sie uns auch selbst betreffen. Die gesamte Redaktion beschäftigt sich mit diesen Themen – nicht, weil sie irgendwo den journalistischen Auftrag dazu aufgeschrieben hätte, sondern weil wir alle Leute mit einem eigenen Kopf und einer eigenen Haltung sind. Daher ist es manchmal auch nicht so leicht, diesen Haufen zu händeln und zusammenzuhalten. (lacht)
Aber wir von „aspekte“ wissen auch: Es ist ein riesiges Privileg, sich durch diese Welt zu graben und damit sogar Geld verdienen zu dürfen. Das geht einher mit einer gewissen Verantwortung. Denn es geht uns ja auch darum, die Dinge verständlicher zu machen und einzuordnen. Vielleicht ist das so etwas wie ein kleiner Anker in einer schwierigen und instabilen Zeit. Vielleicht ist das ein kleiner Orientierungsfaden, an dem man sich festhalten kann. Das gelingt uns zwar nicht immer und bei jedem, aber manchmal klappt es.
Jonas:
Die Bewertungen, die die Zuschauer auf eurer Facebook-Seite hinterlassen, spalten sich in zwei große Lager: Auf der einen Seite gibt es Leute, die eure Sendung feiern und voll des Lobes sind, auf der anderen Seite gibt es die üblichen Trolle, die euch beschimpfen und euch beispielsweise vorwerfen, die Sendung in eine bestimmte politische Richtung zu schieben. Wie geht man mit solchen Kommentaren im Netz am besten um?
Jo:
„Don’t feed the troll“, das ist eine alte Social Media-Strategie. Wenn jemand rumpöbelt, ignorieren wir das. Aber wenn ein guter, sachlich begründeter Kommentar kommt, machen wir uns darüber natürlich Gedanken. Auf konstruktives Feedback muss man reagieren und antworten, dafür darf man nicht zu verbohrt sein.
Und davon abgesehen: Dass die Trollarmee aus einer gewissen politischen Richtung über das gesamte öffentlich-rechtliche Spektrum hinwegzieht, ist jetzt nichts Neues. Da muss man einfach mit einer gewissen Gelassenheit reagieren. Wir können uns nicht jede Kritik zu Herzen nehmen, weil wir dann nicht weiterarbeiten könnten.
Jonas:
Euer ZDF-Kollege Claus Kleber hat vor kurzem seine Streitschrift „Rettet die Wahrheit“ veröffentlicht, in der er ein flammendes Plädoyer für fundierten Journalismus und die Bedeutung der Öffentlich-Rechtlichen hält. Eurer Sendung kann man wohl am wenigsten vorwerfen, dass sie ihrem Bildungsauftrag nicht gerecht würde. Fühlt ihr euch nicht etwas an den Rand gedrängt, was euren Sendeplatz am späten Freitagabend angeht? Wäre es nicht wichtiger, eine Sendung wie „aspekte“ auf einen klassischen Sendeplatz um 20:15 Uhr zu schieben, statt dort Volksmusik oder Rosamunde Pilcher stattfinden zu lassen?
Katty:
Ich ahne tatsächlich, dass es in Deutschland wirklich viele Leute gibt, die sich gerne mit Themen unterhalten lassen, die nicht ganz so schwierig sind. Daher sind wir einfach keine 20:15 Uhr-Show, die Mehrheit würde sofort aus- oder umschalten. Viele Zuschauer wollen sich einfach vom Fernsehen berieseln lassen und dabei nicht groß nachdenken müssen – was ich übrigens vollkommen nachvollziehen kann und gar nicht so von oben herab meine. Wenn man einen langen und harten Arbeitstag hinter sich hat, dann will man fernsehen, um einfach abzuschalten. Und ich glaube, bei uns kann man nicht gut abschalten.
Ich finde aber, dass wir durchaus eine 22 Uhr-Sendung sind. Aber sowas von! 23 Uhr ist mir in jedem Fall zu spät. Ich persönlich würde um 23 Uhr auch nicht fernsehen. Alles, was mich interessiert und um 23 Uhr oder später läuft, schaue ich mir in der Mediathek an – Halleluja, dass es diese Möglichkeit gibt und man „aspekte“ online schauen kann! Bescheuerterweise werden diese Zahlen aber nicht großartig gemessen. Die Klicks werden zwar gezählt, fließen aber nicht in die Quote mit ein. Das ist ziemlich albern, da hinkt die Technik noch hinterher.
»Ich finde, dass wir durchaus eine 22 Uhr-Sendung sind. 23 Uhr ist mir in jedem Fall zu spät. Ich persönlich würde um 23 Uhr auch nicht fernsehen.«
Jonas:
Seid ihr überhaupt eine klassische Fernsehsendung? Oder ist „aspekte“ eher eine Mediathek-Sendung?
Jo:
Wir sind immer noch eher eine Fernsehsendung als eine Mediathek-Sendung. Allerdings kommt es auch auf den konkreten Inhalt an: Manchmal laufen einzelne Beiträge oder Interviews wirklich super auf Facebook. Aber die Gesamtanzahl an Zuschauern, also bei uns in der Regel knapp über eine Million, bekommt man in der Mediathek nicht hin – noch nicht. Ich bin davon überzeugt, dass es in zehn Jahren kein lineares Fernsehen mehr gibt. Dann kommt es nur noch darauf an, ob man als App auf die Startseite eines Smart-Bildschirms kommt oder nicht. So werden wir irgendwann sendeplatzunabhängig sein.
Jonas:
Das „aspekte“-Studio wirkt wie eine Art Wohnzimmer. Was bedeutet dieser Raum für euch?
Katty (grinst):
Wenn es mein Wohnzimmer wäre, hätte ich schöneres Sitzmobiliar. Und mein Tisch würde nicht so knarzen.
Jo:
Aber mein Sofa wäre genauso.
Katty:
Oh ja, das Sofa! Das wäre auch bei mir das gleiche. Was ich an meinem Job so toll finde, ist, dass er wirklich etwas Heimeliges hat. Nicht nur wegen des Wohnzimmers, auch weil wir ein sehr gutes, heterogenes Team sind. Wie Jo bereits gesagt hat: Unsere Redaktion ist durchaus streitbar, man rasselt da auch mal aneinander. Aber das ist total produktiv und man erfährt sehr viel Wertschätzung.
Immer wenn wir freitags im Studio aufschlagen, fühlt es sich an, als würde dort eine Clique zusammenkommen. Jo, ich und Tobi – der „aspekte“ 2016 verlassen hat – haben das Glück, dass wir uns alle sehr mögen, uns in vielen Dingen ähnlich sind und uns gut austauschen können. Es ist nicht geschleimt, wenn ich sage, dass ich mich jedes Mal auf Freitag freue, weil ich dort in einer schönen Atmosphäre arbeiten kann.
Jo:
Das stimmt, es ist schon immer schön freitags. Man kommt in seine Hood und fühlt sich sofort wohl, weil man einfach so sein kann, wie man ist.
Jonas:
In eurem Wohnzimmer gebt ihr auch Leuten eine Stimme, die sonst wo vielleicht nicht gehört würde, weil sie zu schwach ist oder in irgendeiner Form unterdrückt wird. So thematisiert ihr beispielsweise immer wieder die Inhaftierung von Deniz Yücel, lasst Can Dündar die Sendung moderieren oder ladet Menschen wie Yvonne Boulgarides ein, die Witwe eines NSU-Mordopfers. Geht aus diesem Wohnzimmer eine ganz bestimmte Form von Widerstand aus? Kann man in dieser Welt, die so aus den Fugen geraten ist, überhaupt irgendetwas ausrichten? Oder kommt man nicht immer wieder an einen Punkt, an dem alles aussichtslos erscheint und man sich dadurch ohnmächtig fühlt?
Katty:
Ich denke da im Kleinen. Ich glaube auch nicht, dass alles aussichtslos ist. Wenn wir beispielsweise Can Dündar in die Sendung holen und ihn bei uns sprechen lassen, bewirkt das vielleicht nichts Kolossales, aber etwas Kleines. Und das ist mehr als nichts.
Mit das Schlimmste, was der Mensch empfinden kann, ist das Gefühl von Ohnmacht: wenn nur noch schlechte Nachrichten auf einen einprasseln, man selbst inmitten dieser schlechten Welt steht und nichts tun kann. Ich persönlich empfinde es daher als ein riesiges Privileg, dass wir unseren Job dazu nutzen können, zwar nicht die Welt grundlegend zu verändern, aber das Kleine, was man tun kann, zu tun – weil gegen Ohnmacht nur Machen hilft. Und wir können machen, da auf dieser Plattform, die sich „aspekte“ nennt. Das finde ich toll.
»Wir können unseren Job dazu nutzen, zwar nicht die Welt grundlegend zu verändern, aber das Kleine, was man tun kann, zu tun – weil gegen Ohnmacht nur Machen hilft.«
Jo:
Was den Begriff Widerstand angeht, würde ich dir auch widersprechen, den finde ich in unserem Zusammenhang schwierig. Wir leisten keinen Widerstand, wir stellen dar – auf der einen Seite jene Stimmen, die vielleicht sonst nicht gehört werden könnten, und auf der anderen Seite viele Themen, die auch positiv sind. Da geht mir wirklich das Herz auf! Sei es ein toller Musiker, eine tolle Ausstellung oder ein guter Film: Uns wird jede Woche aufs Neue gezeigt, dass die Welt ganz schön viel kann – dass der Mensch ganz schön viel kann. Und dass es selbst in den schwierigsten Zeiten, in denen beispielsweise ein Donald Trump an der Macht ist, viele wundervolle Dinge gibt, die sich in ihren positiven Bahnen immer weiterentwickeln. Daher muss man mit uns auch am Freitagabend nicht heulend zu Hause sitzen.
Katty:
Und das ist ein wirkliches Gegengewicht. Ich erinnere mich beispielsweise an den Film „Weit“, den wir vorgestellt haben – in einer Situation, wo gerade alles einfach furchtbar war. Wir haben uns dann entschieden, den Beitrag direkt an den Anfang der Sendung zu setzen, damit die Leute auch mal ein bisschen durchatmen können. Über die guten Dinge wird ja, wie wir alle wissen, leider viel zu selten berichtet. In der Regel überwiegen die schlechten Themen und verankern sich dementsprechend auch im Kopf.
Jo:
Gelegentlich erhalten wir auch das Feedback von Zuschauern, dass sie selbst Beiträgen über Krieg, Verfolgung oder Unterdrückung etwas Positives abgewinnen können, da sie sich dadurch ermutigt fühlen, weiterhin ihre Stimme zu erheben und mitzusprechen. Da geht es nicht um eine politische Richtung oder Widerstand, sondern ganz einfach darum, im Rahmen unserer Sendung sichtbar zu machen, was für ein riesiges Potenzial an so vielen Ecken der Welt schlummert.
Katty:
Und was noch in jedem Einzelnen schlummert.
Jonas:
Im November 2017 hattet ihr Yvonne Boulgarides zu Gast in der Sendung, deren Mann vor zwölf Jahren vom NSU ermordet wurde. Wie gelingt es euch, für Menschen wie Frau Boulgarides die erforderliche Empathie und Sensibilität aufzubringen und gleichzeitig eine gewisse Distanz zu wahren, um solche bedrückenden Themen nicht mit nach Hause zu nehmen?
Katty:
Ich schaffe das leider nicht so oft – ich nehme wirklich viele Themen mit nach Hause, da bin ich ganz ehrlich. Aber es würde mir schlechter gehen, wenn ich mich dem Ganzen gegenüber ohnmächtig fühlen würde. Das bin ich aber nicht, denn dadurch, dass ich sie interviewt habe und sie bei uns sprechen konnte, konnte ich wenigstens ein bisschen was tun. Frau Boulgarides, die vorher nie in einer Talkshow war, hat uns im Nachhinein gesagt, dass ihr dieses Gespräch sehr gutgetan hätte und dass sie sich in dem Moment, als sie sich vor der Kamera geäußert hat, sehr sicher bei uns gefühlt hätte. Das war das schönste Kompliment, das sie uns machen konnte – und das habe ich ebenfalls mit nach Hause genommen.
»Einen gewissen professionellen Schutzanzug müssen wir uns anziehen, da wir jede Woche aufs Neue in menschlichen Morast einsteigen – und einsteigen wollen.«
Jo:
Ich glaube, einen gewissen professionellen Schutzanzug müssen wir uns auch anziehen, da wir jede Woche aufs Neue auch in menschlichen Morast einsteigen – und einsteigen wollen. Allerdings empfinde ich es auch als ein Privileg, dass wir uns in solche Themen hineinrecherchieren dürfen. Das ist ein toller Bestandteil unseres Jobs. Aber wenn man sich jeden Schuh selbst anzieht, dann würde man irgendwann untergehen, das geht einfach nicht. Ohnehin darf man sich als Journalist weder mit der guten noch mit der schlechten Sache gemein machen. Man muss immer eine gewisse Objektivität bewahren, auch wenn man mit einem schlimmen Schicksal konfrontiert wurde. Da darf man nicht traurig sein, sondern muss damit klarkommen. Und weiterarbeiten.
Katty:
So ist nun mal das Leben – auch wenn sich das wie eine Plattitüde anhört: Es ist leider Fakt. Das, was Frau Boulgarides passiert ist, hätte uns allen passieren können. Das muss man sich immer wieder klarmachen. Da hilft es nichts, zu Hause zu sitzen und zu beklagen, dass die Welt schlecht ist. Ja, das ist sie auch, zumindest in Teilen. Aber damit muss man sich arrangieren und überlegen, wie man selbst dazu beitragen kann, dass die Welt ein wenig besser wird.
Jonas:
Im September 2016 hat euer Kollege Tobi Schlegl „aspekte“ verlassen und seine TV-Karriere beendet, um eine Ausbildung zum Notfallsanitäter zu beginnen. Wie habt ihr seine Entscheidung damals aufgenommen und empfunden?
Katty:
Für mich war dieser Schritt absolut nachvollziehbar. Tobi ist ein totaler Weltverbesserer, das war er immer schon. Aber seit er 17 ist, hat er nie etwas anderes gemacht als Fernsehen, und das in den verschiedensten Formen. Während Jo und ich studiert haben, anschließend mal ein Praktikum hier und ein Praktikum da hatten und wir danach wieder irgendwo anders reingestolpert und schließlich bei „aspekte“ gelandet sind, war er durchgehend der TV-Tobi. Er wollte für sich nochmal ein neues Kapitel aufschlagen. Dabei fand er nicht nur die Ausbildung zum Notfallsanitäter spannend – er wollte auch ganz grundsätzlich mal die Erfahrung machen, von jemandem ausgebildet zu werden.
Außerdem war Tobi bewusst, dass „aspekte“ eine kleine Insel ist, auf der es uns allen sehr gut geht. Wir, die wir im Kulturbereich arbeiten, sind ja in besonderer Form gepämpert. Wir haben das große Glück, dass wir uns genau mit den Themen beschäftigen dürfen, die uns auch persönlich am allermeisten berühren. Zumindest ist es bei mir so – ich brenne dafür, was ich bei „aspekte“ tue.
Als Tobi bekannt gegeben hat, dass er seine TV-Karriere beendet und Notfallsanitäter wird, haben ihm das viele nicht abgenommen. Die Reaktionen reichten von „Spinnst Du?“ bis „Haha, guter Scherz!“. Ich persönlich habe sofort gewusst, dass er das todernst meint und felsenfest hinter seiner Entscheidung steht. Ich finde es auch immer noch super. Es gibt immer noch Leute, die fragen: „Na, hat er schon geschmissen?“ Nein, hat er natürlich nicht! Der zieht das durch, weil er so ist wie er ist. Das finde ich superlässig. Und es geht ihm gut dabei.
»Tobi Schlegl hat gemerkt, dass so eine Ausbildung zum Notfallsanitäter etwas anderes ist als Fernsehmoderator. Ich glaube aber, dass er genau diese Erfahrung auch gesucht hat.«
Jo:
Ja, es geht ihm gut. Aber er hat auch gemerkt, dass so eine Ausbildung zum Notfallsanitäter etwas anderes ist als Fernsehmoderator – und zwar in allen Belangen, sowohl was die Arbeitszeiten als auch das Gehalt angeht. Für ihn hat sich alles geändert: Schichtarbeit ist etwas anderes, als im Studio rumzuhampeln wie wir. Ich glaube aber, dass er genau diese Erfahrung auch gesucht hat. Von daher hat er für sich offenbar alles richtiggemacht.
Jonas:
Katty, du bist in Salzgitter aufgewachsen. Auf deiner Website schreibst du: „If you make it there, you can make it anywhere.“ Jo, du kommst aus einem 13.000-Einwohner-Ort namens Lorsch…
Jo:
…Kaff. Nee, Stadt. Wir haben Stadtrechte.
Jonas:
Was haben euch diese Orte für euren Werdegang mitgegeben?
Jo:
Demut. Ungelogen! Das ist jetzt keine Lobhudelei auf das schöne Städtchen Lorsch, aber es hat mir in meiner Kindheit und Jugend sehr viele Erfahrungen mitgegeben, die ich als sehr positiv in Erinnerung habe, die mich geprägt haben. Ich bin dort mit den unterschiedlichsten Leuten in Berührung gekommen und habe beispielsweise als kleiner Junge im Zeltlager jonglieren und Gitarre spielen gelernt. (lacht)
Darüber hinaus meine ich mit Demut, dass es durchaus hilfreich ist, wenn der prototypische Berliner Kulturjournalist eine Ahnung hat, wie es außerhalb seiner eigenen Blase aussieht. Man muss immer wissen, wo man herkommt. Wenn man das nicht vergisst, hat man es besser, auch gerade in Berlin. Deswegen: Demut vor dem Leben! Und unterschiedliche Menschen kennenlernen. Das ist schon sehr hilfreich.
»Hässlichkeit ist mir egal, ich kann auch im Hässlichen etwas Schönes sehen. Ich brauche nicht diesen ganzen Chichi-Kram um mich herum, um mich wohlzufühlen.«
Katty:
Bei mir ist es Offenheit. Ich bin in Salzgitter groß geworden und habe lange nicht gesehen, was für eine schön-hässliche Stadt das ist. Als ich studiert habe – im nur unwesentlich hübscheren Paderborn, ich bin durch die ZVS sozusagen vom Regen in die Traufe gekommen –, bin ich mal mit meinen Studienfreundinnen, sprich als noch Züge in Salzgitter hielten, von Paderborn nach Salzgitter gefahren. Als wir ausgestiegen sind, haben die Mädels, die alle aus dem schönen Sauerland kamen, nach oben geschaut und gesagt: „Oh weia, ist ja wie im Osten! Nur Plattenbauten hier!“ In dem Moment – ich war bereits 19 Jahre alt – habe ich zum ersten Mal selbst wirklich bewusst nach oben geschaut und gesagt: „Stimmt, hübsch ist es hier nicht.“ Was will ich damit sagen? Ich lebe jetzt in Köln und viele Leute verteufeln die Stadt als architektonisch hässlich. Das lässt sich faktisch nicht von der Hand weisen, tatsächlich gibt viele Bausünden hier. Aber ich sehe das gar nicht, ich bin da total offen. Hässlichkeit ist mir egal, ich kann auch im Hässlichen etwas Schönes sehen. Ich brauche nicht diesen ganzen Chichi-Kram um mich herum, um mich wohlzufühlen. Das macht mich total froh. Ich brauche auch nicht zwingend eine Großstadt um mich herum.
Jo:
…ich schon eher. Ich wohne gerne in der Stadt.
Jonas:
Ihr habt beide in eurer Karriere viel Radio gemacht, daher unterstelle ich euch mal, dass Musik ein wesentlicher Bestandteil eures Lebens ist. Am Ende eurer Sendung gibt es immer wahnsinnig schöne Musik – darunter nicht nur bekannte Bands, sondern auch Neuentdeckungen. Wer wählt bei „aspekte“ aus, welche Acts in die Sendung eingeladen werden?
Katty:
Wir haben eine wirklich starke Autorenredaktion, was im Übrigen unsere Sendung auch von anderen Kultursendungen unterscheidet. Unsere Redakteurinnen und Redakteure ziehen aus, um ihre Themen selbst zu recherchieren, ihre Beiträge zu drehen und damit die Sendung bestücken. Das ist immer noch etwas Besonderes. Was unsere Gäste und insbesondere die Bands angeht, überlegen wir alle gemeinsam, wer kommen könnte, wer gerade super ist und wen wir dringend mal haben wollen. Dann wird das alles in einen Topf geworfen und von der Redaktion ausgewählt. Wir selbst können uns da natürlich auch mit Vorschlägen beteiligen, aber am Ende entscheidet die Redaktion.
Jo:
Und das allerletzte Wort hat der Chef, der besagte Daniel Fiedler, der in der Regel auch ganz gut entscheidet…
beide lachen
Jonas:
Katty, ich habe in einem Interview gelesen, dass du gar nicht unbedingt wollen würdest, dass die Band Radiohead bei „aspekte“ auftreten würde, weil du dann einen Klos im Hals hättest. Hat sich das mittlerweile gebessert?
Katty:
Nein, das würde ich immer noch nicht wollen. Ich bin jemand, der immer noch einen gewissen Respekt vor Personen hat, die ich persönlich unfassbar toll finde. Bei diesen Personen hätte ich ehrlich gesagt etwas Angst, dass meine journalistische Objektivität flöten geht. Und bei Radiohead wäre das genau der Fall. Außerdem würde ich Tom York auch deshalb nicht unbedingt treffen und kennenlernen wollen, weil ich gar nicht wissen will, wie er wirklich ist. Er soll nach wie vor mein Einhorn-Fabelwesen bleiben – so wie ich mir vorstelle, wie er ist.
Wir hatten mal Tori Amos im Studio, da war ich aufgeregt bis zum Abwinken – die ist sozusagen mein weiblicher Tom York. Als klar war, dass Tori bei uns sein würde, bin ich tausend Tode gestorben, vor allem als ich gehört habe, dass ich auch noch das Interview führen soll. Auf der einen Seite war das ein Geschenk, auf der anderen Seite hatte ich echt Bammel. Tori hätte vielleicht ja auch ein echter Kotzbrocken sein können – dann wäre die gesamte Musik für mich dementsprechend gelabelt gewesen. Aber was war am Ende? Sie war der sonnigste, netteste Mensch auf Erden.
In der Sendung konnte ich leider nicht verhehlen, dass ich Tori Amos ziemlich toll finde. Natürlich sind wir Journalisten, natürlich sind wir an sich objektiv und machen uns nicht gemein, aber ich bin auch ganz ehrlich: In manchen Bereichen ist es echt schwer, da die Grenze nicht zu übertreten. Ich finde, in einem solchen Fall muss man offen dazu stehen und betonen: „Ich persönlich höre auch gerne Tori Amos.“ Alles andere wäre Schauspielerei. Aber wir sind keine Schauspieler.
Jo:
Wir laden ja in der Regel niemanden ein, den wir kacke finden. Es wäre auch sinnlos, wenn man als Moderator sagen würde: „Ich finde zwar Casper echt doof, aber der ist halt nun mal da, jetzt frage ich ihn irgendwas.“ Ganz im Gegenteil: Es ist von Vorteil, wenn man weiß, wie die jeweilige Musik funktioniert und eine Ahnung davon hat, was popkulturell gerade los ist. Für einen Journalisten ist es ein riesiger Vorteil, wenn er auch privat auf Konzerte geht und dadurch mitreden und vielleicht auch ein paar Detailfragen stellen kann, die über „Spielst du eigentlich lieber in kleinen Clubs oder in großen Hallen?“ hinausgehen.
»Nach meinem Interview mit Smudo war meine Ehrfurcht ziemlich weggebröckelt. Und als ich etwas später noch die Ärzte interviewen durfte, war klar: Jetzt kann ich eigentlich sterben.«
Jonas:
Jo, gibt es auch bei dir eine Band, bei der dir die Knie schlottern würden, wenn sie bei „aspekte“ auftreten würde?
Jo:
Nein, ich glaube, die gibt es nicht mehr. Ich war seit jeher wahnsinnig großer Fan der Fantastischen Vier. Lustigerweise hatte ich gleich das allererste Musikerinterview, das ich jemals führen durfte, mit Smudo – damals war ich Praktikant beim Radio und hatte richtig Angst vor der möglichen Götterdämmerung. Als das Interview vorbei war, war zwar der Respekt für die Band und die Liebe zur Musik noch da, aber meine Ehrfurcht war ziemlich weggebröckelt. Sie kam nie wieder zurück. Und als ich etwas später noch die Ärzte interviewen durfte, war klar: Jetzt kann ich eigentlich sterben.
Jonas:
Eure Sendung gibt es mittlerweile seit über 50 Jahren und ist dementsprechend ein Begriff in der deutschen Fernsehlandschaft. Wie würdet ihr jemandem, der noch nie mit dem Format in Berührung gekommen ist, erklären, was „aspekte“ ist?
Katty:
Wir sind eine Kultursendung, würde ich sagen.
Jo:
Wie hat es Tobi Schlegl ausgedrückt? Eine „wilde Mischung, die anecken und die Leute mitreißen soll“? Genau das ist es, mit einem starken gesellschaftspolitischen Einschlag. Wir sind keine Kultur-Tipp-Sendung, die den Leuten empfiehlt: „Gehen sie mal in diese Ausstellung und lesen sie dieses Buch!“ Das machen wir zwar gelegentlich auch, aber wir haben ebenso den Anspruch, gesellschaftspolitisch relevant zu sein.
Katty:
Und was uns wirklich von anderen unterscheidet, ist die Form unserer Sendung.
Jo:
Stimmt. Wir haben Studiopublikum, wir haben eine Live-Band, wir haben Live-Gäste und wir haben Beiträge.
Jonas:
Und ihr habt ein Wohnzimmer.
Jo:
Oh ja, mit einer Couch. Das war, glaube ich, auch mal die Aussage einer Pressemitteilung vor vier Jahren: Kultur erlebbar zu machen. Und daran arbeiten wir uns ab – in unserem Wohnzimmer.
aspekte – Die Kultursendung im ZDF
zdf.de/kultur/aspekte
facebook.com/aspekte.kultur
twitter.com/zdfaspekte
Fotos: Steven Lüdtke
Hair & Make-up: Jula Hoepfner
Heath Kane
Submission — Heath Kane
When The Revolution Starts
12. Februar 2018 — MYP N° 22 »Resistance« — Text & Illustrations: Heath Kane
When The Revolution Starts
2017
„When The Revolution Starts“ was inspired by „Liberty Leading The People“ by Eugène Delacroix—a classical painting depicting the French Revolution. In the original, the main character is bare breasted, stripped of her dignity, but defiant. All around her are corpses. The message is that she would rather die than give in. We live in a time when again people are taking to the streets. They seem defiant, angry. But would they really die for the cause? Or has protest become a new form of entertainment?
This work was done in collaboration with US artist Todd Kale.
Masks Of Fear
2016
„Masks Of Fear“ is a collection exploring the theme of an emerging new political world order.
I am keen to explore and understand how such prominent world leaders—who are supposedly appointed to represent their people—can become so biased and blase. And what it is that is driving their campaigns of fear? This is the question that drove these darkly satirical pop-art portraits.
The collection conveys Trump’s xenophobic traits against Mexicans and other targeted ethnic groups, Kim Jung-un’s deep resentment for Western society, Putin’s views on the LGBT community, and the infamous Pussy Riot movement.
The introduction of masks is a way to show their xenophobic and seemingly sadistic traits. The use of neon colours was used to draw people closer—once close, you begin to see hints of metallic gold that remind us of their wealth and power.
With a flood of people becoming engaged with politics in 2016, „Masks Of Fear“ is not just intended as a Zeitgeist piece, but a talking piece that hopefully will not only one day be a snapshot of a moment in history, but will help shape it.
Where Have The Natives Gone
2017
London was always a melting pot. Generations of people who added richness and diversity. Today though as more and more luxury blocks go up the streets are empty. Locals are being forced off their land. The real immigration problem isn’t people, it’s money. Where have all the natives gone?
Heath Kane is a 45-year-old artist living in London.
Kat Frankie
Interview — Kat Frankie
Being Obnoxious
With her new record, singer-songwriter Kat Frankie doesn’t want to sound melancholic anymore, but rather happy and obnoxious. In our interview, she tells us why she plays the role of a referee in a music video, how come the story of an amateur cage-fighter inspired her to write a song and why she doesn’t like to publish her lyrics.
30. Januar 2018 — MYP N° 22 »Resistance« — Interview: Jonas Meyer, Photography: Steven Lüdtke
It’s one of those days when you’re reminded how bad the combination of winter and Berlin actually is. Grey skies up above, wet ground down below—the freezing cold right in between. So many better places to be at the moment—like Australia for example.
Kat Frankie, born and raised in Sydney, actually did chose Berlin though and voluntarily stays here. In fact this year marks her 14th winter in Berlin. The singer-songwriter left her homeland in 2004 and has since been making a name for herself here. Not only has she released three albums, Kat has also dedicated her time to various successful side projects. Throughout the years, Kat Frankie has collaborated with different notable personalities of the German music scene such as Olli Schulz, for whom she played the guitar, or Get Well Soon aka. Konstantin Gropper, with whom she composed the soundtrack for the talk show „Schulz und Böhmermann“. She also sang a duet with Clueso and co-founded—with Chris Klopfer—the music project Keøma that took part in the 2016 preliminaries of the Eurovision Song Contest.
This February, Kat Frankie’s fourth album is about to be released and it is titled “Bad Behaviour”. She tells us that this time around, she didn’t want her record to sound so melancholic and instead went for more of a happy and “obnoxious” sound. What exactly she means by that is among the questions we asked her when we met Kat for our interview in the HKW, the Haus der Kulturen der Welt in Berlin.
Jonas:
A couple of weeks ago, you released the single “Bad Behaviour” one of ten songs on your new record. For you, this track isn’t completely new—you’ve been carrying it with you for quite a while. How did the song come to you and how did it grow up?
Kat:
A long time ago, I behaved pretty badly, which made me feel awful and so I wanted to write a song about it. I think it took such a long time to create the song—and the new album for that matter—because I’ve constantly been doing other things on the side: I have another band called Keøma, and was also playing guitar for Olli Schulz, along with other stuff too. So this song has just been with me for a while. But I did always know it would be the first song on the new album. I really like pop songs with darker lyrics. There’s a song “Walking On Broken Glass” by Annie Lennox that is a really happy pop song, but the lyrics are quite dark. She has this line “I’m living in an empty room / With all the windows smashed” and you think: Holy shit, that’s heavy! So for me, the thing I like about “Bad Behaviour” is that it actually sounds like a pop song, but the lyrics are quite aggressive.
Jonas:
What makes this song so personal and so profound for you?
Kat (considers for a moment):
I mean every song of mine—even if it’s not about me—is obviously a little autobiographical. When you write music, you add your perspective, you add your ideas. And once you express an idea, you’re putting yourself into it, just because it’s you who’s making it. Sure, you can write stories about other people, but you also have to choose how you tell that story. And that’s where the connection with the artist comes in. But “Bad Behaviour” is just a classic “being-badly-behaved-in-a-relationship” kind of song.
»In relationships, it’s all fun and games until someone gets hurt.«
Jonas:
“Relationship” is a good keyword: The music video for “Bad Behaviour” shows different couples in a boxing ring, fighting each other with pillows. During the first seconds of the clip, we can see you playing the role of the referee. Are you explaining the rules of relationships—the rules of how to deal with each other?
Kat (laughs loud):
A little bit, yeah. I mean that’s the idea of the video. It’s a metaphor, obviously, for relationships: In relationships, it’s all fun and games until someone gets hurt. And yes, I guess I have more of a referee role in the video, trying to get the fighters to play fairly.
Jonas:
I think we have something in common: In 2011, I met music artist Chris Klopfer. I saw him playing in a small bar in Neukölln and after his concert, I asked him if he could imagine contributing to our magazine with a self-written article because I liked his music so much. I heard you met him in 2011, as well. Together you guys founded this common music project called Keøma, which you’ve talked about. How does making music with Chris work?
Kat:
Working with Chris is very easy. He’s the ideas’ man, he’s filled with lots of little hooks and concepts. Keøma started when Chris asked me to help him finish a song he was working on. We just recorded it at my house and it was all so easy. After that, he asked me: “Can you also help me work on another song?” And that went really well too. And then there was a third song and a fourth. And another. A year and a half later, we had an album. It was the first time I had really collaborated with someone. I’d been a solo singer-songwriter for so many years before then, and suddenly there was a chance to work with somebody else, to produce music that wasn’t the music I usually put out. It really was a chance to play around, to experiment and to not take anything too seriously—to just see what happens. And what happened was that we ended up with a really nice album.
Jonas:
I remember Chris’ concert in that tiny bar in Neukölln very well. There were a couple of rude people, being noisy, making fun of the lyrics. Then Chris jumped on a chair and an older guy started laughing at him. I thought: What a prick, just be quiet! Have you experienced similar situations when you’ve played concerts in bars and tiny clubs, especially during your first few months in Berlin?
Kat:
I have to disappoint you. I think I had it really easy when I came to Berlin. I was very lucky because I found a nice community here that was really, really open to outsiders and very helpful. I actually played in a lot of cafes and a lot of bars for many years when I first came here, but I never had to fight with rude people for attention. Everyone was very supportive in Berlin, which is why I kept going, and which is why I still live here—It’s still such a supportive environment for me.
»Nobody really chooses or prefers to play in cafes. You’re competing with the coffee machine, you’re competing with the waiter, you’re competing with the door.«
Jonas:
Are small bars and cafes the best environment for singer-songwriter music? For me, your music feels very “nahbar” as we say in German, and small bars and cafes can mostly offer a suitable intimate space for that.
Kat:
To be honest: Nobody really chooses or prefers to play in cafes. You’re competing with the coffee machine, you’re competing with the waiter, you’re competing with the door that opens and closes every second… it’s tough! Every singer-songwriter who’s starting out and spends years in that world is trying to get more attention and is trying to play for more than 20 people. In one sense it’s lovely to have the intimacy, but it’s also kind of limiting because it only allows one kind of performance. The specific cafe environment is more for a quiet, intimate, almost melancholic kind of music. But if you want to explore different kinds of music, it doesn’t really work there. I mean no rapper ever did his time performing in cafes. It’s really something that is kind of a singer-songwriter cliché. I like playing for bigger crowds and, by the way, I’m not so good with eye contact. So cafes are just something that is necessary.
Jonas:
In the last few years, you’ve worked with a lot of different wonderful music artists. What comes to your mind when you think of Olli Schulz for example?
Kat (smiles):
Olli Schulz has no filter, that’s what makes him great—and what makes people love or hate him. He’s crazy and chaotic, and there’s part of me that admires a man who can just say what he thinks without considering the consequences. It’s really fun to hang out with Olli.
Jonas:
And when you think of Francesco Wilking?
Kat:
Oh Francesco! He’s just a beautiful lyricist, I would say the best in Germany—put me on the record for that! Francesco is like a classic sensitive tough guy and incredibly talented. I love him.
Jonas:
Get Well Soon aka. Konstantin Gropper?
Kat:
Konstantin Gropper is very funny and quite dry, he’s got a very good sense of humor. And he wears suits everywhere, I really like that.
Jonas:
Clueso?
Kat:
Clueso is also quite special. How do I describe Clueso? When I met him, I was expecting a “classic-mainstream-pop-studio” kind of guy—and what I discovered was someone who is constantly creating, constantly writing, and constantly trying to make better music. I was quite surprised by that. He’s actually a really hard worker. And he’s a good live-performer, who knows how to entertain 3.000 people.
»I was singing before I could talk.«
Jonas:
And Kat Frankie—the person that sings with you in some of your songs?
Kat (laughs loud):
Kat Frankie probably is a bit extreme and over the top at times… for some people. She likes drama in her music and tries not to be afraid to express that.
Jonas:
Since you were a little kid, the technique of using a loop machine and multiplying your own voice has been a way to make music. Would you say you’re completely familiar with your own voice? Or does it happen from time to time that this voice still surprises you?
Kat:
The funny thing about singing is that it doesn’t come from your throat, it comes from your body. Your head resonates, your body resonates, it’s a very physical sensation—I think people forget that singing is very much a physical activity. I know my voice like people know their right hand. I don’t have much more to say about that, there’s nothing that surprises me. I was singing before I could talk.
Jonas:
In 2016, you said: “People that write sad songs are a little happier.”
Kat:
Yeah, that’s true.
Jonas:
And in the press kit I got for the interview, you say that with your new record “Bad Behaviour”, you didn’t want to be so melancholic anymore…
Kat (laughs):
So I’ve become more depressed—is that what you want to say?
Jonas:
No, I hope not! But what is the reason behind this decision?
Kat:
I spent a lot of time being a very… (disguising her voice) “ernsthafte” musician.
Jonas:
A very German word.
»This melancholy thing, I’ve just done it too much. Creativity isn’t about repetition; creativity’s about challenging yourself.«
Kat:
Yes, “ernsthaft”! And “authentisch” and “melancholisch”. But I feel like it’s too easy to be melancholic. For me, it’s much harder—incredibly hard—to write a happy song because happy songs often sound superficial and kind of meaningless. That’s something I’m still working on. This melancholy thing, I’ve just done it too much. In my opinion, creativity isn’t about repetition; creativity’s about challenging yourself. And by the way, I just had happier things to say and I felt a bit more confident with that this time around.
Jonas:
To describe your new record, you use a very interesting word: Obnoxious.
Kat:
Oh, that’s my favorite word!
Jonas:
What makes this album obnoxious?
Kat:
There’s a song on it, “Headed For The Reaper”, that goes: (imitating trumpets)… That’s what obnoxious is about: This attitude of “I don’t care if it’s nasty, I gonna do it anyway.”
Jonas:
It’s hard to find a German translation of this word.
Kat:
It’s impossible! I wish there was one.
Jonas:
Maybe “anstößig”?
Kat:
Hmm, I don’t know. You can interpret it as kind of being a jerk, but it’s not really being a jerk, it’s more like having an intention. It’s a tricky word. Sorry.
Jonas:
“Headed For The Reaper” goes back to a story, which you read in the New York Times years ago. It’s about an amateur cage-fighter who owed drug money, faked his death and then bungled a robbery. Why did you feel the need to make a song out of this?
Kat:
Because it was such an amazing story of the oddest stupidity—it was so beautiful! And, I think I just really loved the detail of him being called “tomato can” because he was so bad at cage-fighting. It made me so happy to read that. And I loved that the story was so dark, I just had to write about it.
Jonas:
Sounds like a perfect topic for Olli Schulz’ funny “Big Five” rankings on his Fest & Flauschig podcast on Spotify: “The big five stories of oddest stupidity”.
Kat:
It’s true, actually!
»So much nasty shit has been happening, so I had to express that. I don’t usually write things about politics or society, but it’s got to come out somehow.«
Jonas:
There’s another song on your new record called “Home”. It’s an up-tempo track and full of energy. Apparently, you wrote this song because you were very angry? What kind of anger was it?
Kat (groans):
Well, I think I was having a bad week. I was reading the news and I was just getting very hateful. There were the “Black Lives Matter” protests happening in the U.S., there was the gay marriage debate in Germany—a debate that we also had in Australia—with very hurtful and offending comments and unpleasant discussions. I just thought: So much nasty shit has been happening! And it’s still happening right now. So I had to express that and I feel like it comes down to people that want to control the lives of others because they’re scared. I don’t usually write things about politics or society, but I’m a songwriter and it’s got to come out somehow. And the new record is how it came out.
Jonas:
You have the habit of not publishing your lyrics. Is there a special reason for that?
Kat:
I think that once lyrics are published as a text, they are no longer part of the song. I like the idea that words and music exist together as sound waves and that this is the only way you can experience a song. And I also like that, when people listen to songs and they don’t know the words, they make different connections in their heads or they invent new words that aren’t actually the correct ones. In this case, you’re interacting much more with a song than if I told you the correct words. When you remove the text from a song, I think it would become more of a two-way-interaction with the music. Honestly, if I wanted to publish text, I would write poetry—and I wouldn’t put it with a song. But combining the two, that’s what musicians do.
Hair & make-up: Natalia Soboleva
1000 GESTALTEN
Interview — 1000 GESTALTEN
Politik von unten nach oben
„Die 1000 GESTALTEN sollen eine Gesellschaft verkörpern, der das Gefühl dafür abhanden gekommen ist, dass auch eine andere Welt möglich ist“, heißt es im Pressetext zu dieser besonderen G20-Protestaktion, die im Juli 2017 in Hamburg stattfand. Im Gespräch erklären drei der Initiatoren, wie genau diese andere Welt aussehen könnte und was ihrer Meinung nach in unserer Gesellschaft so richtig schief läuft.
29. Januar 2018 — MYP N° 22 »Widerstand« — Interview: Jonas Meyer
Der Hamburger Buchardplatz am 5. Juli 2017, es ist kurz vor halb zwei mittags. Wo vor wenigen Minuten noch Alltag war, liegt nun ein metallisches Klicken in der Luft. Erst hat es sich leise und kaum wahrnehmbar in die Ohren der Passanten geschlichen, dann wurde es immer deutlicher. Das sonderbare Geräusch wird erzeugt von hunderten Gestalten, die sich dem Platz von allen Seiten nähern – grau gekleidet und von Kopf bis Fuß mit Lehm beschmiert. Quälend langsam und fast wie in Zeitlupe bewegen sich diese Wesen vorwärts, ihr Blick ist leer, die Gesichter regungslos. In ihren Händen halten sie jeweils eine kleine Metallbüchse versteckt, die der Auslöser des unentwegten Klickens ist.
Immer mehr Gestalten tauchen in den Zufahrtstraßen auf und schleppen sich apathisch in Richtung Buchardplatz – geschlagene 90 Minuten dauert es, bis alle ihr Ziel erreicht haben. Die Passanten wiederum scheinen nicht so recht zu wissen, wie sie reagieren sollen, viele zücken ihre Handys und fangen an zu filmen.
Einige Augenblicke später. Langsam und fast zaghaft beginnt eine der Gestalten, ihr eigenes Gesicht zu ertasten, dann reißt sie plötzlich – begleitet von einem lauten Schrei – die Hände in die Luft. Kurz darauf quält sie sich aus ihrer Jacke, schmettert sie zu Boden und reißt mit voller Kraft ihr Hemd auf: Ein knallblaues Unterhemd kommt zum Vorschein.
Nach einer kurzen Pose der Befreiung bewegt sich die Gestalt auf eine zweite zu und motiviert sie ebenfalls, sich aus ihrer grauen Uniform zu befreien, unter der sie – wie kurz darauf zu sehen ist – ein hellgrünes T-Shirt trägt. So befreien sich nach und nach immer mehr Gestalten aus ihrer grauen Kleidung, tanzen herum und umarmen sich. Die fröhlichsten Menschen in den buntesten Farben bevölkern nun den Buchardplatz, über ihnen schwebt eine graue Wolke aus Lehm, die sich langsam auflöst.
Was die Zuschauer hier gerade erleben konnten, ist eine Performance, die den Titel 1000 GESTALTEN trägt und sich als Protestaktion gegen den bevorstehenden G20-Gipfel in Hamburg richtet. Dass diese Aktion überhaupt möglich wurde, ist dem Engagement von über tausend Freiwilligen zu verdanken, die dafür nicht nur aus den unterschiedlichsten Gegenden angereist sind, sondern auch aus den verschiedensten Bereichen der Gesellschaft stammen.
Erdacht, geplant und organisiert wurde die Protestaktion von einem Kollektiv, das sich Anfang 2017 speziell zu diesem Zweck gebildet hatte und mittlerweile aus mehr als hundert Menschen besteht. Drei der Mitglieder sind Gudrun Schoppe, Johannes Naber und Oli Bigalke. Im November treffen wir sie in Berlin zum Interview, um über unsere Gesellschaft zu reden – wie sie ist und wie sie sein könnte.
Jonas:
Am 5. Juli 2017 fand eure „1000 GESTALTEN“-Performance in Hamburg statt, etwa ein halbes Jahr vorher habt ihr mit den Planungen begonnen. Welches Résumé könnt ihr nach diesem bewegenden Jahr 2017 ziehen?
Johannes:
Man muss unterscheiden zwischen dem persönlichen Résumé, das für jeden von uns wahrscheinlich etwas anders ausfällt, und dem Résumé, das wir als Kollektiv ziehen – und das in diesem Zusammenhang wesentlich interessanter ist. Zusammengefasst kann man sagen, dass wir alle immer noch sehr überrascht und erstaunt sind, weil wir im Prinzip alles erreicht haben, was wir uns als Gruppe vorgenommen hatten.
Jonas:
Was genau hattet ihr euch denn vorgenommen?
Gudrun:
Ende 2016, Anfang 2017 haben wir – damals noch in einer eher kleinen Gruppe – bei verschiedenen Anlässen immer wieder darüber diskutiert, was uns gerade politisch und gesellschaftlich umtreibt. Wir alle hatten das Bedürfnis, unsere persönlichen Kontexte in irgendeiner Form nach außen zu stellen, um darauf aufmerksam zu machen, wie wir leben wollen und wofür wir einstehen wollen. Wir haben uns immer intensiver mit diesem Gedanken beschäftigt und dann recherchiert, welche Formen des Protests es überhaupt gibt und was in dem Zusammenhang zum anstehenden G20-Gipfel in Hamburg geplant ist – so ein Gipfel ist ja eine Steilvorlage, wenn man sich als Gruppe positionieren und etwas beitragen will. Im Dezember 2016 gab es dazu im Hamburger Gängeviertel eine Aktionskonferenz, die sich „NoG20“ nannte und an der Johannes, ich und noch drei andere teilgenommen haben. Im Prinzip war das ein großes Protestnetzwerk mit unterschiedlichsten Arbeitsgruppen, aus denen wundervolle Aktionen entstanden sind.
Johannes:
Wir haben dort die verschiedensten Leute getroffen, die sich alle dafür interessiert haben, mit eigenen Aktionen eine gemeinsame Form des kreativen Protests auf die Beine zu stellen. Die einen haben beispielsweise ein Kartenspiel erfunden, die anderen ein Rollenspiel im öffentlichen Raum, wieder andere ein spezielles Radioprogramm für den G20-Gipfel. Es wurde dort einfach diverses Zeug vorgestellt und man hat mit anderen Leuten Aktionsmöglichkeiten besprochen.
Gudrun:
Und so haben wir uns einfach inspirieren lassen und uns mit anderen ganz frei über unsere Gedanken ausgetauscht. Dabei ist sehr schnell die Idee entstanden, eine Performance zu entwickeln und Kunst im großen Stil zu machen. Das heißt konkret, dass wir keine kleine und exklusive Aktion wollten, sondern dass wir vielmehr im Sinn hatten, sehr, sehr viele Menschen in diese Performance einzubinden – Menschen, die vorher vielleicht noch nie Teil einer Protestaktion waren und die sich vielleicht sonst auch nicht zu G20 geäußert hätten.
Jonas:
Weil sie nicht gewusst hätten, wie?
Gudrun:
Genau. Und sich damit in gewisser Weise ihrer Verantwortung entzogen hätten. Das war ein Teil unseres Anliegens.
Oli:
Ein weiteres Résumé ist, dass wir gesehen haben, dass es möglich ist, aus der hohlen Hand heraus und mit nichts als einer Vision und Enthusiasmus viele andere Menschen dafür zu begeistern, sich zu engagieren und gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen. Und das ohne jegliche Kulturfördermittel oder irgendeine Hilfe von außen, sondern ausschließlich mit Spendengeldern.
Mir persönlich macht diese Aktion sehr viel Mut und gibt mir Zuversicht, denn sie zeigt: Wenn man eine Vision hat, sich wirklich dahinter klemmt und es schafft, andere für seine Sache zu gewinnen, gelingt es auch, daraus Realität werden zu lassen. Ich glaube, diese Erfahrung bleibt auch jenseits meines persönlichen Résumés für viele andere Menschen gültig.
Und wie Gudrun bereits gesagt hat: Das Schöne war, dass an unserer Aktion Leute teilgenommen haben, die nicht nur noch nie auf einer Demo oder einer anderen Protestveranstaltung waren, sondern die auch noch nie an einer Performance teilgenommen haben. Dass wir das möglich machen konnten, auch diese Erfahrung bleibt für uns alle.
Gudrun:
Dass Johannes, Oli oder ich an dieser Performance beteiligt waren, ist gar nicht so wichtig. Viel wichtiger ist, dass beispielsweise die Mutter aus Winterhude sich extra einen Tag freigenommen hat, um zusammen mit ihrer Tochter bei den „1000 GESTALTEN“ mitzumachen. Oder dieses 70-jährige Rentnerpaar, das zum ersten Mal mit solch einer Form des Protests in Kontakt gekommen ist und dadurch wirklich eine Lebenserfahrung gemacht hat.
Mit völlig fremden Menschen eine so große Performance zu realisieren, ist natürlich auch ein totales Wagnis. Man weiß vorher nie, ob das Kunstwerk am Ende so sein wird, wie man sich das vorgestellt hat. Aber darauf mussten wir uns einlassen, denn anders hätten wir unsere Aktion nicht möglich machen können.
Wir wollten ein Bild schaffen, das für die Medien im Zusammenhang mit dem G20-Gipfel so interessant ist, dass sie es im Rahmen ihrer Berichterstattung immer wieder zeigen und dadurch unsere Botschaft multiplizieren.
Johannes:
Eine unserer wichtigsten Vorgaben war, eine Form des Protests zu schaffen, bei der die Schwelle der Beteiligung sehr niedrig liegt. Dabei wollten wir aber nicht einfach nur viele Leute auf die Straße bekommen, wir wollten für unsere Aktion auch eine künstlerische Form finden. Eine, die wir zudem auch organisatorisch abbilden konnten. Wir wollten etwas auf die Beine stellen, das weitaus mehr sein sollte als eine Demo – etwas, das als mediales Kunstwerk funktioniert.
Das war für uns deshalb ein so zentrales Anliegen, weil wir mit den „1000 GESTALTEN“ die Massenmedien kapern wollten. Wir wollten ein Bild schaffen, das für die Medien im Zusammenhang mit dem G20-Gipfel so interessant ist, dass sie es im Rahmen ihrer Berichterstattung immer wieder zeigen und dadurch unsere Botschaft multiplizieren. Auf der Straße gesehen zu werden ist zwar wichtig, aber mindestens genauso wichtig ist es auch, außerhalb der Stadt, außerhalb des Landes wahrgenommen zu werden und eine maximale mediale Verbreitung zu erreichen. Und das ist uns gelungen. Die „1000 GESTALTEN“-Aktion wurde sehr, sehr weit verbreitet: Überall, wo es unser Ziel war publiziert zu werden, wurden wir auch publiziert. Wir alle waren wirklich baff und erstaunt, dass es tatsächlich gelingen kann, alleine über die Inszenierung eines großen Bildes die Medien für die eigene Botschaft zu instrumentalisieren.
Jonas:
Sind euch dabei nicht die schweren Ausschreitungen in der Hamburger Innenstadt in die Quere gekommen? Wahrscheinlich hättet ihr doch eine noch viel größere Bühne für euer Anliegen gehabt, wäre die allgemeine Berichterstattung nicht so stark von den Krawallen dominiert gewesen.
Gudrun:
Zeitlich waren wir ja vor den Ausschreitungen dran. In den Tagen vor dem offiziellen Gipfel waren bereits so viele Journalisten zur Vorberichterstattung in der Stadt, dass die Bühne für uns ideal war, wir konnten da eine Marke setzen. Wir haben uns also ganz bewusst kurz vor dem Gipfel positioniert – vielleicht auch kurz bevor wir geahnt, ja sogar damit gerechnet haben, dass die Ausschreitungen beginnen.
Johannes:
Wir waren nicht überrascht von den Ausschreitungen. Ganz ehrlich, es war doch klar, dass es krachen wird…
Oli:
…und es war klar, dass die Berichterstattung dementsprechend sein wird.
Durch unsere Aktion haben viele Menschen gesehen, dass es auch andere Formen der kritischen Auseinandersetzung mit diesem G20-Gipfel gibt als die Vollkonfrontation.
Johannes:
Und genauso war abzusehen, dass das Ganze medial dramatisiert und hochgejazzt werden würde. Und wie am Ende die Argumentationslage sein würde. Ehrlich gesagt ist es genauso gelaufen, wie ich mir es gedacht habe. Und jetzt, fünf Monate später, kommt raus, dass alles gar nicht so wild war und beide Seiten maßlos übertrieben haben – wie es immer so ist in solchen Auseinandersetzungen. Sowohl bei der Polizei als auch bei den linken Gruppen, die für die Demos verantwortlich sind, wird jetzt das große Betroffenheitskino gespielt, das medial natürlich sehr gerne aufgegriffen wird. Aber das hat auch etwas Gutes. Es führt zu einer gesellschaftlichen Auseinandersetzung – über den G20-Gipfel, über Protest, über Verschiedenstes.
Ich freue mich einfach, dass wir es Anfang Juli geschafft haben, unseren kleinen Vorfilm unterzubringen, bevor das große Theaterstück aufgeführt wurde. Vielleicht ist es uns ja sogar gelungen, im Notenschlüssel einen kleinen Aspekt zu verändern oder die Tonart ein Stück weit zu beeinflussen – für die Symphonie, die danach kam. Durch unsere Aktion haben viele Menschen gesehen, dass es auch andere Formen der kritischen Auseinandersetzung mit diesem G20-Gipfel gibt als die Vollkonfrontation.
Oli:
Bis die Ausschreitungen Freitagnacht einen ersten Höhepunkt erreicht haben, haben wir den medialen Diskurs, was die Berichterstattung betrifft, ziemlich klar dominiert.
Johannes:
Ob wir den dominiert haben, weiß ich gar nicht so genau. Auf jeden Fall haben wir sehr deutlich stattgefunden. Andere Bilder haben aber auch deutlich stattgefunden.
Oli:
Ja, beispielsweise wie Trump mit seinem Hubschrauber landet. Aber das waren die erwartbaren Bilder. Und das ist ja das Schöne: dass wir dem etwas entgegensetzen konnten, das nicht diesem allseits bekannten Ritual gefolgt ist – hier die Hochsicherheitsveranstaltung, dort die Protestierenden, dann fliegen Flaschen hin und her und so weiter, und so weiter.
Ich kann vielleicht noch eine kleine Anekdote beitragen. Wir waren an jenem Wochenende ja auch im Gängeviertel unterwegs und haben dort mit vielen Leuten gesprochen. Unter anderem kamen zwei Autonome auf uns zu und sagten, dass sie unsere Aktion total doof fänden, denn sie sei für sie viel zu pädagogisch und harmlos. Als dann aber die Medien nur noch von bestimmten Bildern beherrscht wurden – etwa wie ein Typ mit einer Calvin Klein-Unterhose einen Molotowcocktail wirft –, haben wir erfahren, dass die Autonomen im Nachhinein den Sinn unserer Aktion verstanden haben und es richtig gut fanden, was wir da gemacht haben. Das war ein sehr schönes Feedback für mich.
Jonas:
Mittlerweile gehören über 100 Menschen zu eurer Gruppe, dabei spielt der Begriff Kollektiv eine besondere Rolle. Dieser Begriff ist allerdings nicht nur positiv konnotiert, denn Kollektiv kann auch bedeuten: Die Interessen und Bedürfnisse eines Individuums werden verdrängt, wenn es darum geht, ein gemeinschaftliches Ziel zu erreichen. Wie definiert ihr Kollektiv im Zusammenhang mit den „1000 GESTALTEN“?
Johannes:
Stimmt, das ist ein Begriff, der nicht vollkommen jungfräulich ist und eine gewisse Belastungshistorie hat, über die wir tatsächlich hinwegsehen. Wenn wir im Zusammenhang mit den „1000 GESTALTEN“ von Kollektiv sprechen, geht es uns grundsätzlich darum, dass das Wir über dem Ich steht. Die Gemeinschaft ist wichtiger als das Individuum, das ist die erste Prämisse. Allerdings soll sich das Individuum in der Gemeinschaft zurecht finden – und nicht darin untergehen.
Unsere Aktion konnte nur dadurch funktionieren, dass sich jeder in seinen ganz individuellen Eigenschaften und Fähigkeiten gesehen fühlt, aber trotzdem aufgehen kann in einem gemeinsamen Ziel und in einer gemeinsamen Überzeugung.
Gudrun:
Ich glaube, diese negative Konnotation, die du angesprochen hast, ist hauptsächlich im ersten Teil unserer Performance wahrzunehmen, wenn sich die grauen Gestalten langsam und begleitet von einem ständigen Klicken über die Straße bewegen. Ich denke, das Bild, das wir hier gezeichnet haben, spricht für sich: Wir zeigen eine Art von Gemeinschaft, in der alle gleichgeschaltet sind und das Individuum nicht mehr gesehen wird. Dann aber findet eine Verwandlung statt und wir präsentieren das Idealbild einer Gemeinschaft, in die alle kollektiv eingebunden sind, in der aber auch jeder Einzelne in all seiner Individualität zum Vorschein kommt.
Das ist die Art von Kollektiv, wie wir sie uns wünschen, und wie wir den Begriff verstehen. Wäre unsere Aktion nur darauf ausgelegt gewesen, alle Teilnehmer gleich zu machen, hätten sich da weitaus weniger Menschen zugehörig gefühlt – und es hätten weitaus weniger mitgemacht. Die Aktion konnte nur dadurch funktionieren, dass sich jeder in seinen ganz individuellen Eigenschaften und Fähigkeiten gesehen fühlt, aber trotzdem aufgehen kann in einem gemeinsamen Ziel und in einer gemeinsamen Überzeugung.
Oli:
Kollektiv heißt für uns nicht, dass alle gleichgeschaltet sind, etwa wie im chinesischen Sinne, wo das große Staatswesen als eine Art Ameisenstaat gesehen wird und die Rechte des Einzelnen keine Rolle spielen. Obwohl am Anfang unserer Performance alle grau maskiert und mit Lehm beschmiert waren, konnte man dennoch eine starke Individualität in den Gesichtern der Menschen erkennen. Das war wunderschön. Man konnte sehen, wie jedes dieser unheimlich ausdrucksstarken Gesichter seine eigene Qualität hatte.
Die Kraft und Magie des Kollektivgedankens ist es ja, dass jeder über sich hinauswächst, sei es während der Vorbereitungszeit in der kleinen Gruppe oder während der Performance selbst in der Masse aus hunderten Menschen. Diese graue Masse war in ihrer Wirkmächtigkeit viel mehr als die Summe der einzelnen Teilnehmer.
Natürlich ist Kollektivarbeit auch wahnsinnig anstrengend, weil man sich im Plenum trifft und sich permanent mit verschiedensten Charakteren auseinandersetzen muss. Aber wenn man ein gemeinsames Ziel und eine Vision hat, dann treten das Persönliche und die vielen Animositäten zurück: Man ist einzig und allein diesem Ziel verpflichtet.
Johannes:
Die Sache mit der grauen Kostümierung war gar nicht so trivial. Wir hatten uns dazu vorab folgende Fragen gestellt: Wie einfach muss eine Botschaft sein, damit sie unkommentiert auf der ganzen Welt verstanden wird? Und wie stark darf man vereinfachen, bevor es plump wirkt und dadurch für das Anliegen eher schadhaft wird? Diese Grenze zu treffen war eine unserer wichtigsten inhaltlichen Übungen.
In der Umsetzung bedeute das, dass man in dieser Masse von grauen Gesichtern ein Bild von Gesellschaft erkennen musste. Wir wollten, dass die Zuschauer in diesen Gestalten entweder sich selbst wiedererkennen oder vielleicht die Politiker, die Wirtschaft oder wen auch immer. Die Performance sollte den Leuten zeigen, dass sie in unserer heutigen Gesellschaft nicht miteinander interagieren, sondern dass diese Gesellschaft ziemlich rücksichtslos ist, sich jeder nur noch um sich selbst kümmert und Menschen dabei auf der Strecke bleiben. Aber genauso sollte sie auch deutlich machen, dass es plötzlich die Erweckung eines Sinnes geben kann und man sich gegenseitig erkennen, aufeinander achten und anderen helfen kann. Aus dieser neuen Situation heraus kann eine Befreiung stattfinden – hin zu einem bunteren, freieren, natürlicheren Bewegungsablauf und Zusammengehörigkeitsgefühl innerhalb unserer Gesellschaft. Das ist die Botschaft.
Gudrun:
Johannes, dieser letzte Satz ist eigentlich der wichtigste: Diese von uns gezeigte Form der Individualisierung führt nicht zum Zerfall oder zu Zersplitterung, sondern zu einer positiveren Form der Vergemeinschaftung und zu einer viel natürlicheren und menschlicheren Gesellschaft.
Jonas:
Von der ersten Idee bis zur tatsächlichen Aktion ist es ein langer Weg. Welches waren die größten Hürden, über die ihr springen musstet?
Oli:
Die Probleme fangen schon bei den Behörden und mit den Genehmigungen für den Platz an. Gerade während eines G20-Gipfels ist das ja eine heikle Situation, auch mit der Polizei. In dieser Sicherheitslage hätten wir nicht einfach versuchen können, einen Flashmob zu starten. Das hätte wahrscheinlich nicht funktioniert.
Wir haben uns gefragt: Wie soll überhaupt diese zukünftige Gesellschaft aussehen, die wir nach der Transformation der Gestalten präsentieren wollen? Was erzählen wir da tatsächlich über irgendeine gesellschaftliche Utopie?
Johannes:
Das ist auch ganz am Anfang eine der wichtigsten Fragen, die man sich stellen muss: Wollen wir überhaupt eine genehmigte Aktion oder machen wir etwas total Unangemeldetes? Oder melden wir eine Demo an, bei der aber die Demonstrierenden verkleidete Gestalten sind? Das war eine große und lange Diskussion, die wir führen mussten, denn hinter diesen drei Varianten stehen auch drei komplett unterschiedliche Möglichkeiten, wie man mit Haftung, Finanzierung und so weiter umgeht.
Die nächsten Fragen waren: Wie einfach oder komplex soll unsere Botschaft sein? Will man überhaupt eine konkrete Botschaft transportieren? Soll diese Botschaft eine politische sein? Will man mit einer bestimmten These auftreten, beispielsweise zu Rassismus oder Klimawandel? Und davon abgesehen: Wie soll überhaupt diese zukünftige Gesellschaft aussehen, die wir nach der Transformation der Gestalten präsentieren wollen? Was erzählen wir da tatsächlich über irgendeine gesellschaftliche Utopie?
Natürlich ging es in unseren Diskussionen auch ums Geld: Wie kann man so etwas überhaupt finanzieren? Versucht man lieber, irgendwelche Fördermittel abzugreifen, oder startet man eine Crowdfunding-Kampagne? Das waren total offene Fragen, die am Anfang alle noch nicht geklärt waren, aber die wir uns zwingend stellen mussten und die wir auch gemeinsam beantworten wollten.
Jonas:
Utopie ist ein gutes Stichwort. Ihr schreibt auf eurer Website: „Die 1000 GESTALTEN sollen eine Gesellschaft verkörpern, der das Gefühl dafür abhanden gekommen ist, dass auch eine andere Welt möglich ist.“ Was ist das genau für eine andere Welt und warum ist unserer Gesellschaft das Gefühl dafür abhanden gekommen?
Oli:
Wir haben eine Welt dargestellt, in der jeder stur vor sich herschreitet und versucht, in diesem System zu funktionieren. Ein paar schaffen es nicht und bleiben achtlos am Wegrand liegen. Unsere Utopie – im Kontrast dazu – ist eine humanistischere und solidarischere Gesellschaft, die keine materiellen Werte mehr in den Vordergrund stellt, sondern menschliche.
Johannes:
Eine Welt, in der jeder auf den anderen achtet, in der sich Menschen gegenseitig wertschätzen und in der man Rücksicht nimmt – eine Welt, in der jeder das Wir über das Ich stellt.
Oli:
Und eine Welt, in der auch Schwächere mitgenommen werden und in der sich niemand darüber freut, wenn ihm nur deshalb neue Karrierechancen eröffnet werden, weil jemand anderes liegen bleibt.
Jonas:
Und warum ist unserer Gesellschaft das Gefühl für eine solche Welt abhanden gekommen?
Gudrun:
Das liegt am Glauben an das System des Kapitalismus – das einzige Glaubenssystem, nach dem wir uns noch richten. Wir alle leiden meiner Meinung nach darunter, dass wir keine Religion mehr haben und es nichts gibt, das uns gesellschaftlich zu einem höheren Ziel führen könnte. Höhere Ziele haben wir nur noch im Persönlichen, und zwar in Form von Selbstverwirklichung und Individualismus. Wir streben danach, unser persönliches Glück im Konsum zu finden und uns mit Geld unsere gesellschaftliche Position zu sichern. Dieses Glaubenssystem ist für meine Begriffe sehr zerstörerisch.
Wir alle leiden darunter, dass wir keine Religion mehr haben und es nichts gibt, das uns gesellschaftlich zu einem höheren Ziel führen könnte. Wir streben nur danach, unser persönliches Glück im Konsum zu finden und uns mit Geld unsere gesellschaftliche Position zu sichern.
Oli:
Wir glauben nur an das, was wir in Konkurrenz zu anderen erreichen können, und nicht an das, was man gemeinsam erreichen kann. Es gibt nur noch ein psychologisches Ritual, das uns allen geblieben ist: der Fußball, die Bundesliga. In die Kirche gehen die Leute ja schon lange nicht mehr.
Jonas:
Und spätestens seit es „Wetten dass..?“ nicht mehr gibt, gibt es auch kein gemeinsames TV-Ritual mehr.
Oli:
Genau. Es gibt auch in Bezug auf das Fernsehen kein gemeinschaftliches Erleben mehr, zumindest nicht in dem Sinne, wie es das früher noch gab. Durch die Fragmentierung der Fernsehprogramme schaut heute keiner mehr fern, die Leute klicken sich eher durch Netflix oder YouTube.
Gudrun:
Das gemeinschaftliche Erleben findet in unserer Gesellschaft nur noch über den Konsum statt. Zum Beispiel wenn wir alle ein bestimmtes Telefon besitzen, durch das wir uns zu einer gewissen Schicht zugehörig fühlen, ja sogar definieren. Das ist etwas, was die Menschen extrem aushöhlt und ausbrennen lässt. Und das kritisieren wir.
Jonas:
Alleine in der Geschichte der Bundesrepublik gab es immer wieder Momente und Phasen, in denen die Leute zu Hunderttausenden auf die Straße gingen, um ihren Protest auszudrücken – beispielsweise gegen den Krieg in Vietnam, den NATO-Doppelbeschluss oder die Kernenergie. Seit dem Mauerfall Ende der 1980er Jahre hat es solche großen, lang anhaltenden Protestbewegungen in Deutschland kaum noch gegeben, selbst beispielsweise bei dem Widerstand gegen die Agenda 2010 nicht. Hat unsere Gesellschaft das Protestieren verlernt?
Johannes:
Ich glaube, dass die Leute an einem Punkt sind, an dem sie erschrocken und erstaunt feststellen, dass die Wahrheit als absolutes Maß immer mehr an Relevanz verliert. Wir leben im postfaktischen Zeitalter. Und das
Postfaktische in unserer Zeit fragt eben immer mehr nach dem Wie als nach dem Was. Es gibt nicht mehr die eine Wahrheit, sondern viele Wahrheiten. Und da Wahrheit nichts anderes als die Deutung der Realität meint, heißt das letztendlich, dass um Deutungshoheiten gerungen wird.
Nun war der politische Diskurs der letzten 150 Jahre zwar immer geprägt von dem Ringen um Deutungshoheit – was uns ohne Zweifel auch weitergebracht hat –, aber es ging immer auch darum, dass sich der Stärkere durchsetzt. Und das wiederum gibt es immer nur in Begleitung großer Kollateralschäden und führt im schlimmsten Fall zu noch verhärteteren Fronten.
Ich stelle allerdings fest, dass es in unserer Gesellschaft eine Sehnsucht gibt, diese Politik in Form des Ringens um Deutungshoheit zu überwinden. Es geht vielmehr darum zu fragen, wie wir gemeinsam Prozesse organisieren können, um zu einem optimalen Ergebnis zu kommen. Wenn uns das gelingen würde, wäre das etwas wirklich Neues.
Aus diesem Grund war es für mich auch so wichtig, unsere Performance nicht als eine konkrete Aktion für den Tierschutz oder gegen die Kernenergie zu konzipieren, sondern damit auf der Metaebene die Frage nach dem Wie des gesellschaftlichen Miteinanders zu stellen, das für uns alle die Grundlage ist, um überhaupt zu den richtigen Entscheidungen zu kommen.
Oli:
Seit dem Zusammenbruch des Sozialismus wird einem ja auch vorgegaukelt, dass es keine Alternative zu diesem kapitalistischen, globalisierten System gibt, in dem wir leben. Demgegenüber fühlt man sich als kleiner Mensch einfach hilflos.
Jonas:
Ich bin auf eurer Website auf folgenden Satz gestoßen. „Die Keimzelle für die Zukunft ist der Raum zwischen dir und mir.“ Ist es wichtiger, an die Zwischenmenschlichkeit zu appellieren statt an die staatsbürgerliche Verantwortung, wenn man die Gesellschaft verändern will?
Johannes:
Wir haben in der Anfangszeit seitenweise theoretische Texte geschrieben und dieser starke Satz war eine der Konklusionen. Er ist Ausdruck des Gedankens, dass die Veränderung einer Gesellschaft nicht damit beginnt, dass man eine Utopie im Top-down-Verfahren einfordert. Das heißt, dass es keinen Wandel geben kann, wenn man als Individuum verlangt, dass sich erst ganz oben, an der Spitze einer Gesellschaft, etwas ändern muss, bevor man selbst bereit ist, etwas zu tun.
Ganz im Gegenteil: Veränderung ist nur möglich, wenn die Politik von unten nach oben stattfindet. Nur wer selbst und in seinem Lebensumfeld Vorbild ist und dort andere für sich gewinnen kann, kann aus der Bewegung, die daraus entsteht, eine Veränderung generieren. Das ist eine neue Denkweise, über Politik zu reden: Wir fangen bei uns an!
Veränderung ist nur möglich, wenn die Politik von unten nach oben stattfindet. Das ist eine neue Denkweise, über Politik zu reden: Wir fangen bei uns an!
Gudrun:
Ausgehend von diesem Anspruch haben wir uns Anfang des Jahres gefragt: Was ist dafür die kleinste Einheit, die kleinste politische Handlung? Womit kann man selbst den Anfang machen, der sich dann im Idealfall fortsetzt und zu einer großen Bewegung wird?
Johannes:
Das Interessante ist ja, dass dabei so etwas wie Geld eigentlich gar keine große Rolle spielt. Wir selbst haben uns bei den „1000 GESTALTEN“ immer als Investoren ohne Geld verstanden, das war eines unserer Schlagworte. Man kann tatsächlich etwas tun in der Welt, auch ohne finanzielle Mittel. Man kann zum Beispiel auf einen anderen Menschen zugehen und sagen: „Ich möchte dir helfen. Ich möchte meine Kraft und meine Ressourcen, die ich selbst gerade nicht nutze, in dein Problem investieren. Und zwar nicht, indem ich dir Geld gebe, sondern indem ich dir meine Empathie, die Kraft meiner Hände und meines Kopf gebe.“
Jonas:
Das klingt ein bisschen wie die Weiterentwicklung des Kennedy-Satzes „Ask not what your country can do for you – ask what you can do for your country!“, nur dass es in eurem Zusammenhang nicht um ein Land geht, sondern um die Gesellschaft an sich.
Oli:
Das war ein zentrales Motiv für uns. Wir wollten uns nicht einfach hinstellen und sagen: „Wir sind ein Kollektiv aus lauter kreativen, tollen und intelligenten Leuten! Wir wissen, wie’s läuft und haben alle Antworten.“ Wir wollten vielmehr ganz simple Fragen stellen und haben dabei gemerkt, dass das, was alle mitnimmt und alle vertreten können, das Zwischenmenschliche ist.
Jonas:
Noch vor zehn, fünfzehn Jahren hatte man das Gefühl, dass Menschen, die Kritik am Kapitalismus äußern, eher als Spinner wahrgenommen und in eine bestimmte politische Ecke gedrängt werden. Mittlerweile haben wir aber eine Situation, in der an vielen gesellschaftlichen Stellen ernsthaft und offen über Themen wie etwa das bedingungslose Grundeinkommen diskutiert wird – der dm-Gründer Götz Werner, ein Vertreter der Wirtschaft, hat sogar ein Buch darüber geschrieben und spricht sich klar für ein solches Grundeinkommen aus. Ist das ein Vorbote für die Auseinandersetzung mit der Frage, was nach dem Kapitalismus kommt? Wie sieht eurer Meinung nach eine postkapitalistische Gesellschaft aus? Was müsste sich konkret verändern?
Oli:
Was mich am meisten stört, ist die Tatsache, dass das aktuelle System weder ethisch noch ökologisch zu verantworten ist, weil es die Lebensgrundlagen ruiniert und weil es immer nur denjenigen belohnt, der den meisten Profit macht – indem er am rücksichtslosesten seine Mitarbeiter und die Umwelt ausbeutet.
Ganz abgesehen davon zeigt sich doch auch spätestens nach dem Crash der Finanzmärkte im Jahr 2009, dass dieses System nach seinen eigenen Regeln nicht mehr funktioniert. Die meisten tun zwar noch so, als ob alles glatt laufen würde, aber eigentlich ist das System nach seinen Gesetzmäßigkeiten am Ende.
Man muss wieder zu einem Punkt kommen, an dem Besitz gleichbedeutend ist mit Verantwortung.
Johannes:
Es geht darum, dass man wieder zu einem Punkt kommt, an dem Besitz gleichbedeutend ist mit Verantwortung – sobald man im Besitz von Produktionsmitteln, von Rechten oder von Geld ist, hat man eine Verantwortung zu tragen. Durch die Akkumulation von immer mehr Besitz und dem gleichzeitigen Negieren der Verantwortung, die sich aus diesem Besitz entwickelt, entstehen die Probleme unserer Gesellschaft. Daher muss die Verbindung zwischen Besitz und Verantwortung wiederhergestellt werden. Aber wie genau, das weiß ich nicht.
Oli:
Aber ich weiß es – durch eine Änderung der Werte. Bisher ist es so: Wer den Porsche besitzt, dem eifern alle nach. Aber es gab ja auch mal eine Gesellschaft, in der sich die besitzenden Schichten den moralischen Eigenschaften ihres Besitzes bewusst waren und dadurch einen gewissen Ethos entwickelt hatten. Wir brauchen also eine grundsätzliche Diskussion über Werte. So wie bisher können wir jedenfalls nicht weitermachen.
Jonas:
In eurer Performance wird die Transformation von der einen Gesellschaftsform zu der anderen auch von gewissen Schmerzen begleitet. Nun fällt Veränderung natürlich immer schwer, tut manchmal sogar weh und ist mit einer gewissen Angst verbunden. Diese Erfahrung ist zutiefst menschlich. Wie kann es denn gelingen, den Menschen die Angst vor so einer großen Veränderung zu nehmen, wie sie die Transformation einer ganzen Gesellschaft mit sich bringen würde?
Johannes:
Das hat etwas mit Vertrauen zu tun. In einer Gesellschaft geht es doch grundsätzlich darum, wie haltbar das Solidarprinzip ist und ob man darauf vertrauen kann. Das meine ich sowohl im organisatorischen Sinne – also was so etwas wie Kranken- oder Rentenversicherung angeht –, aber auch im ganz konkreten, etwa wenn ich alleine auf der Straße stehe und ein Problem habe. Kann ich darauf vertrauen, dass jemand kommen wird, um mir zu helfen? Das ist eine Grundvereinbarung, die jede Gesellschaft für sich treffen muss und die Auswirkungen auf jeden Einzelnen hat, der sich wiederum fragen muss: Bin ich in der Lage, dieses Vertrauen auch selbst zu generieren, wenn ich mich in dieser Welt bewege? Oder muss ich voller Misstrauen sein, mich schützen und mich gegen alles absichern? Das ist die Transformation, von der wir sprechen.
Wir alle sehnen uns doch danach, uns in einer Gemeinschaft aufgehoben zu fühlen. Wir sehnen uns nach Zwischenmenschlichkeit und Zuneigung. Aber das, was wir gesellschaftlich gerade tun, unterdrückt diese Grundbedürfnisse.
Gudrun:
Ich würde es sogar umdrehen. Ich finde, wir haben zum Ausdruck gebracht, dass der aktuelle gesellschaftliche Zustand, in dem sich die Menschen befinden, viel mehr weh tut als die Transformation selbst. Das arbeiten die Gestalten durch die Art ihrer Bewegung ja auch sehr gut heraus: diese Enge, dieses Beschwerte, dieses Erschöpfte, mit dem sie sich durch die Straßen schleppen.
Müsste man vor diesem Zustand, an den sich so viele Menschen in ihrem Leben gewöhnt haben, nicht viel mehr Angst haben als davor, sich von dieser Last zu befreien? Wir alle sehnen uns doch danach, uns in einer Gemeinschaft aufgehoben zu fühlen. Wir sehnen uns nach Zwischenmenschlichkeit und Zuneigung. Aber das, was wir gesellschaftlich gerade tun, unterdrückt diese Grundbedürfnisse. Und das macht uns krank und fertig.
Oli:
Und so leidet jeder Einzelne langsam und in seinem stillen Kämmerlein vor sich hin. Vielleicht fällt es ja durch die Erfahrung in der Gruppe leichter, etwas zu verändern – wenn man sieht, dass man nicht alleine ist und nicht alleine vor sich hin leidet. Beispielsweise an dem materiellen Druck, die Miete zahlen zu müssen.
Jonas:
Dieses Leidende, Ausdruckslose konnte man während der Performance sehr deutlich aus den Gesichtern aller Gestalten lesen, dabei habt ihr fast ausschließlich mit Laiendarstellern gearbeitet. Oli, du selbst bist professioneller Schauspieler und hast wahrscheinlich kein Problem damit, auf Knopfdruck ein leidendes und ausdrucksloses Gesicht aufzusetzen. Aber wie bringt man das Leuten bei, die das nicht beruflich tun und vielleicht noch nie irgendeine schauspielerische Erfahrung gemacht haben – vor allem, wenn sie diesen Gesichtsausdruck drei Stunden halten sollen?
Oli:
Das war keine große Kunst, man braucht dafür nur ein paar allersimpelste Schauspielübungen. Im Prinzip geht es darum, eine gewisse Wahrnehmung über sich und die anderen im Raum zu erlangen und seinen Blick zu öffnen. Das heißt, dass man nichts fokussieren darf, sondern um sich herum eine Art Gesichtsfeld aufbauen muss, in dem alles gleichbedeutend stattfindet – die meisten Tiere tun das übrigens genauso. Wenn man sich auf die Ränder seines Blickfelds konzentriert, wird der Blick automatisch leer.
Alles andere hat sich von alleine ergeben, auch durch diese unglaubliche Gruppendynamik, die plötzlich innerhalb der Leute entstanden ist. Durch die Art, wie die Gestalten ausgesehen und aufeinander reagiert haben, wurde eine so starke Wechselwirkung ausgelöst, dass es nicht mehr viel zu inszenieren gab.
Johannes:
Meiner Meinung nach gab es drei entscheidende Faktoren, die die Performance bestimmt haben: erstens dieser leere Blick, zweitens der schleppende, müde Gang und drittens – und ich glaube, das ist entscheidender als alles andere – das Klicken. Jede Gestalt hatte einen Deckel von einem Handaschenbecher in der Hand, mit dem man ein sehr charakteristisches Klickgeräusch erzeugen konnte. Im Prinzip ging es darum, über dieses Klicken zu versuchen, gemeinsam in eine gewisse Schwingung zu kommen und miteinander zu kommunizieren.
Da wirklich in einen Rhythmus zu kommen, ist schon mit zehn Leuten eine echt schwierige Übung. Mit zwanzig Leuten wird es richtig knifflig und mit fünfzig ist es eigentlich unmöglich. Das heißt, wenn 500 oder sogar 700 Leute versuchen, einen gemeinsamen Rhythmus zu finden, ist das eine Übung, die nicht klappen kann. Aber es ist wie eine Meditation: Alleine durch den ständigen Versuch, in eine gemeinsame Schwingung zu kommen, entsteht am Ende das Gefühl von Gleichzeitigkeit. Ich glaube, das ist das, was die Leute über Stunden durch die Performance getragen und sie in eine fast meditative Stimmung gebracht hat, die ganz stark zu spüren war und auch in den Videos immer noch gut rüberkommt.
Bei einigen Leuten war der Veränderungsprozess so stark, dass sie nach drei Stunden gar nicht mehr anders konnten – sie waren vollkommen zu einer grauen Gestalt geworden.
Gudrun:
Ich würde viertens noch die Kostümierung dazu zählen – die persönliche Transformation der Leute¬, durch die jede Gestalt so eindrücklich in dieser ausdruckslosen Verfassung gefangen war. Alleine das Erlebnis, dass sie im wahrsten Sinne des Wortes ihre Farbe verloren haben, war für viele Teilnehmer ein krasses Szenario. Einige Leute haben mir davon erzählt, wie sie bereits eine gewisse Transformation der eigenen Person gespürt haben, während sie eingekleidet und verlehmt wurden. Und wie ihnen dabei Stück für Stück ihre Individualität genommen wurde. Bei einigen Leuten war der Veränderungsprozess so stark, dass sie nach drei Stunden gar nicht mehr anders konnten – sie waren vollkommen zu einer grauen Gestalt geworden.
Oli:
Diese Verwandlung war echt magisch. Es gab da eine Halle, in die die Leute vorne in zivil hineingegangen sind und hinten als graue Gestalt wieder herauskamen – eine nach der anderen. Das war wie in einer Fertigungsanlage am Fließband: Erst wurde das Gesicht bemalt, dann die Klamotten angelegt und ganz am Schluss kam noch der Lehm drauf.
Als sich nach und nach der Hof hinter der Halle mit Gestalten gefüllt hat und aus den vielen bunten Individuen eine graue Masse geworden war, hat sich auch die ganze Konzentration und Stimmung der Leute geändert und nochmal geöffnet. Es war unglaublich, welche Präsenz und Kraft diese graue Masse hatte – ein unvergessliches Bild! Ich hatte da mehrere ekstatische Momente und war total high, ganz ohne Drogen.
Jonas:
Die Performance liegt nun etwa ein halbes Jahr zurück. Wie geht es mit den „1000 GESTALTEN“ weiter? Wie und wofür werdet ihr euer großes Netzwerk nutzen, das ihr euch mit dieser Aktion aufgebaut habt?
Oli:
Es gab im Anschluss an die Performance sehr viele Kooperationsanfragen. Es gab sogar einige Leute, die uns mit dieser Aktion für ihre Zwecke buchen wollten. Das haben wir aber abgelehnt. Wir sind keine Zirkustruppe, die mit ihrer Nummer um die Welt zieht.
Johannes:
Es stand für uns von Anfang an fest, dass wir die Sache nicht reproduzieren wollen, schon gar nicht zu allen möglichen Events.
Bei einigen Leuten war der Veränderungsprozess so stark, dass sie nach drei Stunden gar nicht mehr anders konnten – sie waren vollkommen zu einer grauen Gestalt geworden.
Gudrun:
Das Netzwerk dahinter ist für uns das einzig Wichtige. Durch dieses Netzwerk sind so viele neue Verbindungen entstanden, die jetzt auf den verschiedensten Wegen gepflegt werden. Ich habe großes Vertrauen, dass es daraus irgendwann wieder einen Impuls geben und sich ein weiteres gemeinsames Ziel formulieren lässt, das wiederum eine neue Aktion oder eine Idee hervorbringen wird. Ich bin überhaupt kein Freund davon, das Kollektiv jetzt zu institutionalisieren und sich jeden Monat zwanghaft mit der Vorgabe zu treffen, doch irgendwie weitermachen zu müssen. Dem Ganzen würde es einfach nicht gut tun, es in eine feste Struktur zu gießen. Das würde viel mehr abtöten als erschaffen. Fest steht: Wir haben vor einem Jahr aus einem Schwarm in kürzester Zeit ein sehr gut funktionierendes Kollektiv gebündelt. Ich glaube, das kann man jederzeit wiederherstellen.
Oli:
Und wir wissen jetzt, dass mit diesem Kollektiv alles möglich ist und wir alles machen können!
Johannes:
Aber eines ist klar: Wenn wir wieder etwas machen, dann muss es etwas Neues sein. Etwas wirklich Neues.
Michael Bradler
Portrait — Michael Bradler
Sieger der Geschichte
Weil er im Januar 1982 aus der DDR ausreisen wollte, wurde Michael Bradler von der Stasi verhaftet. Ein Dreivierteljahr lang saß der damals 20-Jährige im Gefängnis, davon mehrere Monate in Isolationshaft. Heute führt er als Zeitzeuge durch die ehemalige Haftanstalt des Ministeriums für Staatssicherheit in Berlin-Hohenschönhausen.
22. Januar 2018 — MYP N° 22 »Widerstand« — Interview & Text: Jonas Meyer, Fotos: Maximilian König
Als sich Michael Bradler am 11. Januar 1982 um 16:25 Uhr der Grenzübergangsstelle Sonnenallee in Ost-Berlin näherte, musste er seinen ganzen Mut zusammennehmen. Gerne hätte er in der Kneipe, die auf dem Weg lag, noch einen Cognac getrunken, aber man hatte dort seine Lieblingsmarke „Auslese“ nicht vorrätig. Also trat der 20-Jährige nüchtern vor das Wachhäuschen, schob seinen blauen DDR-Ausweis unter der Scheibe durch und erklärte dem wachhabenden Grenzposten, er wolle nach mittlerweile sieben erfolglosen Ausreiseanträgen sofort nach West-Berlin übersiedeln. Um seinem Vorhaben ein wenig Nachdruck zu verleihen, raunte er noch flapsig hinterher: „Die DDR ist mir scheißegal!“ Dann wurde er festgenommen. Erst ein Dreivierteljahr später war er wieder ein freier Mann – freigekauft durch die Bundesrepublik Deutschland und mit der Erfahrung monatelanger Isolationshaft in der zentralen Untersuchungshaftanstalt I des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR. Oder kurz: im Stasi-Gefängnis Berlin-Hohenschönhausen.
Knapp 36 Jahre später steht Michael Bradler wieder hier, und das mehrmals pro Woche: 1994, fünf Jahre nach dem Mauerfall und vier Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung, wurde auf dem ehemaligen Gefängnisgelände eine Gedenkstätte errichtet, die im Juli 2000 in eine selbstständige Stiftung des öffentlichen Rechts überführt wurde. Für diese Stiftung ist Bradler seit vielen Jahren als Zeitzeuge tätig und führt Woche für Woche interessierte Besucher durch genau den Ort, an dem er selbst für viele Monate eingesperrt war – und das nur, weil er von einem Land in ein anderes übersiedeln wollte. Darüber hinaus übernimmt er auch Führungen in der ehemaligen Stasi-Zentrale im Stadtteil Lichtenberg, die nur wenige Kilometer südlich der Gedenkstätte Hohenschönhausen liegt und von der aus die systematische Überwachung und Repression der DDR-Bevölkerung organisiert wurde.
Michael Bradler wuchs ideal zu den Vorstellungen des Sozialismus auf, beide Eltern waren Mitglieder der SED.
Dass Michael Bradler als junger Mann den Entschluss fasste, die DDR zu verlassen, war ihm keineswegs in die Wiege gelegt. Im Juni 1961, kurz vor dem Mauerbau, kam er in Ost-Berlin zur Welt und wuchs mit einem älteren Bruder und einer älteren Schwester „ideal zu den Vorstellungen des Sozialismus“ auf, wie er sagt. Beide Eltern waren Mitglieder der SED, die Mutter arbeitete im Ministerium des Inneren in einer nicht unbedeutenden Position, der Vater war stellvertretender Direktor im Ministerium für Wissenschaft und Technik – jedenfalls offiziell. Was genau der Vater beruflich tat, weiß Michael Bradler bis heute nicht. Die Tatsache, dass sich dessen Dienstsitz auf demselben Gelände befand, auf dem zeitweise auch die Abteilung III der Staatsicherheit mit Schwerpunkt Funkaufklärung ansässig war, macht ihn immer noch etwas stutzig. Unterlagen von damals, die etwas Licht in die Sache bringen könnten, gibt es leider nicht mehr. Sie fielen wohl – wie so viele Informationen zu wichtigen DDR-Funktionären – der konzertierten Vernichtungsaktion der Stasi in den Wochen und Monaten nach dem 9. November 1989 zum Opfer.
Als 1971 Michael Bradlers Mutter starb, sprangen die Großeltern mütterlicherseits zur Hilfe und kümmerten sich ab nun verstärkt um ihn und seine Geschwister. Über die Jahre entwickelte er ein immer engeres Verhältnis zu den Großeltern, die mit ihren Jahrgängen 1900 und 1901 bereits zwei Weltkriege und die Gründung der DDR erlebt hatten. „Auch bei den Großeltern“, so erinnert sich Michael Bradler, „stimmte im Wesentlichen die Einstellung, was die DDR betrifft.“ Ab und zu machten sie mal einen Ausnahme und ließen die Enkel West-Fernsehen schauen: „Das war dann meistens so etwas wie Bonanza – als Kind schaut man ja das, was einen interessiert.“
»Wenn wir politische Informationen haben wollten, bekamen wir die hauptsächlich aus der DDR, die mir bis dahin auch ein klares Feindbild vermittelt hatte.«
„Hin und wieder“, sagt Bradler, „haben wir auch die Tagesschau oder andere West-Nachrichten geschaut. Aber wenn wir politische Informationen haben wollten, bekamen wir die hauptsächlich aus der DDR, die mir bis dahin auch ein klares Feindbild vermittelt hatte. Da hieß es: ‚Im Westen, da leben die ganzen bösen Menschen – Kapitalisten, Faschisten, Nazis. Und die, die dort keine Kapitalisten, Faschisten oder Nazis sind, sind Sozialhilfeempfänger, arbeitslos, drogenabhängig, Terroristen oder sonst was.’ Wenn man das sein Leben lang hört, verändert das einen irgendwann. Und als Kind ist man dafür sowieso sehr empfänglich.“
Doch dann kam 1977. Dieses Jahr sollte Michael Bradler nachdrücklich prägen, denn es brachte gleich zwei einschneidende Ereignisse mit sich: Zum einen durfte ein sehr guter Schulfreund von ihm, Thomas, mit seiner Mutter die DDR verlassen. Zum anderen hatten ihm die Großeltern eröffnet, dass sie ebenfalls in den Westen ausreisen würden. Bradler war verwirrt: „Ich fragte mich: Thomas und meine Großeltern wollen plötzlich irgendwo leben, wo alles so böse und schlecht sein soll?“ Und so fing er an, sich mehr und mehr mit dem Thema zu beschäftigen. Er schaute bestimmte Sendungen im West-Fernsehen und versuchte, sich öfter mal mit West-Berlinern auszutauschen, die in der DDR auf Besuch waren. „Ich war damals 16, in dem Alter hat man sowieso den Drang, sich nach allen Seiten zu orientieren“, erzählt er. „Am wichtigsten war mir in dieser Zeit, den Kontakt zu Thomas und meinen Großeltern nicht abreißen zu lassen. Die durften ja nach wie vor in die DDR einreisen.“
»Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass die mir nicht alles erzählen, dass die mich anlügen. Und vor allen Dingen: dass die mich einengen.«
Dieses Jahr 1977 setzte in Michael Bradler einen längeren Prozess in Gange, der letztendlich vier Jahre anhalten sollte. Nach und nach stellte er fest, so sagt er, dass irgendetwas nicht stimmte in der DDR: „Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass die mir nicht alles erzählen, dass die mich anlügen. Und vor allen Dingen: dass die mich einengen.“ Und so entschloss er sich im Sommer 1981, einen „Antrag auf ständige Ausreise“ in den Westen Deutschlands zu stellen und damit die DDR zu verlassen. „Der eigentliche Auslöser für diesen Entschluss – es gibt ja für alles einen gewissen Auslöser – war, dass es meinem Schulfreund Thomas ab dem Sommer 1981 plötzlich nicht mehr erlaubt war, in die DDR einzureisen. Ich hatte Angst, dass meinen Großeltern das Gleiche passieren könnte.“
Als Begründung für seinen Ausreiseantrag gab Michael Bradler an, seine Großeltern in West-Berlin unterstützen zu wollen, die mittlerweile in einem gewissen Alter und dementsprechend auf Hilfe angewiesen waren. „Einen Ausreiseantrag zu stellen erschien mir als die für mich einzige legale Möglichkeit, die DDR zu verlassen“, erzählt er. „Eine Flucht kam für mich von vornherein nicht in Frage. Ich wollte nicht an der Mauer erschossen werden – dass man dort erschossen wird, wusste man aus den West-Nachrichten. Die Nachrichten der DDR haben das zwar nicht verbreitet, aber wenn man genau hinhörte, konnte man erfahren, dass Grenzzwischenfälle auch meistens mit Schusswechseln verbunden waren. Das war mir einfach zu gefährlich.“
Um einen Ausreiseantrag zu stellen, habe man sich zu der Abteilung Inneres des Rates des jeweiligen Kreises oder Stadtbezirks begeben müssen, in dem man gemeldet war, erklärt Michael Bradler. Diese Abteilungen, so weiß man heute, arbeiteten eng mit der Stasi zusammen, die daraufhin die Antragsteller beobachtete. „In dieser Abteilung Inneres des Stadtbezirkrats saßen Leute, vor denen man einen gewissen Respekt hatte, man wusste ja nicht, wie sie reagieren würden. Wenn man seinen Antrag dort abgegeben hatte, wurde er geprüft – diese Prüfung dauerte in meinem Fall 15 Sekunden, dann wurde er abgelehnt. Verwaltungsgerichte in der Form, wie wir sie in der Bundesrepublik kennen, gab es nicht. Man musste sich mit der Entscheidung abfinden. Wenn nicht, blieb einem nur noch die Flucht.“
»Thomas erzählte, dass man im Westen ohne Probleme in andere Länder reisen konnte. Da fragt man sich natürlich: Wieso kann der das und ich nicht?«
Um irgendwie mit Thomas in Kontakt zu bleiben, fuhr Michael Bradler zusammen mit seiner Schwester Ende September 1981 in die Tschechoslowakei. „Wir durften nicht in den Westen fahren, er durfte nicht in die DDR. Also mussten wir uns irgendwo anders treffen”, erzählt er. Das Wiedersehen mit seinem Schulfreund war für ihn prägend. Bereits in der DDR hatte Bradler ihm telefonisch von seinem Ausreiseantrag berichtet, jetzt hatte er zwei Kopien dabei, die er Thomas aushändigte – mit der Bitte, ihn von West-Berliner Seite zu unterstützen. Thomas wiederum erzählte, dass er zwischenzeitlich eine Ausbildung zum KFZ-Mechaniker bei Mercedes-Benz angefangen hatte. Schon wieder war Michael Bradler irritiert: „Uns in der DDR sagte man immer, dass die Schüler im Westen extreme Probleme hätten, nach ihrem Schulabschluss einen Ausbildungsplatz zu finden – da konnte also irgendetwas nicht stimmen. Thomas erzählte auch, dass man im Westen ohne Probleme in andere Länder reisen konnte. Da fragt man sich natürlich: Wieso kann der das und ich nicht?“ Da Thomas nicht irgendein West-Bürger war, sondern ein guter Freund, gab es für Michael Bradler keinen Grund, ihm nicht zu glauben. Dass Bradler dieses Treffen mit Thomas, dem West-Bürger, nicht der Stasi gemeldet hatte und dass er diesem West-Bürger zudem noch von seinem Antrag auf ständige Ausreise erzählt hatte, sollte ein Jahr später zu Michael Bradlers Verurteilung vor Gericht führen. Aber dazu später mehr.
Nach seiner Rückkehr aus der Tschechoslowakei fing Bradler an, sich intensiv mit der Frage auseinanderzusetzen, wie er die DDR verlassen könnte, und beschloss Anfang Oktober, einen zweiten Ausreiseantrag zu stellen. Was er in dem Zusammenhang nicht wusste: „Alleine deshalb hätte ich nach DDR-Recht bereits verhaftet werden können – die DDR schuf sich ihre Gesetze eben so, wie sie sie gerade brauchte. Diese Gesetzte kannte man in der Regel aber nicht, da man in der DDR nicht ohne Weiteres Zugang zu juristischen Unterlagen oder Gesetzestexten erhalten konnte. Und so dolle mit den Rechtsanwälten war es in der DDR auch nicht.“
Und so stellte Michael Bradler von August bis Dezember 1981 insgesamt sieben Ausreiseanträge – jedes Mal ohne Erfolg. Als auch der siebte Antrag abgelehnt wurde, kam in ihm so langsam die Befürchtung auf, dass der Staat ihn bald zur Nationalen Volksarmee einziehen würde und es dann zu spät wäre: „Mir war klar, dass ich keine Chance mehr hätte, die DDR zu verlassen, wenn ich erst einmal bei der Armee war. Wir waren ja mitten im Kalten Krieg. Wer da als NVA-Mitglied einen gewissen militärischen Wissensstand hatte, der hätte niemals in den Westen reisen dürfen. Umgekehrt war das bei der Bundeswehr nicht anders, das war zu dieser Zeit halt so.“
Von 1963 bis zum Fall der Mauer 1989 verkaufte die DDR etwa 33.000 politische Gefangene an die Bundesrepublik.
Im Laufe der weiteren Suche nach einer Möglichkeit, das Land zu verlassen, erfuhr Michael Bradler dann etwas von einem möglichen Häftlingsfreikauf durch die Bundesrepublik: „Ich hatte gehört, dass Leute, die nach bundesdeutschem Recht unschuldig in einem Gefängnis der DDR saßen, regelmäßig von der BRD freigekauft wurden.“ Und tatsächlich: Von 1963 bis zum Fall der Mauer 1989 verkaufte die DDR etwa 33.000 politische Gefangene an die Bundesrepublik. Kostete ein Mensch am Anfang noch 40.000 DM, kletterte der Preis zwischenzeitlich auf bis zu 200.000 DM pro Häftling und pendelte sich bis zum Ende der DDR bei pauschal 96.000 DM ein. So zahlte der Westen in gut 25 Jahren etwa drei Milliarden DM an die DDR, die wegen ihrer maroden Wirtschaft dringend auf Devisen angewiesen war und für die diese Vereinbarung dementsprechend ein willkommenes Geschäft darstellte. (Quelle: Deutschlandfunk)
Und so nahm Michael Bradler am 11. Januar 1982 seinen DDR-Ausweis, begab sich zur Grenzübergangsstelle Sonnenallee und erklärte dem wachhabenden Posten, dass er nach West-Berlin ausreisen wollte. Daraufhin wurde er verhaftet und geriet in die Mühlen des Systems. „Aus meiner Sicht war relativ klar, dass die mich da nicht einfach durchlaufen lassen”, erklärt Bradler. „Aber von dem, was mich nach der Verhaftung erwarten würde, hatte ich absolut keine Ahnung. Ich kannte ja niemanden, der mal in Haft war und mir davon hätte berichten können. Ich kannte so etwas nur aus Krimis und hatte dementsprechend das Bild im Kopf, dass ich in einen dunklen Keller geschleppt und vor eine Lampe gesetzt würde.“
Bradler wurde über drei Stunden lang kommentarlos an der Grenzübergangsstelle festgehalten, bis um 19:50 Uhr zwei Männer in Zivil erschienen: „Stehnse auf, kommse!“ Auch wenn sich Bradler fest vorgenommen hatte, einen unbeirrbaren Gesichtsausdruck aufzusetzen und stark zu wirken, flatterten innerlich die Nerven. Begleitet von einigen Grenzsoldaten mit angelegter Maschinenpistole brachten ihn die beiden Männer zu einem Wartburg. Sie öffneten die Tür, drückten seinen Kopf nach unten und schoben seinen Körper in den Wagen. In ruhiger Stimmlage ordnete einer der Männer an, Bradler solle die ganze Fahrt über den Kopf unten halten und auf die Knie drücken. Dann fuhr der Wagen los.
»Sieben Stunden – das war relativ kurz für eine Erstbefragung. Ich kenne Vernehmungen, die gingen etliche Stunden länger, teilweise über Tage. Da nutzte die Stasi einfach den Schock der Verhaftung aus.«
Nach einer Viertelstunde erreichten sie die Untersuchungshaftanstalt II der Staatssicherheit in der Magdalenenstraße, die im Stadtteil Lichtenberg direkt neben der Stasi-Zentrale gelegen war. Was folgte, war Michael Bradlers sogenannte Erstbefragung – sie dauerte sieben Stunden, von 21 Uhr abends bis 4 Uhr morgens. Dazwischen gab es eine Pause von 15 Minuten. „Sieben Stunden – das war relativ kurz für eine Erstbefragung, wie man heute weiß”, erklärt Bradler. „Ich kenne Vernehmungen, die gingen etliche Stunden länger, teilweise über Tage. Da nutzte die Stasi einfach den Schock der Verhaftung aus. Es gab sogar eine spezielle Abteilung innerhalb der Stasi, die sich ausschließlich mit Verhaftungen beschäftigte.“
Nach der Befragung wurde Michael Bradler – mit den Nerven durch und furchtbar müde – in eine kleine Zelle gesperrt. Doch an Schlafen war nicht zu denken, denn das Licht blieb angeschaltet und von außen wurde permanent die Klappe des Türspions geöffnet, um ihn zu beobachten. Am frühen Morgen öffnete sich die Zellentür wieder: „Kommse!“ Nachdem man seine Hände mit Handschellen auf dem Rücken fixiert hatte, führte man Michael Bradler in einen Innenhof und zwängte ihn in einen Lieferwagen mit der Aufschrift „Rewatex“ – ein Reinigungsunternehmen der DDR. In dem fensterlosen Kleintransporter gab es insgesamt fünf Zellen für Gefangene, jede 40 cm breit, 60 cm tief und 150 cm hoch. Die Tür ging zu, das Fahrzeug setzte sich in Bewegung. „In dem Moment hatte ich wahnsinnige Angst und fragte mich: Was passiert jetzt? Man erhält ja keinerlei Informationen, so nach dem Motto: Jetzt hat sich der Strafbestand erhärtet, jetzt ermitteln wir erst mal in aller Ruhe weiter. Eine wirkliche Anklage gab es erst viel später.“
In völliger Dunkelheit und ohne die Möglichkeit, sich mit gefesselten Händen irgendwo festzuhalten, schlug Michael Bradler mit seinem Kopf immer wieder gegen die Metallwände seiner kleinen Gefangenenzelle. Mal fuhr der Kleintransporter nach links, mal nach rechts, mal ruckelte er über Kopfsteinpflaster, mal fuhr er über glatteren Asphalt. Nach einer Weile hielt das Fahrzeug an und es war zu hören, wie ein großes Tor geöffnet wurde. Dann setzte sich der Transporter wieder in Bewegung und kam kurz darauf zum Stehen.
Die Tür des Lieferwagens wurde geöffnet und Michael Bradler aus dem Fahrzeug gezogen. Ein gleißendes Licht schlug ihm entgegen. „Man weiß nicht, wo man ist, und ist völlig orientierungslos. Dann kommt man aus dem Lieferwagen raus und steht in einem so hell erleuchteten Raum, dass man glaubt zu erblinden.“ Kaum war er ausgestiegen, wurde er auch schon über einige Treppenstufen hinauf zu einer Tür getrieben, dann ging es hin und her durch etliche Korridore. „Ich wurde regelrecht angebrüllt, das war permanente Einschüchterung”, berichtet er. „Kommense! Gehnse! Hände auf den Rücken! Kopf nach unten!“
»Man kann eine Durchsuchung menschenwürdig durchführen oder diskreditierend. Hier war das Diskreditierende an der Tagesordnung, egal ob der Gefangene männlich oder weiblich war.«
Dann wurde eine Tür aufgesperrt. „An die Wand! Ausziehen! Hose runter!“ Was jetzt passierte, bezeichnet Michael Bradler heute als sogenannte Entpersonifizierung. Vor einer Gruppe von Wachposten stand er nun splitterfasernackt da, musste sich bücken und wurde auf die entwürdigendste Weise durchsucht. „Als das passierte, war ich wie in Trance. Man kann eine Durchsuchung menschenwürdig durchführen oder diskreditierend. Hier war das Diskreditierende an der Tagesordnung, egal ob der Gefangene männlich oder weiblich war. Da haben die keinen Unterschied gemacht.“
Nach dieser Tortur wurde er wieder auf einen Gang getrieben, immer noch vollkommen nackt. Ein weiterer Raum öffnete sich, jetzt wurde die Häftlingskleidung ausgehändigt. Danach ging es weiter zu einem dritten Raum – seine zukünftige Zelle. „Darin gab es einen Holzhocker, einen Holztisch, ein Holzbett, eine Toilette und ein Waschbecken. Kein richtiges Fenster, nur Glasbausteine. Auf dem Bett lagen eine Matratze und Bettzeug. Das war’s.“ Als er nun alleine in seiner Zelle war, so sagt er, sei Angst für ihn ein riesengroßer Faktor gewesen. „Was könnte jetzt passieren? Was machen die mit mir? Man malt sich viele Sachen aus, aber findet keine Antworten.“ Irgendwann schlief Michael Bradler ein. Einige Zeit später – wann genau, daran kann sich Bradler nicht mehr erinnern – wurde er aus seiner Zelle geholt: „Kommse!“ Und dann ging es wieder über diverse Gänge. Wenn an der Decke eine rote Lampe anging, musste er stoppen. Dann hieß es: „Halt! Gesicht zur Wand!“ Mit Hilfe roter und grüner Lampen wollten die Wachposten vermeiden, dass sich einzelne Gefangene auf den Korridoren begegnen. Leuchtete die Lampe rot, wurde gerade ein anderer Häftling durch einen Gang geführt. Leuchtete sie grün, war der Weg wieder frei.
Michael Bradler wurde nun einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl mit dem Aktenzeichen „HsC.: 1/82“ verlas: „Der BRADLER, Michael – geb. am 22.6.1961 in Berlin ist in Untersuchungshaft zu nehmen. Er wird beschuldigt, sich der landesverräterischen Nachrichtenübermittlung schuldig gemacht zu haben, indem er im Zeitraum von August bis Dezember 1981 7 Anträge an staatliche Organe der DDR gerichtet hat, um seine Entlassung aus der Staatsbürgerschaft zu erreichen. Gleichzeitig informierte er den westberliner Bürger (geschwärzt) über diese Aktivitäten. Er übersandte ihm zwei Durchschriften seiner Ausreiseanträge und telefonierte zu diesem Zweck ständig mit ihm und führte mit diesem einen Treff in der Tschechoslowakei durch. (geschwärzt) wurde von ihm beauftragt, ihm Hilfe bei der beabsichtigten rechtswidrigen Übersiedlung nach Berlin-West zu gewähren und zu diesem Zweck Verbindung zu den entsprechenden Stellen in Berlin-West herzustellen. Verbrechen gem. § 99 (1) StGB. Er ist dieser Straftat dringend verdächtig. Die Anordnung der Untersuchungshaft ist gemäß § 122 (1) 2 StPO gesetzlich begründet, weil ein Verbrechen den Gegenstand des Verfahrens bildet.“ (Quelle: Haftbefehl, Kopie BStU)
»Zwölf Jahre Knast? Landesverräterische Nachrichtenübermittlung? Ich habe doch nur Ausreiseanträge gestellt.«
Was nicht im Haftbefehl stand, war der Satz, den der Haftrichter noch nachgeschoben hatte: „Die Höchststrafe für landesverräterische Nachrichtenübermittlung beträgt zwölf Jahre.“ Als Michael Bradler wieder zurück in seine Zelle geführt wurde, war er geschockt. Er konnte es einfach nicht glauben: „Zwölf Jahre Knast? Landesverräterische Nachrichtenübermittlung? Ich habe doch nur Ausreiseanträge gestellt.“ Heute weiß er, dass es das Ziel der Stasi war, ihn durch diese abschreckende Ankündigung zu zermürben und ihm den Gedanken auszutreiben, die DDR verlassen zu wollen.
„Die nächsten Wochen und Monate wurden bestimmt von unzähligen Vernehmungen, in den ersten vier Wochen täglich, dann wurden die zeitlichen Abstände größer”, erinnert sich Michael Bradler. „Wie viele Vernehmungen ich aber letztendlich hatte, kann ich nicht lückenlos nachvollziehen. Es gab nicht von jeder Vernehmung ein handschriftliches oder per Schreibmaschine verfasstes Protokoll. Es gab auch keine feste Dauer. Mal dauerte eine Vernehmung den ganzen Tag mit einer kurzen Pause zwischendurch, mal dauerte sie nur ein, zwei Stunden. Dahinter war kein System zu erkennen – genauso wie nicht zu erkennen war, was die überhaupt von mir wollten.“
Während dieser Zeit fing die Stasi an, in Bradlers Umfeld zu recherchieren. MfS-Mitarbeiter befragten Nachbarn, Arbeitskollegen Freunde aus dem Sportverein und Familienmitglieder. Teilweise wurden diese Personen zu einer Befragung vorgeladen. „Die Stasi versuchte herauszufinden, wer mich dazu bringen könnte, in der DDR zu bleiben. Sie entschied sich dann relativ schnell für meinen Vater, was aus der damaligen Sicht auch eine logische Entscheidung war. Meine Mutter war tot, meine Großeltern waren im Westen, da war der Vater eine umso stärkere Bezugsperson.“ Die Strategie der Stasi, so erzählt Bradler, sei es daraufhin gewesen, in den Vernehmungen systematisch seine Familie schlechtzumachen: „Sie sagten, mein Bruder hätte mich belogen, meine Schwester hätte mich belogen, mein bester Kumpel auch und meine Großeltern sowieso. Nur mein Vater hätte mich nie belogen. Er wäre der Einzige gewesen, der mir gegenüber immer ehrlich gewesen wäre. Und so haben sie ein Treffen mit meinem Vater organisiert, um mich mit ihm zu konfrontieren.“
»Mein Vater versuchte mich umzustimmen und sagte: ›Entweder du ziehst jetzt deine Ausreiseanträge zurück oder du bist nicht mehr mein Sohn. ‹«
Für dieses Treffen, das in der Haftanstalt in der Magdalenenstraße stattfinden sollte, wurde Michael Bradler nach Lichtenberg gefahren – wieder im Kleintransporter. „Mein Vater versuchte mich umzustimmen und sagte: ‚Entweder du ziehst jetzt deine Ausreiseanträge zurück oder du bist nicht mehr mein Sohn.’ Und das hatte er auch so gemeint. Mein Vater war voll und ganz von dieser DDR überzeugt. Er wuchs mit dem ideologischen Bild auf, dass die DDR das Gute verkörperte und der Westen ihr natürliches Feindbild war. Ich glaube nicht, dass er die Wende verstanden hätte, wenn er sie noch erlebt hätte.“
Michael Bradler ließ sich von seinem Vater nicht umstimmen und wurde zurück nach Hohenschönhausen gebracht. Vater und Sohn sahen sich nach diesem Treffen nie wieder, der Vater starb 1985 mit 53 Jahren. „Bis dahin“, sagt Bradler, „hätten sie alles wieder einstampfen können. Sie hätten sagen können: ‚Okay, jetzt bist du geläutert. Du gehst zurück in die DDR, ordnest dich da unter und lebst dein Leben weiter – natürlich ohne jemals darüber zu berichten, dass du hier inhaftiert warst.’ Doch darauf wollte ich einfach nicht eingehen. Für mich war damals die Perspektive relativ schlecht, wieder in die DDR eingegliedert zu werden, denn ich hätte davon ausgehen müssen, dass ich ständig im Visier der Stasi gewesen wäre oder dass ich – als nächste Konsequenz – meine Großeltern nicht wiedergesehen hätte.“
Bis ihm am 20. Mai 1982 endlich der Prozess gemacht wurde, hatte Michael Bradler in der Einzelhaft mit „zermürbender Langeweile“ zu kämpfen, wie er es nennt. „Wie viele Leute dem Druck nicht standgehalten haben und in der Isolationshaft tatsächlich durchgedreht sind, weiß man nicht. Man konnte das nur aushalten, wenn man für sich irgendeine Beschäftigung finden konnte – aber dafür gab es natürlich keinen Ratgeber. Die einen haben Matheaufgaben gelöst, die anderen haben Gedächtnisprotokolle erstellt, wieder andere haben gebetet”, erzählt er. „Ich selbst habe irgendwann angefangen, Würfel aus Brot, Marmelade und Wasser zu basteln. Das fand ich sehr entspannend. Man muss nur aufpassen, nicht erwischt zu werden – es war ja verboten, sich zu beschäftigen.
Mitte März hatte für Michael Bradler die Einzelhaft ein Ende, er wurde in eine Zweierzelle verlegt: „Ich hatte endlich einen Gesprächspartner, das war natürlich eine schöne Sache. Aber ich war auch recht misstrauisch, denn ich wusste nicht, ob mein Gegenüber Freund oder Feind war.“ Bradlers Zimmergenosse hieß Horst und war 52 Jahre alt. „Auch das war, denke ich mal, beabsichtigt. Wenn man zwei 20-Jährige in eine Zelle sperrt, kommen die immer schnell auf dumme Gedanken. Aber ein 52-Jähriger und ein 20-Jähriger, da gibt es keine wirklichen Schnittpunkte. Das war auch bei uns beiden so, wir fanden einfach keine gemeinsame Basis. Einige Jahre später habe ich Horst noch zwei, drei Mal in West-Berlin getroffen, aber auch da haben wir gemerkt, dass unsere Interessen einfach zu unterschiedlich sind.“
»Rechtsanwalt Dr. Vogel war bei denen, die aus der DDR ausreisen wollten, ein Begriff. Man vermutete, dass der gesamte Häftlingsfreikauf über ihn abgewickelt wurde.«
Etwa vier Monate nach seiner Inhaftierung hatte Michael Bradler zum ersten Mal die Möglichkeit, mit einem Rechtsanwalt zu sprechen. Bereits im Februar war ihm während einer Vernehmung ein Buch vorgelegt worden mit den Worten: „Da stehen alle Anwälte der DDR drin. Suchen sie sich einen aus!“ Bradler entschied sich für Rechtsanwalt Dr. Vogel: „Der war bei denen, die aus der DDR ausreisen wollten, ein Begriff. Man vermutete, dass der gesamte Häftlingsfreikauf über ihn abgewickelt wurde.“
Nachdem Bradler nicht auf das Angebot seines Vaters eingegangen war, wurde am 14. Mai 1982 Anklage erhoben – wegen „versuchter landesverräterischer Nachrichtenübermittlung, strafbar als Verbrechen gemäß § 99 (1), (2) StGB.“ Für Michael Bradler war das Lesen der Anklageschrift eine große Freude, denn die Tatsache, dass er wegen einer politischen Straftat verurteilt werden würde, war die Grundvoraussetzung, um auf die Freikaufliste der BRD zu gelangen. „Das war die Fahrkarte in die Freiheit!“ Gleichzeitig war er aber auch ziemlich angespannt, denn er hatte ja keine Garantie, dass dieser Plan auch wirklich gelingen würde.
Nach einem zweitätigen Prozess unter – de facto – Ausschluss der Öffentlichkeit wurde Michael Bradler schließlich am 24. Mai 1982 zu einem Jahr und vier Monaten Haft verurteilt, allerdings nicht, wie in der Anklage gefordert, wegen „versuchter landesverräterischer Nachrichtenübermittlung“, sondern wegen „landesverräterischer Agententätigkeit“, strafbar nach § 100 StGB der DDR. „Verurteilt haben sie mich nicht, weil ich meinen in West-Berlin lebenden Großeltern erzählt hatte, dass ich mehrere Ausreiseanträge gestellt hatte – das wäre ‚landesverräterische Nachrichtenübermittlung’ gewesen. Aber das fanden sie wohl selber doof”, erklärt Bradler. „Verurteilt haben sie mich letztendlich aus dem Grund, weil ich mich mit einem Kumpel getroffen und ihm Kopien meiner Ausreiseanträge in die Hand gedrückt hatte, die er mit in den Westen nehmen sollte. Das war die sogenannte Agententätigkeit.“ Diese „Tat“ hatte Bradler bereits in seiner Erstbefragung am 10. Januar geschildert. „Wenn sie gewollt hätten, hätten sie mich also einen Tag nach meiner Verhaftung verurteilen können. Aber das wollten sie nicht.“
»In Cottbus war ich mit einem Wärter konfrontiert, der alles in den Schatten stellte, was ich bisher erlebt hatte.«
Nachdem das Gerichtsurteil rechtskräftig wurde, wurde Michael Bradler am 15. Juni in die Haftanstalt Rummelsburg im Südosten Berlins verlegt, kurz darauf ging es weiter ins sogenannte Zuchthaus Cottbus. Kaum dort angekommen, war er auch schon mit einem Wärter konfrontiert, „der alles in den Schatten stellte, was ich bisher erlebt hatte”, schildert Bradler. „In einer großen Sammelzelle mussten wir Aufstellung nehmen. Nach einer Weile kam ein Kerl, der uns erst mal brüllend darüber aufklärte, dass er ein ‚Erzieher’ sei. Wir sollten hier nämlich zu ‚ordentlichen Mitgliedern der sozialistischen Gesellschaft’ erzogen werden.“
Dieser „Erzieher“ hieß Hubert Schulze. Von den Gefangenen in Cottbus wurde er aber nur „Roter Terror“ genannt. „Er war einer von insgesamt zwei Gefängniswärtern, die nach der Wende zu einer Haftstrafe verurteilt wurden”, erzählt Michael Bradler. Zum Prozessauftakt im Oktober 1996 schrieb „Welt online“: „Hubert Schulze – ‚Roter Terror’ oder ‚Reservetod’ nannten ihn die Tausende von Häftlingen, die jahrzehntelang durch seine Cottbuser Gefängnishölle gingen. Der heute 61-Jährige mit der kräftigen Statur – ‚Ich bin Wachmann bei einem privaten Sicherheitsdienst’ – schlug Gesichter blutig (wenn jemand beispielsweise seinen Ausreiseantrag nicht zurückziehen wollte), stieß Gefangene die Treppe hinunter, ließ sie stundenlang in eiskalten Wasserbecken sitzen, trat ihnen mit Knobelbechern in den Unterleib.“ (Quelle: Welt online)
Den Misshandlungen von „Roter Terror“ konnte Michael Bradler in Cottbus entgehen, dennoch war er dort, wie alle anderen Häftlinge, permanenten Repressalien ausgesetzt. Dazu kam, dass er stellenweise mit bis zu 19 anderen, „normalen“ Kriminellen in einer gemeinsamen Zelle saß – mit einer einzigen Toilette. Ohne Trennwand. Als sich Bradler einmal krank meldete, der Arzt ihm nicht glaubte und „viel Wärme“ verordnete, wurde er in den Keller der Haftanstalt gebracht: „Dort befand sich ein Bretterverschlag, etwa eineinhalb mal eineinhalb Meter groß, in den ich eingesperrt wurde. Ein Stuhl, sonst nichts. Direkt über dem Stuhl hing eine 200 Watt-Lampe, die mir ständig auf den Kopf schien.“ So verharrte Michael Bradler ganze acht Stunden lang in Totenstille und ohne ein Glas Wasser. Später erfuhr er, dass dieser Verschlag von den Häftlingen „die Straßenbahn“ genannt wurde. „Ein gefürchteter Ort, bestens geeignet, Widerstand zu brechen und ein für allemal auszuschalten“, erzählt er.
Ende September wurde er gemeinsam mit anderen politischen Häftlingen wieder verlegt, diesmal ins Zuchthaus Karl-Marx-Stadt, dem heutigen Chemnitz. „Dort gab es eine rätselhafte Anweisung“, so Bradler. „Wir mussten unser gesamtes Geld ausgeben und wurden in einen offenbar extra hierfür eingerichteten Laden geführt.“ Für ihn war klar: „Freigekaufte sollten keine Ostmark ausführen.“ Seine Hoffnung wuchs rapide an, es konnte also nur noch eine Frage der Zeit sein, bis er endlich freigekauft wurde.
Dann kam der 14. Oktober 1982, ein Donnerstag. Michael Bradler wurde in das Büro der Gefängnisverwaltung beordert. „Ich konnte fast nicht mehr stillstehen vor lauter Aufregung! Kurz und knapp hieß es: ‚Hier ist ihre Urkunde über die Entlassung aus der Staatsbürgerschaft der DDR und ihr Haftentlassungsschein. Sie verlassen das Staatsgebiet der DDR noch heute.’“
„Schon am Mittag war es soweit“, erinnert sich Bradler. „Im Hof warteten zwei futuristische Reisebusse mit Schiebetüren, das war für DDR-Augen nicht normal. Die zwei Busse brauchten wir auch, denn wir waren um die 80 Häftlinge. Dass so viele Leute auf einmal in den Westen gefahren wurden, hatte damit zu tun, dass eine Zeit lang auf dem ‚Freikaufmarkt’ nichts passiert war. Durch den Regierungswechsel in der Bundesrepublik wusste in der DDR keiner, ob die neue Kohl-Regierung auf die bestehende Vereinbarung beibehalten würde.“
»Dort ist etwas passiert, was ich nie geglaubt hätte: Die Nummernschilder der Reisebusse haben sich gedreht, per Knopfdruck.«
„Die Busse setzten sich in Bewegung und fuhren – im Konvoi mit zwei Stasi-Fahrzeugen – zum Grenzübergang Wartha/Herleshausen“, erzählt Michael Bradler. „Dort ist etwas passiert, was ich nie geglaubt hätte, wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte: Die Nummernschilder der Reisebusse haben sich gedreht, per Knopfdruck. Aus der Haftanstalt heraus waren sie noch mit DDR-Kennzeichen gefahren, jetzt waren plötzlich Nummernschilder aus dem Westen zu sehen.“ Und er berichtet weiter: „Die Busse haben auch keine Sekunde mehr auf DDR-Gebiet angehalten, soweit ich mich erinnern kann. Selbst die im Bus sitzenden Stasi-Mitarbeiter sind während des Grenzübertritts aus dem fahrenden Bus gesprungen.“
Es war geschafft, Michael Bradler war in Westdeutschland: „Als wir die Grenze hinter uns gelassen hatten, machte der Busfahrer eine Ansage, die ich mein Leben lang nicht vergessen werde: ‚Wir verlassen jetzt die Rollpiste der DDR und befahren eine bundesdeutsche Autobahn.’ Schlagartig war der Bus ruhig, unter unseren Rädern hatten wir glatten BRD-Autobahnasphalt.“ Gemeinsam mit den anderen freigekauften Häftlingen wurde Michael Bradler nach Gießen gebracht, ins damalige Notaufnahmelager für DDR-Flüchtlinge. „Es gab ein Begrüßungsgeld von 150 DM, außerdem hatten wir ein Telefonat frei. Ich habe meinen alten Schulfreund Thomas in West-Berlin angerufen – aber der war schon auf dem Weg nach Gießen“, erzählt Bradler. „Thomas hatte Kontakt zur Kanzlei Dr. Vogel aufgenommen, aber da man ihm dort keine genaue Auskunft geben konnte, war er am selben Tag auf gut Glück von Berlin losgefahren.“
So sahen sich die beiden Freunde in Gießen wieder, ziemlich genau ein Jahr nach ihrem Treffen in der Tschechoslowakei. Kaum hatten sie sich begrüßt, beschlossen sie, so schnell wie möglich wieder nach Berlin zu fahren. Während sich Thomas mit dem Auto alleine auf den Rückweg machte, versuchte Michael Bradler in Gießen, noch bis zum Schließen der Ämter am frühen Freitagmittag alle erforderlichen Behördengänge hinter sich zu bringen. Am Abend nahm er einen Flug nach Tegel – zum ersten Mal in seinem Leben fliegen.Warum es Bradler zurück nach Berlin zog, ist für ihn logisch: „Meine Großeltern lebten in West-Berlin, das war mein wichtigster Bezugspunkt. Wären sie in München gewesen, wäre ich nach München gegangen, wären sie in Hamburg gewesen, wäre ich nach Hamburg gegangen. Im Prinzip habe ich Berlin nicht verlassen.“
So fing Michael Bradler am 15. Oktober 1982, sieben Jahre vor dem Fall der Mauer, ein neues Leben an: „Mir war völlig klar: Im Westen schenkt dir keiner was. Um zu etwas zu kommen, muss ich mich reinhängen. Aber durch meine Großeltern hatte ich natürlich einen verhältnismäßig einfachen Start. Und mit meiner Berliner Schnauze bin ich in West-Berlin nicht aufgefallen ¬– das nimmt sich hier vom Dialekt ja nüscht. In München oder Hamburg wäre das wohl anders gewesen.“ Bereits kurze Zeit später nahm Michael Bradler, der in der DDR Feinmechaniker gelernt hatte, einen Job in der Metallverarbeitung an, erst bei einer Privatfirma in Kreuzberg, danach bei Zeiss Ikon. „Aber dort habe ich 1987 gekündigt“, erzählt er. „Dieser Herrschafts- und Befehlston des Meisters ging mir ziemlich auf den Geist.“ Und so machte er sich wenig später selbständig. 1988 heiratete er und kurz darauf wurde sein Sohn geboren.
»Es ist gerade mal acht Uhr, wie besoffen können sie eigentlich sein?«
Als der Abend des 9. November 1989 kam, saß Bradler in einem Restaurant im West-Berliner Stadtteil Wilmersdorf: „Gegen 20 Uhr stürzte ein Taxifahrer rein und sagte: ‚Die Mauer ist offen!’ Ich habe ihn erst mal völlig entgeistert angeschaut und gefragt: ‚Es ist gerade mal acht Uhr, wie besoffen können sie eigentlich sein?’ Am Stammtisch des Restaurants unterhielten sich die Leute auch darüber, dass da irgendetwas passiert sein müsste. Aber was genau, das wusste keiner.“ Gegen 22:30 Uhr fuhr Michael Bradler nach Hause und rief seinen Schulfreund Thomas an. Spontan beschlossen sie, zum Grenzübergang Invalidenstraße zu fahren, der einer der ersten war, der nach der Bornholmer Straße geöffnet wurde. „Bereits am Lehrter Bahnhof kamen uns so viele Leute entgegen, dass wir das Auto stehen lassen mussten. Dann sind wir gegen den Strom von West- nach Ost-Berlin gelaufen“, erzählt er. „Wir haben uns überhaupt keine Gedanken gemacht. Wäre ich da einer Polizeistreife in die Hände gefallen, wäre ich vielleicht wieder verhaftet worden – ich hatte als Westler ja keine Genehmigung, nach Ost-Berlin zu fahren. Ohne Visum und ohne Zwangsumtausch war ich nicht berechtigt, mich hier aufzuhalten.“
Obwohl Michael Bradlers Geschwister noch in Ost-Berlin lebten, zog es ihn nicht mehr zurück. Er blieb lieber in West-Berlin, lebte sein freies Leben und schob die Zeit, die er in DDR-Gefängnissen verbracht hatte, weit von sich weg. „Was sollte ich die Leute im Westen damit nerven?“, fragt er. „Wenn ich mal erzählt habe, dass ich in der DDR im Gefängnis saß, und dann noch bei der Stasi, dann wurde ich gefragt: ‚Wo genau hast du denn bei der Stasi eingesessen?’ Ich sagte, ich weiß es nicht. Aber das konnten sie nicht glauben und warfen mir vor, sie anzulügen. Irgendwann lässt man es dann bleiben. Was sollte ich ihnen auch anderes sagen? Ich wusste ja wirklich nicht, wo ich in Haft war. Immer wenn ich nach Hohenschönhausen gebracht oder von dort weggefahren wurde, saß ich in einem Transporter ohne Fenster.“
»Mein Sohn ist mit einem normalen Rechtsempfinden aufgewachsen und weiß, was man darf und was nicht. Für ihn bedeutete das: Wenn der Vater im Gefängnis war, musste der irgendetwas Böses angestellt haben.«
Erst im Jahr 1998 fing Michael Bradler an, über seine Geschichte nachzudenken. „Als mein Sohn zehn Jahre alt war, hat er mal mitbekommen, dass ich im Gefängnis saß. Für einen Zehnjährigen ist so etwas schwer zu verstehen. Mein Sohn ist ja mit einem normalen Rechtsempfinden aufgewachsen und weiß, was man darf und was nicht. Für ihn bedeutete das: Wenn der Vater im Gefängnis war, musste der irgendetwas Böses angestellt haben.“ So fing Bradler an zu recherchieren, tätigte ein paar Telefonate und stand irgendwann in der Gedenkstätte Hohenschönhausen, wo er an einer Führung teilnahm. „Dadurch habe ich erst 1998 erfahren, dass ich tatsächlich hier inhaftiert war“, erzählt er. Kurzerhand meldete sich Bradler im Zeitzeugenbüro – und übernahm wenig später selbst Führungen durch das ehemalige Gefängnis sowie die Stasi-Zentrale in der Normannenstraße.
Im Sommer 2001 begegnete ihm bei einer seiner Führungen ein Nürnberger Rechtsanwalt namens Michael Rothe. Die beiden freundeten sich an und veröffentlichten im November 2011 ein gemeinsames Buch mit dem Titel „Ich wollte doch nicht an der Mauer erschossen werden!“ In diesem Buch erzählen sie nicht nur Michael Bradlers Geschichte: Es geht ihnen auch darum, diese Geschichte mit „Gedanken zum aktuellen politischen Geschehen zu verbinden“ und aufzuklären – „über die häufig zu beobachtende Unwissenheit über die Zustände und Ängste in der DDR, oft eine regelrechte Ignoranz gegenüber dem sogenannten ‚real existierenden Sozialismus’.“
Für ihr Buch trafen Bradler und Rothe am 23. Mai 2011 auch einen ehemaligen Stasi-Offizier aus Hohenschönhausen, der Michael Bradler regelmäßig vernommen hatte. „Angst hatte ich vor dieser Begegnung keine, eher so ein generelles Unwohlsein. Ich musste während des Gesprächs mehrfach zur Toilette“, erzählt Bradler. „Drei Stunden dauerte das Interview und ich war richtig erleichtert, als es vorbei war. Man darf nicht vergessen: Ich war dem Mann fast ein halbes Jahr ausgeliefert.“ Am Ende gab „Leutnant X“ – so nennen Bradler und Rothe ihn in ihrem Buch – sein Einverständnis für die Veröffentlichung der Zitate – mit der Bedingung, seinen Namen nicht zu nennen. „Daran habe ich mich auch gehalten“, sagt Michael Bradler, „um andere Leute nicht zu verprellen, die einen Weg suchen, ihre Vergangenheit aufzuarbeiten. Ich habe den Vernehmer auch gebeten, sich mal mit der Gedenkstätte in Verbindung zu setzen. Es gibt dort noch viele offene Fragen, die man gerne an ehemalige Mitarbeiter des Gefängnisses stellen würde. Das hat er aber nicht getan – genauso wie er sich nie wieder bei mir gemeldet hat.“
»›Der Vernehmer kommt rein, schaut zuerst auf den Kaffee, dann auf mich und sagt: Den Kaffee könnse ruhig trinken, da ist nichts drin.‹ Dann geht er wieder raus.«
Das Kapitel im Buch, das die Abschrift des Gesprächs mit dem ehemaligen Vernehmungsoffizier beinhaltet, trägt die Überschrift „Der ‚gute Vernehmer’“. Ein „guter Vernehmer“, so Bradler, sei im Gegensatz zu einem „bösen Vernehmer“ einer, mit dem man eine Beziehung aufbauen könne. „Er bietet dir einen Kaffee oder eine Zigarette an. Oder er erlaubt dir, einen Brief zu schreiben. Der ‚böse Vernehmer’ gibt immer nur negative Information. Ein Beispiel: Der ‚gute Vernehmer’ bestellt mir einen Kaffee. Der Kaffee wird gebracht, ich trinke davon. In dem Moment, in dem ich den ersten Schluck getrunken habe, kommt der ‚böse Vernehmer’ rein. Er schaut zuerst auf den Kaffee, dann auf mich und sagt: ‚Guten Tag. Den Kaffee könnse ruhig trinken, da ist nichts drin.’ Dann geht er wieder raus. Und du fängst an zu überlegen: Was meint der eigentlich? Plötzlich wird dir klar, dass alles, was du hier drin bekommst, manipulierbar ist. Du bist denen auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Und weil du auf diese Erkenntnis erst einmal gebracht werden musst, braucht es so jemanden wie den ‚bösen Vernehmer’.“
Einen Groll trägt Michael Bradler nicht in sich – jedenfalls nicht mehr: „Wäre mir 1998 mein Vernehmer über den Weg gelaufen, ich glaube, ich hätte ihm aufs Maul gehauen. Aber heute sehe ich das entspannter – auch weil ich weiß, dass ich ihn viel mehr ärgere, indem ich die Leute hier durch Hohenschönhausen führe. Für mich ist das eine innere Genugtuung. Ich muss mir immer vorstellen, wie das wohl gewesen wäre, wenn ich damals im Jahr 1982 meinem Vernehmer gesagt hätte, dass ich hier irgendwann einmal Gruppen aus dem Westen durchführen würde. Ich glaube, der hätte mich in die Psychiatrie einweisen lassen. So sehe ich mich letztendlich als Sieger der Geschichte.“
„Mein persönlicher Anspruch ist, vor allem junge Menschen für Geschichte zu interessieren, weil man nur aus Geschichte heraus verantwortungsvoll mit Gegenwart und Zukunft umgehen kann. Hohenschönhausen ist dafür ein optimaler Ort, denn hier wird Geschichte durch Menschen vermittelt, die sie selbst erlebt haben“, erklärt Bradler. „Manchmal bin ich wirklich erschrocken, wie groß das Unwissen vor allem bei Schülern ist. Beispielsweise wurde ich mal während einer Führung von einer Schülerin gefragt, warum die Nazis den Reichstag so dicht an die Mauer gebaut hätten. Da fällt einem nichts mehr ein, da ist man sprachlos.“
»Mein persönlicher Anspruch ist, vor allem junge Menschen für Geschichte zu interessieren, weil man nur aus Geschichte heraus verantwortungsvoll mit Gegenwart und Zukunft umgehen kann.«
„Aber man darf nicht aufgeben“, fügt Michael Bradler hinzu. „Mir ist bewusst, dass ich mit meinen Führungen nicht jeden Besucher erreichen kann. Aber manchmal gelingt es mir, bei dem einen oder anderen Menschen tatsächliches Interesse zu wecken und ihn dazu zu bewegen, an diesen Ort zurückzukommen. Vielleicht kommt er nach Wochen wieder, vielleicht nach Monaten, vielleicht erst nach Jahren. Aber er kommt. Und das gibt Hoffnung.“
Michael Bradler wird nicht müde, immer neue Besucher durch die ehemalige Untersuchungshaftanstalt I des Ministeriums für Staatssicherheit zu führen. „Wahrscheinlich würden die Stasi-Offiziere, die hier mal gearbeitet haben, die Führung etwas anders gestalten als ich“, sagt er mit einem Lächeln auf dem Gesicht. „Die Chance hätten sie ja unter bestimmten Voraussetzungen. Aber sie nehmen sie nicht wahr, sie kommen ja nicht her.“
Mit besonderem Dank an Michael Bradler sowie die Mitarbeiter der Stiftung Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen und des Stasimuseum / ASTAK e.V.
Michael Bradler & Michael Rothe: „Ich wollte doch nicht an der Mauer erschossen werden!“
ISBN: 978-3-00035544-8, zu bestellen beispielsweise auf mbradler.jimdo.com oder buchhandlung89.de
Alper Yamak
Editorial — Alper Yamak
Wandering With Ghosts
22. Januar 2018 — MYP N° 22 »Resistance« — Text & Photography: Alper Yamak
Wandering With Ghosts: AKM at Gezi Protests
On 31st of May, 2013, masses marched on the streets of Istanbul to protest against the unlawful demolition of a small park—Gezi Park—at Taksim Square. Alongside the demolition of the park, people also protested police forces’ excessive response to peaceful activists in previous days using tear gas.
In the following days, in more than 50 cities in Turkey, around 2.5 million people took on the streets due to Turkish Government’s uncompromising attitude and offensive statements of Turkish PM Erdoğan. While the unbalanced growth of construction madness all over the city caused the loss of many green areas in the recent years, a small environmentalist protest turned into a civil uprising against the government’s anti-democratic policies on the secular system and civil rights. The police reaction was harsh. In a couple of days, four people died and twelve people lost their eyes because of tear gas canisters aimed directly towards them. Thousands of people were injured and arrested.
On 1st of June, despite the ongoing police violence and casualties, the protestors took Taksim Square and occupied Gezi Park. At the heart of Taksim Square, there’s an abandoned building called AKM—Atatürk Culture Center. AKM was used as an opera house, as well as a concert hall and a show center. This building had become a symbolic conflict between Islamic AKP government and secular public groups in Turky. AKM, as one of the biggest cultural centers of Istanbul, was closed by the government for rebuilding and renewing purposes, though no renewal action was done at all.
When Taksim Square was taken by protesting on 1st of June, an access to this abandoned building was found. The protestors who had been there for concerts or shows years ago were now wandering in the dilapidated flats. It was a symbolic conquest for most of the people. Access to the building triggered something in people’s mind: We have to take back what is ours! Our green areas, our buildings, our city, and our rights!
These photos were shot in the mood of this insurrection.
Update—January 10th, 2018:
Aftermath and post effects of Gezi protests are ironic and indistinct since the freedom of speech, rights to the protest, and the democratic civil rights has retrograde dramatically due to the governments increasing strict state laws and police control. Now in 2018, the masses that marched in the streets in 2013 are smothered and dismayed by the government’s threating and preventing measures. Heavily equipped police forces in huge numbers and government’s intelligence service—which is inclined to see every democratic civil action as a terrorist act—discourage and frustrate millions of people to march or demonstrate again in that size.
On the other hand, AKP regime is also startled at Gezi, all the precautions and sometimes nonsense measures that have been taken are just the indicators of this fear. Gezi Park also stays as a park and no further recreating or demolishing has been taken place although President Erdoğan makes mumbling statements of recreating/demolishing of the park.
Gezi resistance is a blossoming of a social and political awareness more than a revolutionary or end of an era act. The idea and the soul of Gezi are still in people’s minds and hearts and very alive. Today in the Turkish society, there is a silent anticipation for a decline of AKP government.
In 2017, after four years of Gezi protests, AKP government announced the renewing of AKM has begun and in 2019, the building will be in public service as an opera house and cultural center.
Alper Yamak is a filmmaker, photographer and musician based in İstanbul. He stills believe in the power of photo journalism.
Hengameh Yaghoobifarah
Portarit — Hengameh Yaghoobifarah
Ein Plausch über Privilegien
Dick, queer, laktoseintolerant: Aktivist_in Hengameh Yaghoobifarah beschwert sich gerne und laut über gesellschaftliche Ungerechtigkeiten. Wir treffen sie zum veganen Dinner und sprechen über Dinge, die so richtig schief laufen.
22. Januar 2018 — MYP No. 22 »Widerstand« — Interview & Text: Katharina Weiß, Fotos: Moritz Jekat
Neulich stand ich vor meinem Uni-Institut und rauchte eine Zigarette. Ich unterhielt mich mit einer Bekannten über den Sommer und sie bemerkte, dass ich über den Sommer hinweg deutlich abgenommen hatte – und fragte wie und warum. Der Grund für die Schlankheitskur war klar ästhetisch: Meine teuren Lena Hoscheck-Röcke passten nicht mehr. Also sollte der Bourbon-Bauch weichen, um mir erneuten Zugang zu meinem Kleiderschrank zu gewähren. Sachlich erklärte ich ihr, dass ich, um dieses Ziel zu erreichen, einfach wenig gegessen, nur noch puren Schnaps ohne Mixgetränk getrunken und jede Menge sehr amateurhafte Ballettaerobic betrieben hätte. Da kommentierte ein beistehender junger Herr, der das wohl zufällig belauscht hatte, dieses Szenario mit folgenden Worten: „Die Figur eines Topmodels hast du jetzt aber auch nicht.“
Autsch, dachte ich mir in der ersten Sekunde und ärgerte mich gleich danach: Warum impliziert jede Art von ästhetischem Ziel, dass ich aussehen muss und möchte wie ein Topmodel? Und warum nimmt sich jemand – selbst wenn es ohne böse Absicht geschah – heraus mir zu sagen, wie ich nicht aussehe? Womit ein gleichzeitiges „nicht gut“ impliziert war. Im nächsten Schritt dieses Gedankens wurde ich dann wirklich wütend und dachte mir: Wenn ich als weiße Cis-Frau mit durchschnittlichen Maßen schon ständig so traurig gemacht werde, wie muss es dann sein, als Körper durch diese Welt zu gehen, der ständig negativ kommentiert wird und dem ganz viele meiner Privilegien von vornherein abgesprochen werden?
»Wenn mir die Rechte von Frauen wichtig sind, dann müssen mir auch die Rechte von allen Frauen wichtig sein.«
Dabei geht es nicht nur um Frauen und Menschen, die zu dick oder zu groß sind. Was ist mit denen, die nicht weiß genug oder nicht heteronormativ genug sind? Oder zu viel von sich bedecken und sich jeden Tag dafür rechtfertigen müssen? Wie kann ich als weißer, gesunder Körper den Kampf um genderspezifische Ungleichheiten für mich führen, ohne dabei die Mehrfachdiskriminierung anderer Menschen aus dem Blick zu verlieren? „Wenn mir die Rechte von Frauen wichtig sind, dann müssten mir auch die Rechte von allen Frauen wichtig sein. Also sollten auch Frauen, die nicht-weiß oder dick sind, davon profitieren, dass du dich immer wieder laut für ein gerechteres Geschlechterbild aussprichst“, sagt Aktivist_in Hengameh Yaghoobifarah dazu.
Das politische Schaffen dieser Person ist nicht in einem Stichwort zusammenzufassen, da sie viele brennende Gesellschaftsthemen in sich vereint: Journalistin_in; muslimisch markiert; nicht-binär; ein Mensch, der sich innerhalb der Geschlechterzweiteilung einordnet; dick und Advokat_in von „Body Positivity“-Bewegungen. Aber unabhängig von all diesen harten politischen Diskursen ist Hengameh auch Online-Shopper_in, und zwar sehr passioniert; aufgewachsen in einer Kleinstadt bei Hamburg; DJ von wilden Sets mit nahöstlichen Melodien und kontemporärem Hip Hop; Bewohner_in Neuköllns; Fashionblogger_in und Host der Website queervanity.com; laktoseintolerant; ein Mensch, der witzig sein kann und das blöde Schema von der Drei-Tage-Wartefrist nach dem ersten Date mit „Wir sind doch hier nicht beim Amt!“ kommentiert.
Wir treffen uns im CocoLiebe, wo wir uns einen Sushi-Burger und eine vegane Hummus-Pizza teilen und über die Macht der Kategorien sprechen: „Kategorien sind immer konstruiert und nicht von Natur aus gegeben. Diese menschengemachten Faktoren wie Klasse oder Geschlecht haben massive Auswirkungen – und verleihen oder verweigern uns Privilegien. Hinzu kommt: Wenn man Menschen in Schubladen steckt, dann gesteht man ihnen oftmals keine Komplexität zu. Du bist Feministin, also bist du in jeder Lebenslage so und so“, sagt Hengameh Yaghoobifarah.
Was auch im ach so freien Berlin alles schief läuft, beschreibt Hengameh häufig am eigenen Beispiel: „Dicke*fette Körper werden nicht nur als rufschädigend, faul und ungesund, sondern auch oft als so unglaublich lustig wahrgenommen. Alles, was eine dicke*fette Person macht, ist automatisch so waaaaahnsinnig witzig. Zum Beispiel tanzen, schwimmen, rennen, ja Sport im Allgemeinen. Oder Sex haben. Vor allem das. LOL, dicke*fette Personen und Begehren, wie soll das überhaupt funktionieren, haha!“, schreibt Hengameh 2016 in einem Artikel für Munchies.
»Eine nicht-toxische Fehlerkultur hilft am Ende allen.«
Momentan arbeitet Hengameh beim feministischen Missy Magazine und hat eine Kolumne namens Habibitus in der taz, die sich über alles hermacht – von Taylor Swift bis zu weißen Machtstrukturen in der Antifa. Wortwitzig austeilen kann Hengameh, einstecken müssen gehört dann auch dazu. Besonders „Polittunte“ Patsy l’Amour laLove hatte es im Sammelband „Beißreflexe: Kritik an queerem Aktivismus, autoritären Sehnsüchten, Sprechverboten“ auf Hengameh abgesehen.
Viel Feind, viel Ehr’? „Mit dieser speziellen Kritik konnte ich wenig anfangen. Ich hatte beispielsweise gefordert, dass man benennen sollte, wer die Opfer des Orlando-Shootings waren, um zu zeigen, dass der Täter auch aus klar rassistischen Motiven gehandelt hat. In diesem Buch wurde mir als Reaktion darauf vorgeworfen, dass ich die Leichen rassifizieren würde. Dabei habe ich meine Forderung von den Communities vor Ort entnommen.“, erklärt Hengameh. Generell sei (Selbst-)Kritik aber wichtig, eine nicht-toxische Fehlerkultur helfe am Ende allen. Das klingt zumindest in der Theorie ganz schön. Wer selbst schon einmal kritisiert wurde, weiß jedoch, dass der Grad zwischen konstruktiver Weiterentwicklung und persönlichem Gekränktsein ein schmaler ist.
Hengameh beschreibt sich selbst als schüchterne Person, die auch im Gespräch durch eine eher leiste Stimme und zurückhaltende Gestik auffällt. Das entschlossene Engagement ist also manchmal auch eine Überwindung für Hengameh. Ich finde es mutig, dass sich dieser Mensch immer wieder als Zielscheibe in den Fokus einer Öffentlichkeit stellt, die an vielen unfairen Strukturen festhalten möchte. Auch wenn die intersektionale Betroffenheit von Hengameh Yaghoobifarah bemerkenswert ist, gibt es viele Mutige, die sich einen Platz im Internet gesucht haben, von dem aus sie für einen Perspektivenwechsel kämpfen.
In Deutschland gibt es da zum Beispiel Body Mary, eine Plus-Size-Fashionista, die dafür einsteht, dass „mehr Frauen für sich, für ihren Körper und ihr Recht auf Selbstverwirklichung einstehen“. Oder die Mädels der muslimischen Comedy-Crew Datteltäter, die sich über „Biodeutsche“ und Hijabistas gleichermaßen lustig machen. Oder Alice und Maxi von „Feuer und Brot“, die sich in ihrem Podcast über afro-deutsche Identitäten und Periodenblut unterhalten. International gewinnt Body-Positivity-Aktivistin und Sex-Educator Maja Malau Lyse immer mehr an Einfluss, die Britin Laurie Penny beschwört in ihrem Essayband „Bitch Doktrin“ das Ende der toxischen Männlichkeit und die US-amerikanische Schauspielerin Laverne Cox verhandelt landesweit in Talkshows ihre Diskriminierungserfahrungen als afro-amerikanische Trans-Frau.
Wie Letztere beschäftigt sich auch Hengameh Yaghoobifarah stark mit Ansätzen von Mehrfachdiskriminerung: „Intersektionalität ist das Betrachten verschiedener Kategorien in ihrem Zusammenhang. Rassismus oder Sexismus sind nicht nur ein einzelnes Phänomen, sie können mit vielen anderen Ungleichheiten in Verbindung stehen. Ein spezielles Phänomen nur eindimensional zu betrachten, wird der Welt, in der wir leben, nicht gerecht.“ Dass auch den Menschen mit dem besten Willen Fehler passieren, ist für Hengameh ganz normal: „Ich bin ja auch nicht nur von allem diskriminiert, ich habe auch Privilegien. Ich bin zwar von Rassismus betroffen, kann aber auch weiß gelesen werden. Das Privileg haben Andere zum Beispiel nicht.“
»Memes und Gifs von Schwarzen Menschen zu posten kann als eine Art von Digital Blackfacing eingelesen werden.«
Ertappt fühlte sich Hengameh zuletzt, als sie über eine Diskussion stolperte, die sich mit Digital Blackfacing befasste. Grund des Anstoßes waren – vermeintlich – harmlose Memes, z.B. von Beyoncé oder anderen Schwarzen Künstler_Innen: „Memes und Gifs von Schwarzen Menschen zu posten kann als eine Art von Digital Blackfacing eingelesen werden. Die Schwarzen Körper werden hier zu einer übertrieben Emotionalität hochstilisiert und dehumanisiert“, erklärt Hengameh. Man müsse sich fragen: Warum postet man ausgerechnet das? Warum hat man das Gefühl, dass die Emotion bei diesen Körpern besonders stark rüberkommt? Dass kann in manchen Ohren extrem klingen. Radikal zu sein gehöre aber zu einem konsequenten Mitdenken aller Arten von Diskriminierung. „Ich bin kein Fan davon zu sagen, dass man sich erst einmal den großen Baustellen zuwenden soll und den Rest quasi auf später verschiebt. Alle Ungerechtigkeiten müssen angesprochen werden.“
Für Einsteiger sind die Aussagen von Hengameh Yaghoobifarah vielleicht noch etwas zu radikal. Aber genau das sollte Leser_innen nicht davon abhalten, die Konfrontation mit dieser Arbeit immer und immer wieder zu suchen, ohne zu verurteilen. Viele von uns haben sich auf den Weg gemacht, die Trinität von Race-Class-Gender in ein neues, besseres Zeitalter zu führen. Aber unsere Positionen auf der Rennstrecke sind so unterschiedlich, dass wir manchmal vergessen, dass wir miteinander und nicht gegeneinander laufen. Eine Lernkultur zu entwickeln, in der jede Stimme gehört, aber auch jede Angst verstanden werden muss, gehört zu den größten Aufgaben einer feministischen Bemühung im Jahr 2018.