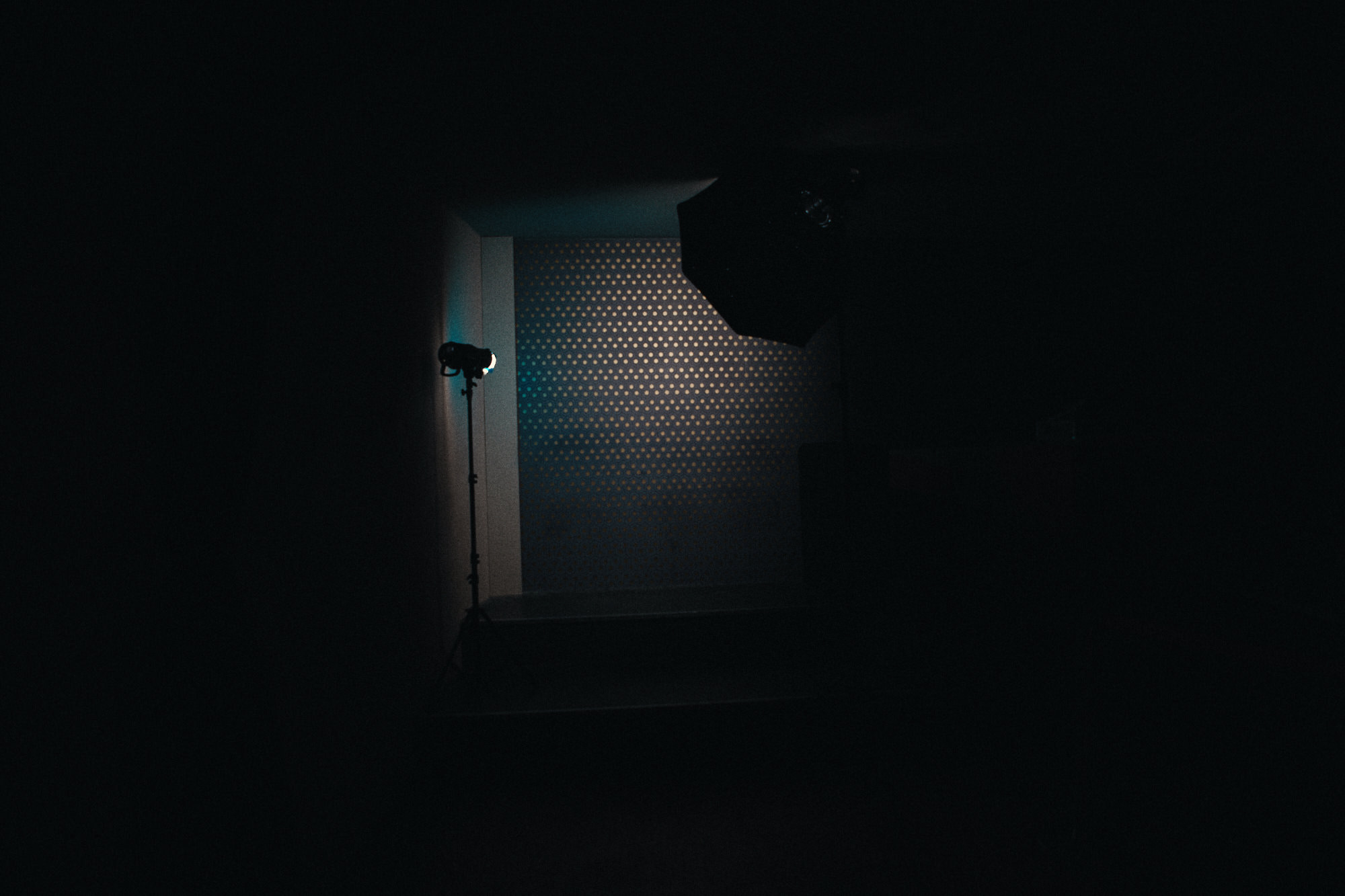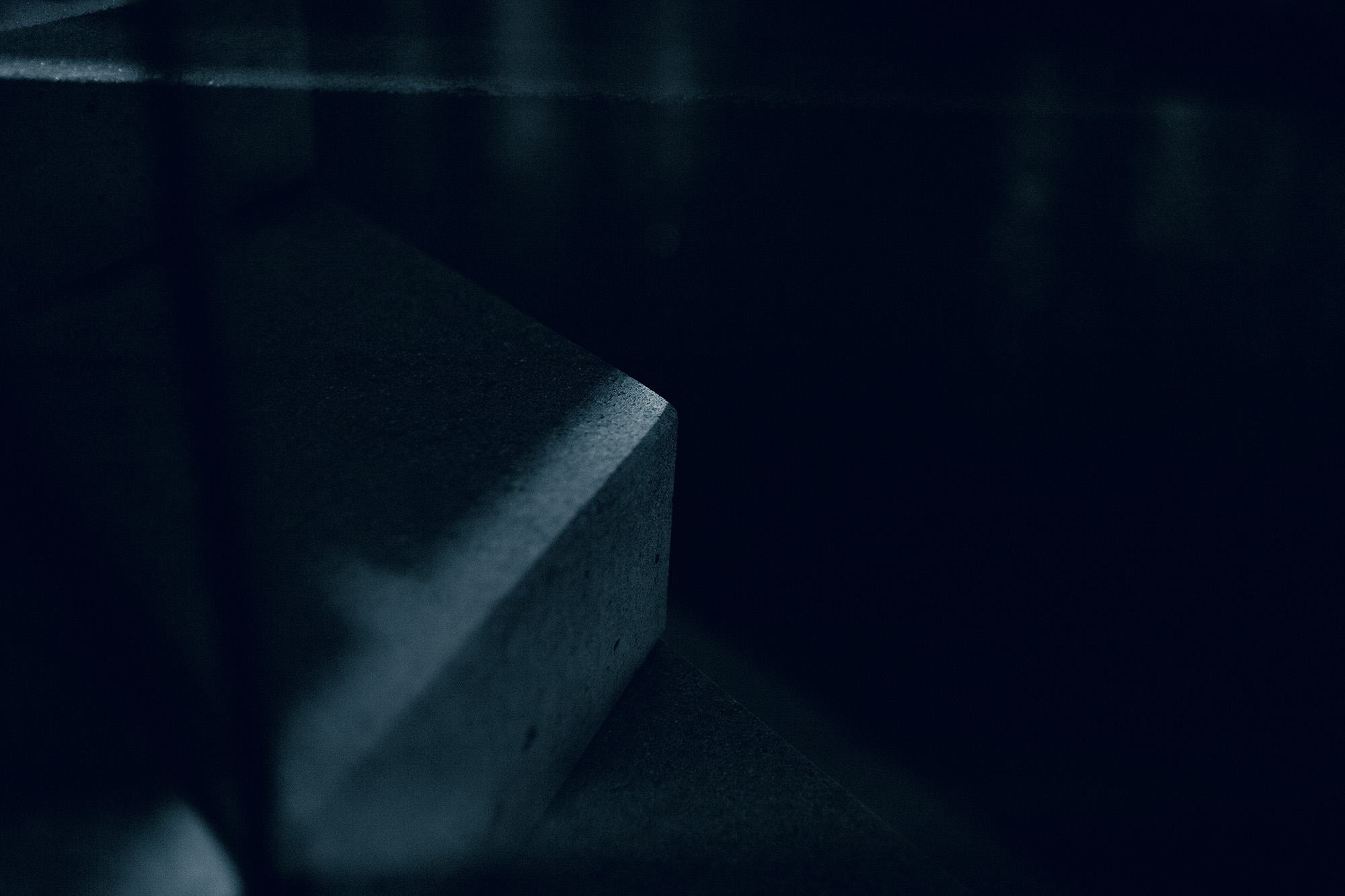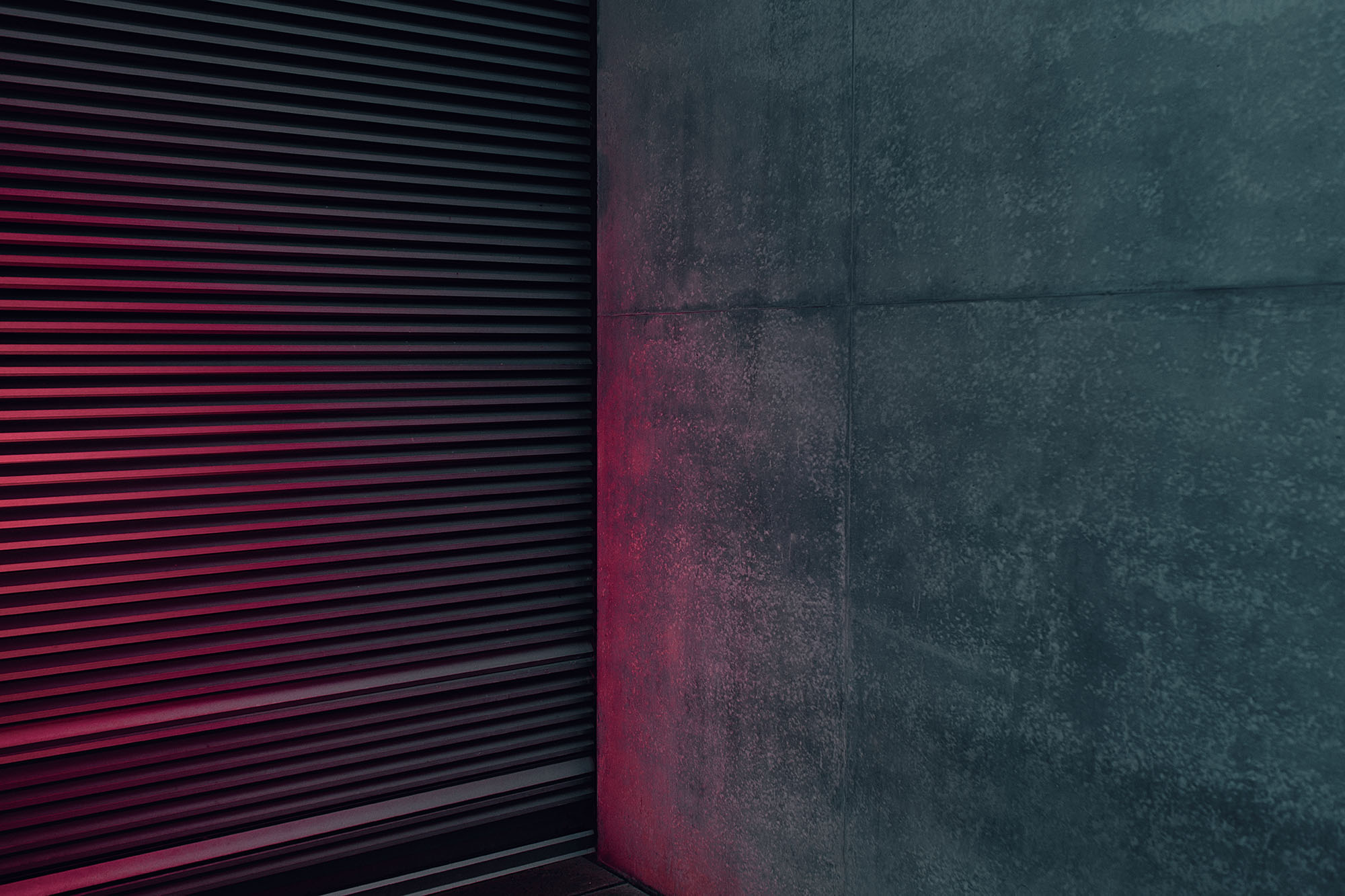Sven Baum
Editorial — Sven Baum
Glaube an den Instinkt
Fotograf Sven Baum entdeckte seine Faszination für Kameras, als er 1988 die Rolleicord seiner Mutter stibitzte und damit vom Fenster aus die Nachbarn fotografierte. Für uns hat er sich die Frage gestellt, was das Wort Instinkt in der Fotografie bedeutet.
28. Juli 2018 — MYP N° 23 »Instinkt« — Text & Fotos: Sven Baum
Laufen, warten, beobachten, weitergehen. Man fühlt es nicht, man spürt es nicht.
In einem tausendstel einer Sekunde ist es möglich, einen Moment einzufrieren, der sowohl ein Gefühl als auch eine Emotion transportiert. Das ist der Idealfall mit der emotionalen Bindung an einen Moment steht und fällt die Erinnerung daran.
Die Technik ist heutzutage nicht mehr das Problem, der Moment der Entscheidung um so mehr. Der Unterschied vom analogen zum digitalen besteht darin: der Respekt dem Moment gegenüber und der Glaube an seinen Instinkt. Er sollte uns Vertrauen geben und Zuversicht.
Die berühmten Vorbilder, von denen man lernen sollte, sagen: ”Fuck the easy shots!” Mut sollte unser Antrieb sein, der Instinkt würde uns schon leiten. Er würde uns in dunkle Gassen führen, über Zäune klettern lassen, Wildfremden den Atem rauben und anderen eine Inspiration sein.
Jeder will Erfolg und Anerkennung, aber der Weg dahin dauert – und das soll er auch. Seinen eigenen Stil zu finden, ist ein monatelanger, ja sogar jahre- oder jahrzehntelanger Prozess, an den man irgendwann stolz zurückdenkt und auf den man mit einem Lächeln zurückblickt. Egal ob Hobby, Beruf oder Berufung, der Instinkt lässt uns zu gegebenem Anlass den passenden Moment erkennen und dann zuschlagen.
Die weisen Lehren aus Fernost werden oft mit dem Satz „Ein voller Geist muss erst gelehrt werden!“ zitiert. Persönlich stimme ich dem zu. Das Foto ist nun mal eine visuelle Darstellung des eigenen Gemütszustandes, ein Spiegel deiner selbst. Der Instinkt – die Summe aller deiner Teile.
Laufen, warten, beobachten, einatmen, ausatmen, Schuss, …Treffer?
Fotograf Sven Baum lebt und arbeitet in Stuttgart.
Benny Blanco
Submission — Benny Blanco
Pure Magie
Seit mehr als zehn Jahren versorgt der US-Erfolgsproduzent Benny Blanco die internationale Musikszene mit Hits, nun tritt er als Künstler selbst auf die Bühne. Warum er bereits als Kind seinem musikalischen Instinkt gefolgt ist, hat er für uns aufgeschrieben – und dabei gleich sein neues Video „Eastside“ mitgebracht.
28. Juli 2018 — MYP N° 23 »Instinkt« — Text: Benny Blanco, Foto: Management
In den vergangenen Monaten habe ich doch tatsächlich ein paar Punkte von meiner Liste mit Dingen, die ich unbedingt mal machen will, abhaken können – ich habe zum Beispiel an Veröffentlichungen wie „ye“, „Kids See Ghosts“ und an dem Album von Nas mitgearbeitet… und jetzt warte ich eigentlich nur noch darauf, dass meine Mutter mich aus dem Traum rausholt und sagt, dass ich zu spät zur ersten Stunde bin. Na ja, bisher ist sie noch nicht aufgetaucht – ha!
Als ich klein war, habe ich den ganzen Tag an nichts anderes gedacht als an Musik. Morgens beim Aufstehen dachte ich an sie und abends beim Einschlafen auch. Ich bin oft von der Schule nachhause gerannt, um im Netz irgendwelche Linernotes zu suchen, sie auszudrucken und dann ein Ratespiel zu spielen: Die Seite mit den Producer-Namen war verdeckt und ich musste erraten, wer welchen Beat produziert hatte – erst dann durfte ich gucken, ob ich richtig gelegen hatte. Dazu suchte ich alle Samplequellen zu meinen Lieblingssongs raus und versuchte, die Beats genau so nachzubauen. Außerdem schaute ich mir jedes Video bei MTV und BET an, ich klebte regelrecht am Bildschirm.
Auch im Auto hörte ich immer Musik und sang jede Zeile mit, während ich sehnsüchtig aus dem Fenster schaute und mir vorstellte, ich wäre im dazugehörigen Videoclip zu sehen. Und dann habe ich meinen Eltern immer wieder in die Augen geschaut und zu ihnen gesagt: „Es gibt keinen Plan B,“ – und: „Ich werde das schaffen.“ Ich hatte einerseits natürlich Schiss, aber andererseits auch nicht… Musik ist pure Magie und wir müssen sie auch so behandeln.
Ich habe über meine Zukunft nachgedacht, darüber, wie ich mir den weiteren Verlauf meiner Karriere wünschen würde. Dabei habe ich den Entschluss gefasst, einige Songs unter dem Namen Benny Blanco zu veröffentlichen… und keine Sorge: Ich werde sie bestimmt nicht selbst einsingen mit meiner beschissen-nasalen Gesangsstimme. Stattdessen habe ich meine ganzen Freunde gebeten sie einzusingen. Ich hoffe, sie gefallen euch – und wenn nicht, dann ist das auch egal, weil sie mir gefallen!
Love, Benny
Benny Blanco, Halsey & Khalid – Eastside (Official Video)
Mehr von und über Benny Blanco:
instagram.com/itsbennyblanco
facebook.com/itsbennyblanco
twitter.com/itsbennyblanco
#halsey #khalid #bennyblanco
Paulita Pappel
Interview — Paulita Pappel
Das Anale ist politisch
Paulita Pappel arbeitet als Porno-Darstellerin, Filmemacherin und „Sexpositivity“-Aufklärerin. Im Interview erzählt die 30-jährige Berlinerin von einer vermeintlich missverstandenen Industrie und genormten Idealkörpern – und davon, wie es ist, mit hundert anderen Menschen im Kino einen Porno anzuschauen.
1. Juli 2018 — MYP No. 22 »Widerstand« — Interview & Text: Angie Volk, Fotos: Lukas Papierak
Um Paulitas Hals hängt eine Eulenkette, ich habe meine dicke Brille auf. Wir sehen nett aus. Eifrig. Beide etwas jünger als wir eigentlich sind. Wahrscheinlich denken die Leute um uns herum, dass wir ein Referat für die Uni vorbereiten, nochmal schnell ein paar Strichpunkte durchgehen. Stattdessen haben wir uns verabredet, um über Paulitas Sexjob zu sprechen.
Angie:
Wir haben ungefähr das gleiche Alter, dementsprechend vermutlich ungefähr die gleiche Porno-Vergangenheit. Pornos waren früher für mich: Privatfernsehen nach Mitternacht, toupierte Haare und pralle Brüste. Später verwackelte Clips aus dem Internet, mit dem Modem runtergeladen. Und dann irgendwann gab es YouPorn, also die volle Porno-Überschwemmung. An welchem Punkt hast du gesagt: Das interessiert mich, das finde ich spannend, das will ich auch machen?
Paulita:
Ich bin erzogen worden als Feministin, allerdings als Zweite-Welle-Feministin. Ich dachte immer und habe das auch sehr vehement verteidigt, dass Pornografie – und jede andere Form der Sexarbeit – ein Werkzeug des Patriarchats ist, um Frauen auszubeuten. Ich dachte, niemals im Leben würde eine Frau freiwillig ihren Körper verkaufen. Gleichzeitig empfand ich insgeheim eine krasse Faszination für Pornografie – ohne bis dahin überhaupt viele Pornos gesehen zu haben, denn bei uns zu Hause gab es in den 90ern kein Privatfernsehen. In Spanien gab es Canal+, auf dem gab es Pornos ab 23 Uhr. Die musste man zahlen, sonst bekam man verwackelte, kodifizierte Bilder zu sehen. Über die hat man dann als Teenager*in allenfalls gelacht und das war’s.
»Man kann Feministin sein und Pornos mögen. Man kann sie sogar mögen und machen.«
Losgelassen hat mich das Thema trotzdem nicht. Ich war lange Zeit ziemlich sicher, dass etwas nicht mit mir stimmt – mit mir, der Feministin. Ich habe gedacht: „Wow! Das Patriarchat hat mich völlig vereinnahmt.“ Ich hatte riesige Konflikte, trotzdem habe ich mich heimlich weiter informiert, was es alles so gibt. Was ich bei meiner Recherche gefunden habe, fand ich ziemlich shady. Das war keine Pornografie, die sich sicher und richtig angefühlt hat, keine Pornografie, die ich selbst erleben wollte. Und so ist es erstmal geblieben – bis ich nach Berlin gekommen bin und feministische Frauen gefunden habe, die selber Pornos machen. Für mich war das der erste Kontakt mit dem Dritte-Welle-Feminismus, sexpositiven Feminismus sozusagen. Das war eine echte Erleichterung, eine Befreiung. Die Erkenntnis: Okay, nichts ist falsch mit mir. Man kann Feministin sein und Pornos mögen. Man kann sie sogar mögen und machen. Pornos per se sind nichts Schlimmes. Der Gedanke, dass eine Frau Sexualität nur passiv erlebt, als Token für Liebe, für Beziehung, für Sicherheit oder sonst etwas hergibt, ist der Inbegriff des patriarchischen Gedankens. Die Entscheidung, mich zwar als Objekt vor die Kamera zu stellen, aber als Subjekt zu handeln, das ist stattdessen eine Definition für Selbstermächtigung für mich.
Angie:
Mit dieser Erkenntnis hast du losgelegt und angefangen Pornos zu machen?
Paulita:
Genau. Die ersten Pornos habe ich mit einer Gruppe von Leuten, die politisch hundertprozentig dahinterstanden, gedreht. Wir wollten andere Körper, andere Sexualitäten, anderes Begehren darstellen und anbieten, weil wir selbst so lange danach suchen mussten. Richtig viele Pornos haben wir erstmal gar nicht gemacht, sondern in erster Linie sehr viel darüber geredet und diskutiert. Dann ist mir aufgefallen, dass man damit auch Geld verdienen kann – was ja generell nichts Schlechtes ist. Also habe ich begonnen, mit ethisch vertretbaren Firmen auch kommerziell zu arbeiten, etwa mit Produktionsfirmen wie Abby Winters, Ersties oder Erika Lust. Dabei hatte ich immer das große Privileg, mir sehr genau aussuchen zu können, mit wem, wann und wie ich arbeite, und war anfangs nicht finanziell davon abhängig. Das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht.
»Eine gesunde Gesellschaft muss gesunde Wege finden, Pornografie anzubieten. Pornos für jeden Geschmack – und nicht nur einen tabuisierten Standard.«
Angie:
Drehst du auch Mainstream-Pornos? Oder nur Art oder Indie-Pornos, sprich kleinere Produktionen?
Paulita:
Hauptsächlich Indie-Pornos, aber ich finde die Unterscheidung unproduktiv, weil sie Pornografie aufzuteilen scheint in guten und schlechten Porno. Weil sie sagt: „Das ist jetzt besser, aber das da, das ist immer noch böse.“ Genau gegen dieses Stigma müssen wir ankämpfen. Die Vorstellung, die wir gemeinhin von Porno haben, ist total beschränkt. Würden wir jetzt Max Mustermann auf der Straße fragen: „Was ist Porno?“, würde er antworten: „Ach, alle Pornos sehen gleich aus. Muskeltypen mit Riesenschwänzen. Frauen mit großen Brüsten werden gefickt.“ Und das stimmt einfach gar nicht mehr. In unterschiedlichen Ländern und Kulturkreisen gibt es die unterschiedlichsten Pornos. Von Hetero bis Trans, Homo und Animation; von riesigen Produktionen bis zu Gonzo-Movies und so weiter. Zu sagen, dass Porno immer gleich ist, ist einfach falsch. Das Bild entsteht durch die Freetubes wie YouTube, PornHub und so weiter. Die haben das Bild von Porno zerstört. Ich denke, eine gesunde Gesellschaft muss gesunde Wege finden, Pornografie anzubieten. Pornos für jeden Geschmack – und nicht nur einen tabuisierten Standard. Klar, Mainstream-Produktionen gehen anders mit Inhalten um, nutzen diese vor allem nach kapitalistischer Attitüde. Was per se nicht schlimm ist, in der leben und arbeiten wir ja zwangsläufig alle.
»Es ist wie mit der Tomate im Supermarkt: Auch bei Pornos kann man sich entscheiden für die ethisch vertretbare Biovariante.«
Angie:
Die Dokumentation „Hot Girls Wanted“ kennst du vermutlich. Ich kann mir vorstellen, dass du öfter auf sie hingewiesen wirst. Sie erzählt die Geschichte von jungen Frauen, die in der Porno-Industrie anfangen – relativ optimistisch, offen, neugierig. Nach einiger Zeit kommt dann die Ernüchterung: Sie haben ihre Selbstbestimmtheit verloren, werden zu Dingen gedrängt, die sie nicht machen wollen. Wie reagierst du auf diese impliziten Anklagen an die Porno-Industrie?
Paulita:
Natürlich ist das ein Thema, über das geredet werden muss, versteh‘ mich nicht falsch. Aber ausbeuterische Strukturen gibt es in jeder Industrie. Ich finde nicht, dass die Porno-Branche da schlimmer ist als andere. Schau dir die Modeindustrie an. Auch sie ist sexistisch, frauenfeindlich, gewaltvoll. Schau dir Hollywood an: genormte Körper, harte Standards. Da ist es schon erstaunlich und eine große Sache, wenn eine Bridget Jones ein bisschen Bauchfett hat. Porno hingegen war schon immer diverser, vielfältiger, hat mehr zugelassen. Es sind wie gesagt die freien Plattformen wie YouPorn, die problematische Strukturen und Ausbeutung schaffen, die die Branche verändert haben. Was du in „Hot Girls Wanted“ gesehen hast, zeigt ja nicht die Mainstream-Industrie des Pornorfilms. Sondern die neuen Porn-Startups, schnelllebige Produktionen. Wenn jemand findet, dass Pornos unter schrecklichen Bedingungen produziert werden, dann soll er sie nicht gratis konsumieren. Es ist wie mit der Tomate im Supermarkt: Auch bei Pornos kann man sich entscheiden für die ethisch vertretbare Biovariante. Klar, es gibt immer weniger Geld in der Branche und das ist ein Problem. Und es ist wirklich eine echte Schande, dass sich niemand dafür interessiert. Aber so schwarz und weiß, wie in „Hot Girls Wanted“ dargestellt, ist die Situation nicht. Ich empfehle die Dokumentation „Hot Girls Wanted: Turned On“, um noch ein bisschen tiefer in diesen Diskurs einzusteigen. Da finden verschiedene Stimmen aus der Branche Gehör. Unter anderem Frauen, die Porno machen, wie zum Beispiel Erika Lust. Sie versucht, Pornos unter fairen Strukturen zu produzieren.
»Die Frauen, die Pornos machen, erfahren viel mehr Diskriminierung und Stigmatisierung in der Mehrheitsgesellschaft als im Porno-Umfeld.«
Um mit den Klischees in Bezug auf Pornografie aufzuräumen, ist es wichtig, sich von dem Gedanken zu verabschieden, dass alle Frauen, die du beim Sex vor der Kamera siehst, misshandelt werden. Die meisten haben einfach Spaß an dem, was sie da machen. Punkt. Für mich selbst hat es ewig lange gedauert zu verstehen, dass du eine selbstbestimmte Frau sein und es trotzdem geil finden kannst, dass ein Mann dir in den Arsch fickt. Oder zwei. Dass das okay und nichts Schlimmes ist. Die Frauen, die Pornos machen, erfahren viel mehr Diskriminierung und Stigmatisierung in der Mehrheitsgesellschaft als im Porno-Umfeld. Entweder du bist ein Opfer, das geschändet wird. Oder du bist eine Nutte, die es braucht. Dazwischen gibt es nichts.
Angie:
Erfährst du das so auch in deinem Umfeld?
Paulita:
Natürlich achte ich schon ganz genau darauf, wem ich von meinem Job erzähle und wem nicht. Aber zum Glück wohne ich in Berlin, einer Stadt mit einer unglaublich großen, sexpositiven Szene, in der man dementsprechend geschützt ist und offen sein kann. Auch bei meinen Eltern bin ich geoutet. Meine Mutter, wie gesagt eine Zweite-Welle-Feministin, hat sich ziemlich viele Vorwürfe gemacht, sich gefragt, was sie eigentlich falsch gemacht hat mit mir. Seitdem haben wir viel geredet und es ist besser geworden, aber ganz glücklich ist sie nicht – was auch okay ist. Der Rest meiner Familie weiß nichts von meinem Job. Ich komme immerhin aus Spanien, einem sehr katholischen Land. Mein Cousin ist gerade Priester geworden, alle haben gejubelt und gesagt: „Ach wie schön! Wenn es das ist, was du willst, ist das super!“ Wenn ich mir vorstelle, wie die Reaktionen ausfallen würden, wenn ich sagen würde: „Übrigens, ich bin Pornodarstellerin“, das ist nicht drin in den Köpfen, nicht vorstellbar.
»Wir sind es nicht gewohnt, offen über Sex zu sprechen. Wir haben einen riesigen Mangel an inklusiver, diverser Sexaufklärung.«
Die eigentliche Diskriminierung ist trotzdem viel subtiler. Der begegnet frau oft zum Beispiel schon beim*bei der Gynäkolog*in. Wenn du da sagst: „Hey, ich bin Pornodarstellerin, ich habe bestimmte Bedürfnisse“, stößt du vielen erstmal gegen den Kopf. Da gibt es gar nicht das nötige Wissen, stattdessen viel Ignoranz, wieder viele Vorurteile. Das Problem ist auch da wieder die Sex-Negativität in unserer Gesellschaft. Wir sind es nicht gewohnt, offen über Sex zu sprechen. Wir haben einen riesigen Mangel an inklusiver, diverser Sexaufklärung. Sex wird mit Scham beladen und das muss sich ändern. Viele folgen der Logik, dass junge Leute zu viele Pornos gucken und deshalb ein gestörtes Konzept von Sexualität entwickeln – aber das ist falsch. Es geht vielmehr um die Übersexualisierung, diesen seltsamen Unterton, den beispielsweise die Medien anschlagen. Das Problem sind nicht die Pornos. Aber natürlich ist es viel leichter, Pornografie zu thematisieren als zu sagen: „Wir haben ein gravierendes, ein strukturelles Problem mit Sex in unserer Gesellschaft.“
»Sex hat viel mit Freiheit zu tun, da Sex eine elementare Facette unserer Identität ist.«
Sex hat viel mit Freiheit zu tun, da Sex eine elementare Facette unserer Identität ist. Nicht umsonst schränken totalitäre Regime gerne die sexuellen Rechte ein. Ein Schritt zur Mündigkeit ist die Fähigkeit zur Selbstermächtigung. Und für die ist Sex eine wichtige Strategie. Ich merke das an mir selbst: Je mehr ich im Reinen mit meiner Sexualität und meinen Weg damit bin, desto glücklicher bin ich, desto mehr kann ich geben. Es geht um Konsens, um Toleranz und Vielfalt. Ich selbst mag zum Beispiel BDSM. Da muss man erstmal drüber hinwegkommen, als feministische Frau von Männern geschlagen werden zu wollen. Aber unsere Realität ist eben viel komplexer, als das, was offensichtlich ist, was richtig und falsch ist. Es geht um die Anerkennung dieser Komplexität.
Angie:
Wie findest du Darstellungsräume für diese Komplexität? Welchen Projekten widmest du dich aktuell?
Paulita:
Ich mache seit einigen Jahren beim Pornfilmfestival Berlin mit, erst als Volontärin und seit 2013 als Teil des Kuratoriums und des Orga-Teams. Seitdem habe ich natürlich viel mehr Pornos gesehen und verstanden – und ein stärkeres Bewusstsein für die Einschränkungen und die Vorurteile entwickelt, die Pornografie begegnen. Deswegen mache ich Castings, Produktion und Regie, versuche das Spektrum mitzugestalten. Vor einem Jahr habe ich auch die Website „Lustery“ gegründet: Auch wenn ich prinzipiell alle Genres von Pornographie spannend finde, gefallen mir freie, unchoreographierte Pornos, in denen die Leute improvisieren, am besten. Also bin ich in dem Team, mit dem ich viel arbeite, auf die Idee gekommen, eine Plattform zu gründen, auf der Paare – wie auch immer sie sich definieren, ob mono- oder polygam, verheiratet oder nicht – sich selber filmen, ohne dass jemand mit ihnen im Raum ist. Das Ergebnis können sie dann hochladen und teilen. Sex offen teilen können, selbständig und frei, das ist Lustery für mich. Das Besondere an dieser Plattform ist für mich das Maß an Intimität, das durch diese Produktionsweise entsteht. Die Leute kennen sich, ihre Körper, den Körper ihres Partners, ihrer Partnerin. Da gibt es Nähe, einen echten Background – und das sieht man meiner Meinung nach. Für mich ist das feministischer Porno.
Angie:
Ist es inzwischen einfacher für deine Mutter, mit deinem Job umzugehen?
Paulita:
Ich habe unglaublich viel Glück mit meinen Eltern, sie sind sehr offen. Wir haben viel geredet, ich habe meine Mutter mit viel Literatur versorgt. Inzwischen respektiert sie meinen Weg, akzeptiert ihn, auch wenn er nicht ihrer ist. Und ich wäre ohne meine Mutter natürlich nicht, wer ich bin. Und somit akzeptiere ich indirekt ja auch ihren Weg. So betrachte ich den feministischen Generationskonflikt inzwischen. Wir können alle voneinander lernen, Gedanken weiterentwickeln. Früher hieß es: “Mein Körper gehört mir.“ Ich sage: „Mein Körper gehört mir. Und ich stell‘ ihn vor die Kamera und hol‘ mir einen runter.“
»Im Kinosaal mit 100 Leuten zu sitzen und einen Porno zu gucken, das ist echt befreiend.«
Angie:
Entschuldige, ich muss auf eine Sache zurückkommen: So spannend die Lustery-Website und dein feministischer Weg mit Pornografie sind, die Vorstellung eines Pornfilmfestivals lässt mich gerade nicht los. Verstehe ich das richtig: Man sitzt zusammen im Kino schaut zusammen mit 50 Leuten einen Porno? Ich war ja bereits bei „Nymphomaniac“ von dem Gruppenerlebnis „Horniness“ überfordert.
Paula:
Der Unterschied zwischen Pornfilmfestival Berlin und Nymphomaniac ist ja, dass du bei Nymphomaniac nicht horny sein sollst. Beim Pornfilmfestival Berlin ist das anders. Für mich ist das ein Ort mit anderen Regeln und einem anderen Status quo, an dem ich ich sein kann. Erotik spielt da schnell eine untergeordnete Rolle. Es geht mehr darum, Tabus und Scham abzulegen, zu erleben, was dann kommt. Das ist für mich Freiheit. Das Pornfilmfestival-Programm besteht natürlich auch nicht nur aus Pornos, sondern aus einer breiten Palette aus Filmen, die sich mit Sexualität, LGBT, Queerness, Body-Politics und vielen anderen Themen beschäftigen. Und trotzdem: Im Kinosaal mit 100 Leuten zu sitzen und einen Porno zu gucken, das ist echt befreiend. Wir vertreiben Scham und Ängste, es ist eine ganz neue Form der Tabula rasa. Wir alle machen das Pornfilmfestival Berlin ehrenamtlich und wenn Dinge ganz besonders stressig und hektisch sind, frage ich mich schon mal, warum ich mir die ganze Arbeit eigentlich antue. Aber wenn ich dann im Kinosessel sitze und die Energie und die Leute erlebe, weiß ich: genau dafür.
Es gibt gesellschaftlich noch viel zu besprechen, wenn es um Porno geht – wenn es um Sexualität geht. Und darauf bin ich gespannt, da bin ich gerne dabei. Denn ganz ehrlich: Es kann doch nicht sein, dass wir auf der einen Seite diese wahnsinnig weit entwickelte Gesellschaft sind, schlaue Handys haben, auf dem Mond waren, aber auf der anderen Seite immer noch nicht wissen, ob das weibliche Ejakulat Pisse ist oder nicht. Das ist doch absurd.
Fotografie: Lukas Papierak
Thaer Ayoub
Editorial — Thaer Ayoub
Dialog mit dem Gefängniswärter
Schriftsteller Thaer Ayoub floh Anfang 2015 von Aleppo nach Deutschland, nachdem er vom syrischen Regime wegen seiner Gedichte ein Jahr lang inhaftiert und gefoltert worden war. Im Dezember 2017 erschien sein Gedichtband »Katharina und Aleppo« – die deutsche Sprache hat er sich selbst beigebracht.
18. Juni 2018 — MYP No. 22 »Widerstand« — Text: Thaer Ayoub, Fotos: Michel Diercks
»Wenn ich schrie, war meine Stimme ihre Furcht.«
Dort … wo die Nachtzeit endlos ist
War mein Schweigen endlos
Und mein Körper schützte sich vor den Peitschen
Mit seiner Blutung
Und wenn ich schrie, war meine Stimme ihre Furcht, dann erhöhten sie die Lautstärke der
Beschimpfungen,
um sich vor ihrer Musik zu schützen.
So war ein Jahr wie ein Jahrhundert des Schmerzes.
Ist der Skorpion der Zeit so langsam
Oder sind wir langsam in unserem Kriechen in den Tod?
Wo ist diese ewige Ruhe, die die Philosophen Nihilismus nennen?
Der Freund, der aus dem Folterzimmer kam,
nachdem er seine Quote bekommen hatte, sagte mir:
Ich verleihe dir die Fähigkeit, die in mir übrigblieb, zur Hoffnung.
Alles ist möglich, bis auf dass du den Weg verlierst.
Nein … habe keine Angst vor dem Schmerz,
sondern sieh ihn als Freund.
Umarme ihn und verleihe deiner Seele aus ihm
Den Anfang der Melodie, dann tanzt sie vielleicht hoch
Weit weg von den Peitschen als Zeuge für dieses Verbrechen.
Tanz, weil der Tanz die Reinheit der Seele von der Niederlage ist.
»Größer als ihr Gefängnis ist dein Herz.«
Oh … falls der Gefängniswärter das Wesen des Tanzes lernen würde
Und falls die Peitsche zu einer zärtlichen Flöte würde,
würde die ganze Welt sich von den Kriegen, der Tyrannei, dem Hass,
dem unterschwelligen Groll, dem Rassismus, den Gefängnissen und der Aggression befreien.
Ein Märtyrer sagte mir eine Stunde vor der Hinrichtung:
Größer als ihr Gefängnis ist dein Herz
Und weiter als ihre Vermutung ist dein Weg
Und wärmer als ihre Kälte ist dein Blut, das das Leben segnet
Und wilder als ihre Beschimpfung ist dein Mund, dem die Lieder gehören
Und dein Schweigen ist nervig.
Widerstehe wie wir widerstanden
und unterschreibe nicht auf der Kapitulationsurkunde.
Versöhne nicht.
Die Versöhnung ist nichts anderes als Verzichten auf die Träume.
Wenn du auf deinen Traum verzichtest, stirb lieber
Und glaube nicht den Worten der Politiker über den Frieden.
Die Politiker tragen in ihren Behauptungen einen Sarg
Für deinen Traum, der auf dem Markt der wirtschaftlichen Interessen begraben wird.
Nein … kein Frieden ohne Freiheit.
Dort … in einem Keller,
der mit allem, was es im Universum vom Hass auf das Leben gibt, vorbereitet ist
und dessen Ziel es ist, irgendeine Zukunft zu sabotieren
und das Selbst herauszuziehen,
war unser erstes Treffen.
Mein Gefängniswärter sagt:
„Glaubst du wirklich an den Sieg?“
„Wir versuchen immer noch, wie die Freien zu sterben,
wenn wir wie die Freien nicht leben können.“
„Ihr werdet aber getötet.“
„Nicht so schlimm. Viele Generationen werden leben, aber in Freiheit.“
»Ihr, also die Dichter, seid dumm. Ihr glaubt, dass ihr diese ganze Welt mit dem Stift verbessern könnt.«
„Ihr, also die Dichter, seid dumm. Ihr glaubt, dass ihr diese ganze Welt mit dem Stift verbessern könnt.“
„Wenn wir es nicht können, werden wir wenigstens den Anteil des Elends in ihr nicht erhöhen, wie ihr es macht.
Lest die Geschichten der Völker, um zu verstehen,
dass es keine Ewigkeit für einen Tyrannen gibt
und dass die Fesseln nicht beständig sind
und dass die Peitschen fadenscheinig werden
und um zu verstehen, dass die Völker trotz der hohen Wände des Gefängnisses die Sonne haben werden.“
„Falls du irgendwann hier rausgehen wirst, wirst du mich töten?“
„Ich werde machen, was ein freier Mensch machen kann.
Dein Blut ist nicht das Ziel des Blutes, das geflossen ist,
weil du nur eine Phase bist, die enden wird, bevor mein Blut
auf dem Veilchen der Heimat ausgetrocknet sein wird.
Es wird …“
„Es geht los.“
Er unterbrach seinen Dialog und hing mich auf.
»Vor ihm war ich ganz nackt, bis auf die Ehre.«
Vor ihm war ich ganz nackt, bis auf die Ehre.
Ich guckte in seine Augen, aber sah das Gesicht des Todes nicht,
sondern ich sah mich als Vogel vor der Geliebten.
Er sah in meine Augen, dann schauderte er
Und sah sich selbst als den Gefangenen,
der ans Kreuz gehängt ist.
Thaer Ayoub ist Schriftsteller und lebt in Chemnitz.
Thaer Ayoub: Katharina und Aleppo
8,00 € inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
Gedichtband, 56 Seiten
Chemnitz/Berlin 2017
DIN A5
Auflage: 300
Yungblud
Interview — Yungblud
Rebellion Of The Young
With his highly energetic sound, British musician Dominic Harrison aka Yungblud tackles contemporary issues ranging from gentrification to lad culture. An interview about being reluctant to back down.
14. Juni 2018 — MYP N° 22 »Resistance« — Interview: Jonas Meyer, Photography: Tavy Hornbrook
For generations, it seems that older people have told young people how to go about their lives. By 1968 however, young people changed the course of history and pushed towards social justice.
Fifty years later, as populism spreads across the West, young people are once again taking matters into their own hands and pushing towards social justice. Today, teenagers like Emma González, David Hogg or Cameron Kasky are heralded as the heroes of our time. It seems that in 2018, children behave more like adults, whilst adults behave more like children…
We sat down with British musician Dominic Harris aka Yungblud to discuss what it means to be a young person in today’s world. Born and raised in Doncaster, a peaceful town in South Yorkshire, Yungblud tackles contemporary issues ranging from gentrification to lad culture in his highly energetic music.
»What’s so confusing and scary to me is that I feel like we’ve been held back by a generation that doesn’t necessarily understand us.«
Jonas:
You grew up listening to the music of the ‘60s and ‘70s. Would you say that back then, the music played a different role in society in comparison with today?
Dominic:
Yes, I think so. The ‘60s and ‘70s were a time of such great social change. It was the first time ever that kids were saying to their parents, “I think you’re wrong!” It feels like years of oppression had held young people down for so long… things like being back home for dinner at 7 o’clock—so, the music from that generation was like an explosion. I definitely see a comparison with today. Right now, the world is changing as fast as it did back then when real changed happened… I feel like today’s world is such a confusing and scary place—especially for young people. However, I feel like my generation is very intelligent; we have this idea of the world we want to live in.
Jonas:
Your generation means the “Bernie Sanders generation”.
Dominic:
Exactly! We want to live in a liberal, forward-thinking world. But what’s so confusing and scary to me is that I feel like we’ve been held back by a generation that doesn’t necessarily understand us, or feel quite ready for the world to go in that direction just yet. These kinds of ideas are the fundamental basis of my music; I started writing because I was angry, my friends were angry. Now that people have started coming to my gigs, I speak to fans afterwards and they say they feel angry too…
Jonas:
But do you think all young people are angry? It seems that some young people today are more interested in becoming YouTube stars or influencers on Instagram…
Dominic:
The people I grew up around are angry; the majority of young people angry. Especially where I’m from—thanks to issues like Brexit. We’re a generation that is exposed to so much pain and suffering every day; we see the world for what it really is…
Jonas:
Speaking of Bob Dylan, he recently won the Nobel prize in literature. Is he the best example of a good musician? Do you need both good composition and lyrics?
Dominic:
I love Bob Dylan—whenever I’m down, I run a bath, roll a spliff and listen to Bob Dylan. I think he’s the first one whose lyrics really spoke to me. What inspires me the most are well-written lyrics; Alex Turner, Chris Difford, Eminem and Bowie all come to mind. You see, I’ve got ADHD, so I don’t have the attention span for literature. For that reason, I turn to lyrics and rhymes. When I was younger my mum would always encourage me to read books, but I quickly realised that I couldn’t do that. I think this is where I got hooked on music, because the energy matched my energy inside.
»I really thought that I’ll just flutter my eyelashes, wink at the girls, talk about love and I’ll be a star.«
Jonas:
For you, lyrical content seems to be very important. Your songs address issues like gentrification, commercialism, or sexual assault. Why are these topics important to you, both personally and to your music?
Dominic:
Definitely! I’m just so fucking bored of the music that’s being put out today. I think we’ve gotten into a situation where lyrics don’t necessarily matter anymore—at least in the mainstream. The music I grew up listening to spoke about real things and that’s what inspires me today. When I moved to London and started making music, I thought that I should just write whatever’s gonna get me onto the radio—Justin Bieber’s doing that, Shawn Mendes’ doing that. I really thought that I’ll just flutter my eyelashes, wink at the girls, talk about love and I’ll be a star.
Jonas:
Let me guess: it didn’t work.
Dominic:
Right! I was doing that for a year, going into the studio with five producers a week; each of them giving me their opinion about what I was. I remember meeting one producer, who told me that the lyrics I was writing were rubbish. He told me that this wasn’t me—I knew he was right.
Jonas:
Was being in that studio with this producer a moment of realisation for you?
Dominic:
I got so frustrated with all these people telling me what I was—but I knew exactly who I was in that moment. So, I started writing lyrics in my room. And a week later “King Charles” came out, “I Love You, Marry Me” came out and then, another twenty-five songs after that. I think it was in that moment I realised exactly who I was and exactly what I wanted to talk about and exactly who I wanted to represent. Since then, I haven’t really looked back and it’s been fucking crazy.
»I’ve realised that this lad mentality is not acceptable—it’s fundamentally wrong.«
Jonas:
In January you released the song “Polygraph Eyes”. You said on Facebook that this song is “such an important song” to you. Why’s that?
Dominic:
“Polygraph Eyes” was definitely the most important song for me on the EP. The story of “Polygraph Eyes” actually coincides with a situation my friend got into. In my teens, when I was going out in Doncaster and Sheffield in the north of England, I could see girls who were totally drunk get into taxis with boys that weren’t nearly as drunk as they were. It’s only since I’ve grown up a little, that I’ve realised that this lad mentality is not acceptable—it’s fundamentally wrong. I had a lot of female friends growing up and I was surrounded by a lot of very opinionated northern women, so I felt like this was a subject I needed to address. I can’t really remain silent whilst this lad mentally keeps going on.
»It’s fucking cool to care, it’s fucking good to give a shit, it’s good to say what you want.«
Jonas:
In 1977, when the Sex Pistols released their song “God Save The Queen”, they coined the term “no future” that became the label of an entire generation—a generation that was afraid of the Cold War and permanent nuclear danger. Would you say that your generation can be labeled as “no future 2.0”? Or would you define your generation differently?
Dominic:
My generation feels more positive, it’s less about fuck you, fuck you. I’ll reiterate, my generation is so clued up; we see how we want our future to go. I want to spread a message that it’s fucking cool to care, it’s fucking good to give a shit, it’s good to say what you want. I really want to spread that…
Jonas:
…especially with the #MeToo movement.
Dominic:
Definitely! Punk for me isn’t saying “Fuck you!” or playing my drums too loud. I’m someone more like Rosa Parks—she was a punk. The punk I’m trying to promote is, “I’m going to express myself in a way I want to, but to move the world forward”. I feel that’s the way I see my generation going forward.
»I want to encourage people to say what they think—that’s how I think things will change and progress.«
Jonas:
Do you feel like your generation has the power to change? Is this why your music is so powerful and driven?
Dominic:
I’m just saying what I think. I don’t want to tell people what to think. Who am I to do that? Everyone’s entitled to their own opinion and I want to encourage people to say what they think—that’s how I think things will change and progress.
Jonas:
Relating this back to your home country, what British attitudes make you who you are?
Dominic:
What I love about Britain is that I think we’re reluctant to back down, all the time. No matter what happens, I believe we stick our chin up and just try again. No matter how many times we’re beaten down, or how many times we’re told we’re wrong, I think we’ve got this motivation to give it another go. I think that’s why young people in Britain will fundamentally win. If enough young people speak up, they cannot ignore us.
More about Yungblud:
yungbludofficial.com
facebook.com/yungblud
instagram.com/yungbludmusic
twitter.com/yungblud
Photography by Tavy Hornbrook:
Editing by Alexander Salem:
Aquilo
Interview — Aquilo
Pretty Normal People
Aquilo’s Ben Fletcher and Tom Higham describe themselves as “pretty normal people”. But as ordinary these two guys might be, as extraordinary and touching is their music. An interview about friendship and the meaning of normality—and how to make music out of it.
9. Mai 2018 — MYP N° 22 »Resistance« — Interview & Text: Jonas Meyer, Photography: Maximilian König
You have to imagine following: Two very talented young musicians live in a 1,500-people town in the northwest of England, even live on the same street—and how do they get to know each other? On Soundcloud. One of them, Ben Fletcher, released a song there about six years ago. And the other one, Tom Higham, became aware of it, contacted his near-neighbor and invited him to come over and make some music together. After the first encounter in real life, it quickly became clear to both that there could be something in common in music.
What followed was the wonderful story of Aquilo, whose soulful and touching music reached—from a small town called Silverdale—the ears and hearts of millions of people around the world. Their first joint song “You There”, which they—who would have thought it—released on Soundcloud, spread across the globe at lightning speed and today counts almost two million clicks on this platform alone. By the way, a success that they had not expected at all and which initially irritated them, as they told our colleagues from Stereogum in mid-2015.
Soon, Aquilo started touring the world and played in countless countries. After a while, the two artists decided to move away from Silverdale because of the music. Their first stop was Manchester, then they moved to London. In 2017, Ben and Tom finally released their first album “Silhouettes”. The record was accompanied on YouTube with their “Silhouettes Trilogy”, a series of three music videos about the lives, dreams, and fears of ordinary people in northern England.
A few days ago, Aquilo released their second record called “ii”—or rather the second part of it, as the first half of the album they had already published at the end of last year. The new record’s song “Who are you” alone is so wonderful that it would be worthwhile just to talk and write about it. But that wouldn’t embrace at all the musical world that these guys from Silverdale have been created—because there is so much more.
Jonas:
Three years ago, you said in an interview with Stereogum that the positive reaction to your music “doesn’t really make sense”. Are you able to deal with it in the meantime?
Ben:
That’s humble, isn’t it? I think what we were trying to bring across there is that it’s surprising that so many people like our music. It’s incredible.
Tom:
It’s something that we never expected. Any praise we get from anyone is the best fame for us. We are happy about that because we don’t expect any praise.
Jonas:
A couple of years ago, you also said that you never intended in playing your music live. Today, after you’ve travelled the world and have played so many concerts, how would it feel to cut off this live-part of your music?
Ben:
I was thinking about this today! We don’t tour that often and when we are not on tour, we get this itch, we get this need to go away and gig. Without touring, I’d probably get quite frustrated. Making music in the studio is fun—but getting out and actually seeing people physically enjoying our music is a completely different feeling—I’d say it’s a better feeling.
Tom:
It’s the perks of recording music, you get to play it live. We don’t actually tour that much but when we do it’s really amazing. It’s a real change for us, especially with a new setup. I think a lot of things have changed with us recently. It has progressed, hopefully in a good way—it’s a lot more exciting.
»We wouldn’t have been able to relate to a music video that had super whacky people starring in it.«
Jonas:
Last year you published the “Silhouettes Trilogy”, a series of three music videos showing regular people with regular problems. Why was it so important to you to underline the meaning of normality?
Ben:
We wanted the videos to be something that people like. We wanted it to be a proper story, something we can relate to. And we are pretty normal people, I’d say. We wouldn’t have been able to relate to a music video that had ‘super whacky’ people starring in it. So, the video is quite basic and normal; it could have been about any of our friends. It’s about the music, that’s the thing.
Jonas:
How did you come across the people who feature in the “Silhouettes Trilogy”?
Ben:
We weren’t able to attend the video shoot because we were touring through America when it was being filmed. So, we didn’t get to meet these people. We actually never really got to know them that well, but we spent an evening with some of them quite a while after when we went to the premiere. So that was all about the director. But it actually had something quite nice of not being there—they were able to do what they wanted to put in. We had already put our input in it and it was nice for us to leave them do it.
Jonas:
In the fourth video titled “The Story of Silhouettes”, you say there was a point in your lives when the comfort of home “brings boundaries” and you decided to leave Silverdale and move to London. What boundaries did you mean?
Tom:
I was referring to the aspects of recording music. At that time, we were recording at my dad’s basement in my house in Silverdale and we wanted to get out. I just came back from university and I was working in a factory, then I was working in a coffee shop and I just wanted to make music full-time. So, this was the opportunity! We got signed by a record label at that time and it was crazy. We actually moved to Manchester first, where we got a studio and bought new equipment.
Ben:
Eventually we had to move to London. At home, there are boundaries like being surrounded by friends and often it can be distracting, especially in Manchester. It’s just really nice to detach yourself from what you’re writing about. When we moved to London, it all just seemed to be the right process. It was a lot easier and quicker as well! We were quite focused.
»It’s quite comforting that I can go home, not telling anyone about it, and then I can just call someone and they are there.«
Jonas:
In your song “Close to Magic”, you give a very intimate look into your personal lives back in Silverdale. What does coming home mean to you in times when you’re constantly travelling around the world?
Tom:
For me, home is one of my favourite places. Whenever I go home, it’s kind of weird—all my friends are still there and they are still doing the same things. Not that there’s anything wrong with that, it just kind of fascinates me. It’s quite comforting that I can go home, not telling anyone about it, and then I can just call someone and they are there. They haven’t moved, they are all doing the same thing. It’s really nice and feels like a really safe place. That’s for all that part of England where we’re from.
Jonas:
By now, millions of people have watched your videos and listened to your songs. Why do so many people have such a strong connection to your music?
Tom:
I don’t know! I was at school at that time when we had recorded our first song “You There”. Ben came to my house after school one day and we checked our Sound Cloud account—it had like 5,000 plays, that was crazy!
Ben:
We were freaking out. And then, a few years later, it has come to millions. I don’t know. We are just happy with how many people like our music. It’s weird.
Jonas:
Your song “Who Are You”, for example, is especially touching. It seems like you give a lot of yourself into this music. Do you sometimes think you give too much?
Tom:
I think that song especially means a lot. We met these new people after going through bad breakups at that time, and for me, the song is very much about that. And I don’t see it as a negative thing at all, I actually think it’s one of the most positive songs we’ve ever made. It’s a celebration of happiness, in a way—it means a lot to me.
»Making music is basically all we do—and maybe going to the pub on a Thursday or Friday.«
Jonas:
“Who Are You” is part of the “ii Side A” that you released in November 2017. This EP is the first half of your new record “ii” that is going to be published on the May 4th. Why did you decide to release the first part of the record half a year before the rest? Is there a difference between “Side A” and the rest of the album?
Tom:
That’s a funny question because there never was meant to be a difference. But I feel there might be a tiny bit of a difference.
Ben:
Tom and I spent a hell lot of time making music. It’s basically all we do—and maybe going to the pub on a Thursday or a Friday. And I think with that, your sound is developing all the time. You can’t consistently have one sound. Well, you can, but we always find new sounds and new influences quite quickly. So, we made the first half of the record and while we were in the studio and getting it mixed, we were still working there. It’s been just two months since we wrote the first half and the sounds already slightly started to change. It all definitely feels concise. I think you can tell that we wrote the second half in a somewhat different way to the first half.
Tom:
I think there’s a slight bit more energy in the second part.
Jonas:
So, the second part went to different musical directions?
Ben:
Yes, I think so! We were listening to different musicians whilst we were making the second half.
Tom:
You can hear that. We’re always evolving musically, like everyone who makes music. You’re always influenced by new people. And this album is kind of special to us because it gave us the chance to actually produce everything ourselves. On the first record, we had a couple of other people involved like Ólafur Arnalds and those guys who helped us in production. It’s been a massive learning curve since that first album! We had the chance to do everything ourselves now. And it makes us feel very close to it.
»Well, we share a bank account, we live with each other—it’s like a marriage!«
Jonas:
You got to know each other five years ago and started making music together. How would you characterise the friendship between you?
Ben:
Well, we share a bank account, we live with each other—it’s like a marriage!
Tom:
The only difference between marriage and what we have now is that we sleep in different beds—that’s literally it! Sometimes we even have to sleep in the same bed, for example in a hotel room. We’ve become like best mates! We also live with our mate Harvey Pearson, he’s a photo and video artist and films a lot of our things. It’s weird, because we didn’t really know each other that well before we started writing music together. You know, we lived across the road and there’s a little bit of an age gap between us, so we didn’t really hang out with each other. When Ben came over, it was just for music, constantly. And a couple of days after our first song “You There” was released, when we got to meet managers and so on, things started to happen with us.
Ben:
It’s like a friendship that sort of grew just without thinking of it. Initially, we were just working with each other. And also, we’re writing songs on a quite personal level, so I suppose we know each other.
Jonas:
Where do you find each other in music?
Tom:
In terms of song-writing, one song will mean a lot more to Ben and one song will mean a lot more to me. Or it might be about a situation that Ben has gone through. That’s kind of how we do it. There are some songs that we don’t write like that, but more or less, it’s about one or the other’s experiences.
Jonas:
We already talked about the fact that many people love your music. Do you also have musical heroes, people that create music that you really love?
Tom:
There’s massive songs from Explosions in The Sky that I love! That’s kind of progressive rock that I really like. I think it kind of like progresses from rock ‘n’ roll. But I also like stuff from the Dust Rays, Toto, and all these guys.
Ben (laughing):
Toto?! Haha, I love it!
Tom:
Yeah.
Ben:
I was in a grunge band before, with some of my mates in my village. I had an obsession with Kurt Cobain. I even studied him at school. There was this project where we spent months looking into Kurt Cobain and reading books about him. We probably wouldn’t know these things, because we’re just too young. I mean, I was born the year after he died! I was so fascinated with the whole grunge era. And Pearl Jam as well, I was obsessed with Eddie Vedder. That’s weird because it’s way before my time. My dad was massively into Steely Dan. I actually got to see them in New York! We were playing at a festival there, two shows in one day within four hours. But then my mum called and told me, “Oh my god, Steely Dan is playing in New York”! So, our manager Hamish made a phone call and was like “Mate, I’ve got free tickets!” I played our show, got off the stage, went into a taxi, straight to Steely Dan, watched four or five songs, front-row seats, and then had to leave back to our venue, got on the stage and played the second show. It was the best day of my life!
Jonas:
Last year, we met Australian singer-songwriter Kat Frankie for an interview. She once said, “people that write sad songs are a little happier”. Are you a good example for that?
Tom:
For me, sad songs are kind of moving and very atmospheric. And I’m not talking about Adele songs, I’m talking about Explosions In The Sky and these guys. The chords are quite minor in a lot of ways. That doesn’t make me sad, it’s the complete opposite in fact.
Ben:
I get more feeling from a sad song than from a happy song. My favourite albums are the ones that make me sad. Even when I’m really happy, I enjoy listening to them. But when I’m really happy, I don’t want to make music by myself. If I’m sad, I can go and write about it. But when I’m happy, I just want to carry on what I’m doing.
Photography by Maximilian König
Bertan Canbeldek
Portrait — Bertan Canbeldek
Jeder spricht Zirkus
Mit seiner neuen Show im Berliner Chamäleon hat Bertan Canbeldek seit Februar wieder alle Hände voll zu tun: Der Meisterjongleur widersteht dort jeden Abend der Schwerkraft. Für MYP schreibt der 26-Jährige exklusiv über die magischen Momente und Schmerzgrenzen des Zirkuslebens.
31. März 2018 — MYP N° 22 »Widerstand« — Text: Katharina Weiß & Bertan Canbeldek, Fotos: Steven Lüdtke
Auf der Bühne stapeln sich Bierkästen und Kartons, die Konfettikanone lässt subtilen Glitzer auf die Szenerie regnen und ständig fliegt irgendein Körper in engen Jeans oder auch mal nur in Boxershorts durch die Luft: Die neue Zirkusshow FINALE im Chamäleon-Theater am Hackeschen Markt ist genau die Art von artistischer Kollektivleistung, die Berlin verdient hat. Pulsierende Flackerlichter, elektronische Beats und rotzig-rohe Stunts, die sich weniger der Hochkultur anbiedern, sondern eher die pure Energie einer urbanen, wild gemischten Jugend einfangen.
Bertan Canbeldek ist eines dieser Zirkuswunderwesen, die hier beinahe jeden Abend – und noch bis zum 19. August – vor Publikum mit ihrem Hausrat jonglieren oder von der Decke hängen. Der 26-Jährige, der in Kreuzberg geboren und aufgewachsen ist, absolvierte 2010 die “Staatliche Artistenschule“ in Berlin und tourt seitdem mit seiner Kunst durch die Welt. In der aktuellen MYP-Ausgabe beschreibt er, wie sich das Leben als Zirkusartist anfühlt.
Kurz bevor ich auf die Bühne darf, fühlt es sich so an, als würde für eine Sekunde die Zeit stehenbleiben. Ich atme einmal tief durch, die Vorfreude kitzelt an meinem ganzen Körper und ich trete ins Licht der Scheinwerfer. Es ist wirklich magisch: In dem Moment, in dem ich auf der Bühne stehe, fühlt es sich jedes Mal wie das erste Mal an. Das Adrenalin ist dabei der Helfer der Artistik: Wenn es in meine Venen schießt, kann ich einmal mehr alles geben. Um diese Leistung zu bringen – manchmal sind es acht Shows in einer Woche –, musste ich meinen Körper sehr gut kennenlernen. Ich weiß, wie ich ihn pflegen muss und wie ich reagieren sollte, wenn was im Rücken zwickt.
Als Artist tanzt und trickst man gegen die verschiedensten Widerstände an: Ich versuche, in einer Jonglage mit sieben Gegenständen der Schwerkraft zu trotzen und mit jedem neuen akrobatischen Trick die Grenzen der eigenen Körperlichkeit etwas herauszufordern. Ich erinnere mich an viele, viele Stunden, in denen ich in einer Ecke stand und wie ein Verrückter einen Trick wiederholte, von dem ich mir nie sicher sein konnte, ob ich ihn am Ende wirklich hinbekomme und jemals zeigen kann. Der Widerstand gegen die Stimme im Kopf, die einem zuflüstert: „Es ist ok, jetzt aufzuhören“, entscheidet oft über das Gelingen. Immer wieder treibt man sich an die Schmerzgrenze und darüber hinaus. Die Techniken, um in diesen Momenten anfänglicher Frustration stark zu bleiben und diese Widerstände zu akzeptieren und zu überwinden, machen den Beruf eigentlich wirklich aus.
»Im Zirkusalltag ist der Spaß mindestens genauso wichtig wie die Disziplin.«
Im Zirkusalltag ist der Spaß mindestens genauso wichtig wie die Disziplin. Ich muss auf nichts verzichten – und kann auch mal am Tag vor einer Show auf eine Party gehen. Sich trotzdem nicht vollkommen gehen zu lassen, gebietet der Respekt vor dem Publikum: Wenn ich am Abend auf die Bühne gehe, dann ist es für mich selbst vielleicht die 34. Show. Aber für andere ist es das erste und einzige Mal, dass sie das erleben können. Etwa für den Papa, der mit seinen kleinen Kindern die Show besucht. Da wäre es einfach nicht angemessen, wenn ich nicht in Topform auf der Bühne stehen würde.
Dass ich mich heute Zirkusartist nennen kann – ein ungewöhnlicher wie schöner Beruf –, habe ich meiner großen Schwester zu verdanken. Ich komme nicht aus einer Zirkusfamilie. Meine Eltern sind türkischstämmige Berliner, wird sind fünf Kinder, ich bin auf den Kreuzberger Straßen groß geworden. Ich war ein eher schüchterner siebenjähriger Junge – und war deshalb ziemlich aufgeregt, als mich eines Tages meine Schwester unterm Arm packte, aus der Tür zog und sagte: „Du kommst jetzt mit in den Zirkus!“ Seitdem war ich gefühlt jeden Tag in der Manege. Zuerst lernte ich die Clownerie und das Zaubern, die körperlich herausfordernden artistischen Tricks kamen erst viel später.
Mit 14 schaffte ich es gerade so, an der „Staatliche Ballettschule und Schule für Artistik “ in Berlin aufgenommen zu werden. Dort ist die artistische Ausbildung in eine normale Schulbildung integriert. Jeden Morgen um halb sechs musste ich aufstehen, um dann von Kreuzberg in die Greifswalder Straße zu fahren. An manchen Tagen ging der Unterricht bis 18 Uhr, das war körperlich irre anstrengend. Alles war sehr professionell dort, es gab die besten Übungsgeräte und eine spannende Gemeinschaft: Auf der einen Seite gab es die Ballettschüler mit ihrer disziplinierten Haltung, der ordentlichen Ästhetik und ihren strengen Diäten – und auf der anderen Seite gab es uns Zirkuskinder mit unseren bunten Klamotten und wilden Tricks.
»Unzählige charismatische Menschen haben etwas von ihrer Persönlichkeit in meinen Koffer gelegt.«
Seit meinem Abschluss sind bereits sieben Jahre vergangen und ich habe von Australien bis Israel in unzähligen Ländern mit Weltklasse-Artisten performen dürfen. Ich habe wilde Partys gefeiert und – innerhalb der Szene sowie am Rande meiner Reisen – unzählige charismatische Menschen kennengelernt, die alle etwas von ihrer Persönlichkeit in meinen Koffer gelegt haben. Ich war keinen Tag unglücklich. Dass ich bereits als Kind etwas finden durfte, dass mir Freude macht und später zu meiner täglichen Beschäftigung geworden ist, ist etwas ganz Besonderes.
Natürlich freue ich mich auch sehr, für die Dauer der Show mal für längere Zeit in Berlin bleiben zu können. Ich freue mich, meine Familie regelmäßig zu sehen oder einfach mal zu meiner Freundin nach Hause fahren zu können, anstatt immer nur mit ihr zu skypen, wenn ich unterwegs bin. Das tut schon gut.
»Unser Projekt heißt FINALE, weil jeder von uns ein Finale ist – wir alle sind gleichgestellt.«
Unser Projekt heißt übrigens FINALE, weil jeder von uns ein Finale ist – wir alle sind gleichgestellt. Und dahinter stehe ich zu einhundert Prozent. Einer der Gründer unserer Kompanie, Florian Zumkehr, hatte damals die Idee, der klassischen Artistik eine experimentelle Note zu verleihen. Weg vom Glamourösen der Bühne und hin zur roughen Attitüde der Straße. Einfach mal ein Holzbrett nehmen, damit experimentieren und herausfinden: Was kann man damit anstellen? Wie wir herausgefunden haben: so einiges!
Bei FINALE kann man sich voll und ganz wegträumen. Uns begleiten ein Live-Drummer und die Sängerin Ena Wild, die ebenfalls live singt. Als Performer bin ich total gelöst und frei innerhalb der Choreografie, dadurch fühlt sich alles natürlicher an und ich kann mehr improvisieren. In Prag haben wir bereits viel Beifall für diese moderne Art des Zirkus bekommen, jetzt sind wir gespannt, was das Heimatpublikum in Berlin sagt. Aber eigentlich bin ich da ziemlich zuversichtlich. Egal, vor welchem Publikum man auftritt: Jede Kultur findet eine Verbindung zum Zirkus. Der Zirkus kennt keine Sprachen. Jeder „spricht Zirkus“: Auf der ganzen Welt verstehen die Menschen intuitiv, was man ausdrücken will.
Bertan Canbeldek online:
bertan-artist.de
facebook.com/bertanc
instagram.com/bertan_canbeldek
facebook.com/chamaeleontheater
The Boxer Rebellion
Interview — The Boxer Rebellion
Of Melancholy And Confidence
With their new album “Ghost Alive”, The Boxer Rebellion just released their “most personal and human record to date”. In our interview with band members Nathan Nicholson and Andrew Smith, we found out why this record became so honest and intimate. And why melancholy isn’t something to be shied away from.
25. März 2018 — MYP N° 22 »Resistance« — Interview & Text: Jonas Meyer, Photography: Steven Lüdtke
A small graveyard near London. It is late fall and brown and yellow leaves cover the ground. A man slowly hunkers down in front of a tombstone. He holds a photo in his hand and gives it one last look before carefully placing it at the foot of the stone. The sound of an acoustic guitar sets in, followed by a strong yet soulful male voice: “Here I am / I lost you once / I won’t lose you again“.
The man is Nathan Nicholson, lead singer of the band The Boxer Rebellion. And the scene described above can be found in the official music video for “Here I Am” – one of eleven songs on the band’s new record “Ghost Alive”. The Boxer Rebellion has been making music together since 2001, but according to the group this album is the “most personal and human record to date, an album born of hope through heartache“.
In accordance with this, the video’s plot isn’t mere fiction but tragic reality. The photo, which Nathan places at the bottom of the tombstone, is a picture of him and his father who passed away a little over a year ago.
Nathan’s story is so personal, that one doesn’t quite know how to deal with this stranger’s openness and intimacy except for being touched by it. The clear and powerful sound draws you in. And this isn’t just the case with “Here I Am” The entire album is extremely inducing and evocative – or simply said: “Ghost Alive” is an extraordinary piece of music.
At the end of the text accompanying the new record, the group writes: “As The Boxer Rebellion know more than anyone, nothing that’s really worth loving can truly die. Every effort must be made to make it count, doing all that you can to savour the many shades of light and dark. Nothing is black and white. There’s far more to life than mere survival.“ Maybe herein lies the secret behind The Boxer Rebellion’s 17 years of making fantastic music. We met them for an interview in Berlin.
Jonas:
Three weeks ago, you released the music video for your new song “Here I Am” which is very personal and deals with Nathan’s loss of his father. How did you find the courage to share such intimate and personal thoughts with us, the audience—people you don’t know and who you’ve never met in your life?
Nathan:
We actually wrote that song for a movie which didn’t end up working out. After that, I changed the lyrics and made them more my own. Right before we went into the studio to record the song, my father then passed away. I wouldn’t say I was in a dark place, I was just in this place that you’re in after losing someone—there was this cloud above us whilst recording. Finally, we shot the video with our good friend Ry Cox. Ry has toured with us and has really gotten to know what we’re after and what we’re all about. It was his 4th video for us and it was nice to be able to do something quite personal. We’d never done a London centric video even though that’s where we’re based. We’re a London band. It was nice for me also to watch it after. We put a photo of my dad and me in there.
Jonas:
Watching this video and listening to the music is like sitting in a room with someone telling you they just lost someone — you can’t hide, you don’t know what to do, you don’t know how to react.
Nathan:
Yeah, watching it for the first time was weird for me, too. Obviously, I was there, we all were there whilst filming the video, but it was an emotional moment seeing it.
»Working with CALM was a chance for us to do something different that has more impact than just releasing a song.«
Jonas:
“Love Yourself” is another song on your new record that demonstrates a similar degree of intimacy. With this song, you’re supporting the mental health charity CALM what stands for “Campaign against living miserably”. What is the idea behind that?
Nathan:
We’re just highlighting the issues of male suicide and the problems of mental health and how these issues are viewed by everyone. I mean I know there’s a lot more discussion about it now which is really good. Working with CALM was a chance for us to do something different that has more impact than just releasing a song: To see how we and our songs could potentially help.
Andrew:
I’m really happy with how these two songs and the CALM campaign have been received. It feels very genuine and very sincere. So much of the time with Social Media, TV and everything, you’ve got these trends where certain emotions and topics are marketed and capitalized on—and are really abused and exaggerated. CALM brought together all these musicians and like I said, it feels very genuine. It seems like it’s coming from a true place. Everyone involved seemed willing to be on board because it was something they truly seemed touched by.
Jonas:
One of our photo artists told me that your first record “Exits” helped him through a very tough time. I think the ‘helpful’ element is still a central part of your music. For example, in “Don’t Ever Stop”, there’s this trumpet part that feels like someone is holding you and giving you solace and hope. Is giving hope one of the reasons why you make music?
Nathan:
I wouldn’t say so, I don’t ever really think about it like that. I kind of just make music that makes me feel something. It’s funny because I remember when we were doing interviews for our last album. I was thinking this is a really happy record because it’s very colorful, it has a colorful cover, a colorful kind of vibrate sound, we recorded it in the “LA sunshine” etc. Well, that’s what we thought. And then we heard other people say: “Oh, this is really dark and depressing!”
Andrew:
And we were just trying to have fun.
Nathan:
So, we don’t set out to this or that specific thing, we just want to do something that sounds nice and comforting—something that just sonically has to sound good.
Jonas:
You just told us that you had already written all of the songs before your father passed away. Did this tragic event have an impact on your sound, on your music?
Nathan:
I don’t know if it did necessarily. Andy did a lot of the arrangements and I don’t actually play an instrument on that record, I just sing. So, for my side, just the singing side, it’s easier, to a degree, to sing something if you feel it. And so that’s kind of where I was coming from. I could feel everything. Between demoing a song and recording it, months or even years pass. You’re out of the headspace you were in back then, and I think that was the case for me. I was in a completely different place and it was almost like a completely different take on the song.
Andrew:
Yeah, I guess also the textures and the timbres play a huge part of creating certain moods in songs and even a single phrase like “Love Yourself” or “Here I Am!”, or whatever, can be interpreted in so many different ways if you hear certain instruments accompanied with it. You’re encouraged to come in from a different angle.
If you have drum machines or electronic stuff and the tempo is different, it will probably take on a different meaning. There are lots of different ways in which you can produce a song as a band, to suit different kinds of sentiment. We found that using those instruments, acoustic stuff, strings, horns—there’s a lot of harp on the album as well—, that that got something so natural to resonate. Even though the songs were already recorded, there was this certain kind of mood was set upon especially Nathan but really all of us which influenced our sound. Maybe we were encouraged to follow our mood down that route and the album reflects that.
»I’m a little bit sick of things being too dehumanized and a little bit too electronic.«
Jonas:
A couple of months ago, we met Awolnation’s Aaron Bruno for an interview. He said that he didn’t want to have any “fake shit” on his new record like auto-tuned voices, for example. He said that today, people are looking for something else. What is it in your opinion that people really want musically?
Andrew:
I don’t know. I mean certain sounds just really affect people. Like there’s a certain time of night, if I’m in a busy place like a club, and I hear a certain synth sound, it really gets me emotionally. And a couple of acoustic guitar strings ringing out is another thing that does it for me. So, I don’t know. I guess it would depend on whatever sounds you’ve heard throughout your life. And then hearing them in a certain context can really hit you hard. I’m a little bit sick of things being too dehumanized and a little bit too electronic. I think a balance of that kind of stuff is great. But I do prefer something where you can actually hear the person playing it and you can hear little mistakes and things like that. I think that resonates with me.
»I felt like being in the band could and should not be taken for granted.«
Jonas:
You guys founded your band in 2001, so you’ve been making music together for 17 years now. Is continuity a form of resistance—or “rebellion”—in these unstable times we’re facing today?
Nathan:
I guess you could view it as continuous… Andy actually joined the band later, four years ago—but that also feels like a long time now. So yes, everything with the band feels pretty stable. But when you’re in it, I don’t really think of it in that way. You’re kind of always onto the next thing. So, like for instance with this new record, when you see it in its packaging, it’s done. You’re like ok, we’re down with that one. Even we’ll be touring it, and we’ll be touring it for a while, but in my mind, I kind of start thinking about what’s next.
Andrew:
And we’ve had other factors like outside of the music. For example, after our US tour that ended one and a half years ago, we didn’t really know what the next step would be for us. For me, and I’m just speaking for myself, I felt like being in the band could and should not be taken for granted. I felt grateful and maybe that makes it even more satisfying. I mean like musically it has been very continuous. You never worry that the music will dry up or something like that, but all the other factors surrounding the music those are the dangerous ones.
Jonas:
In your official press kit, your band member Adam Harrison said: “I don’t think melancholy is something to be shied away from.” Would you say allowing melancholy to enter into your life makes you happier in the long run?
Nathan:
I believe so. I think it’s good to accept different emotions and to accept that you can’t always be on top form. It’s just taking the good with the bad and being able to do that. And knowing that it will get better, even though it may get shit, but yeah, eventually it will get better. So, I think it’s good to have a bit of melancholy in your life.
Andrew:
Melancholy is such a universal thing. It’s hard to speak to hundreds or thousands of people in a melancholic way. That just doesn’t really happen. But to play music to people that is a bit melancholic, that’s a much more accepted thing. And it’s a way to connect with people a lot quicker than if you just started talking about the reasons why you feel sad.
Nathan:
Yeah, imagine going to a concert and it’s just a chat about how you’ve felt really shitty. Everyone would be like: “Oh, god…” Put a beat to it and it’s fine.
»Melancholy is a big part of what people want to express.«
Jonas:
Adam also says: “We need to recognise the legitimacy of sadness.” Is the legitimacy of sadness the base of the legitimacy of making music?
Andrew:
I don’t think it’s the base of making music necessarily. I think music is an expression of all kinds of emotions. It’s a way of reaching people even those far away from you. And this happens time and time again, it’s almost like listening to the same story over and over again. When I listen to my favourite songs, they touch me in a different way every single time. And I’m grateful to the songwriters who wrote those songs because they really helped me through hard times. Expression is at the root of music and melancholy is a big part of what people want to express.
Jonas:
Are there any bands that give you the same amount of solace and hope that other people find in your music?
Nathan:
U2 always makes me cry—when I’m drunk (laughs).
Andrew:
I think the biggest initial reaction I’ve had to a songwriter or an album is when I heard Bon Iver’s first record “For Emma, Forever Ago”. It doesn’t snow that much in Bedford where I’m from, but I remember a friend of mine just put that on in my car and it was a really unique experience. And even then, come to think it, I must of have been around 18, it was a very precious thing to hear. This is only 12 years ago, but I feel like back then, I wasn’t blasted with music everywhere I went. I didn’t have Spotify, I didn’t have music on my phone, music was a little bit more precious then. I couldn’t just search for it—I just had this album on CD in my car, driving around through the snow listening to it. I will probably never get that feeling again. It was pretty immersive—and that will stay with me.
More about The Boxer Rebellion:
theboxerrebellion.com
facebook.com/theboxerrebellion
instagram.com/theboxerrebellion
Photography by Steven Lüdtke:
Jannik Schümann
Interview — Jannik Schümann
Anfang einer neuen Zeit
Jannik Schümann zählt zu einer jungen Generation deutscher Schauspieler, für die Haltung nichts ist, was man sich leisten können muss. Sondern etwas, das diesen Beruf erst möglich macht. Ein Interview über die Frage, in welche Richtung sich unsere Gesellschaft entwickelt. Und wie man sich darin als Künstler positionieren kann.
17. März 2018 — MYP N° 22 »Widerstand« — Interview: Jonas Meyer, Fotos: Maximilian König
Als Max Frisch mit seinem „Tagebuch 1946–1949“ eine literarische Bestandsaufnahme Europas nach dem Zweiten Weltkrieg verfasste und damit eines seiner bedeutendsten Werke schuf, notierte er: „Wir leben auf einem laufenden Band, und es gibt keine Hoffnung, daß wir uns selber nachholen und einen Augenblick unseres Lebens verbessern können. Wir sind das Damals, auch wenn wir es verwerfen, nicht minder als das Heute – die Zeit verwandelt uns nicht. Sie entfaltet uns nur.“
Das, was in Europa in der Mitte des letzten Jahrhunderts passierte, wird auch – soviel sei bereits verraten – Gegenstand des folgenden Interviews mit Jannik Schümann sein. Es wird aber auch um ein anderes, sehr persönliches Damals gehen, das von dem Heute nicht ganz so weit entfernt liegt wie die Jahre 1946 bis 1949.
Bei dem persönlichen Damals handelt es sich konkret um den Nachmittag des 11. Mai 2011, als wir Jannik zum ersten Mal in Berlin begegneten. Der junge Schauspieler war gerade von Hamburg in die deutsche Hauptstadt gezogen und redete mit uns in seinem ersten Interview über das Fernsehdrama „Homevideo“ – ein Film, der auf das Thema Mobbing an Schulen aufmerksam macht und für den Jannik die Rolle eines 15-Jährigen schlüpfte, der einen Mitschüler mit einem kompromittierenden Video erpresst und diesen letztendlich in den Selbstmord treibt.
Ein weiteres, ebenfalls sehr persönliches Damals bezieht sich auf den 28. Mai 2013, als wir Jannik zu einem zweiten Interview trafen, diesmal in New York. Im Central Park unterhielten wir uns über sein bis dato jüngstes Engagement: Für den Kinofilm „Spieltrieb“ übernahm er die Rolle des 17-jährigen Alev, der keine moralischen Skrupel kennt und es genießt, andere Menschen zu manipulieren und sie als Marionetten zu missbrauchen.
Steigen wir aber ein ins Heute, genauer gesagt in das noch junge Jahr 2018 – und in unser drittes Interview mit dem bemerkenswerten Schauspieler. Mit seinen gerade einmal 25 Jahren kann Jannik Schümann bereits auf zwölf Jahre Film- und Fernseherfahrung zurückgreifen. Was insbesondere die letzten beiden Jahre angeht, hat Jannik einen regelrechten Produktionsmarathon hinter sich: Bis vor wenigen Tagen stand er für die Fortsetzung der ZDF-Serie „Charité“ vor der Kamera, davor drehte er unter anderem für die ARD-Serie „Die Diplomatin“ sowie für die internationale Produktion „The Aftermath“ an der Seite von Keira Knightley und Alexander Skarsgård.
Auch im Kino war der Schauspieler in letzter Zeit mehr oder weniger dauerpräsent: etwa im Film „Die Mitte der Welt“, einem international vielfach ausgezeichneten Liebesdrama, in dem Jannik an der Seite von Louis Hofmann in einer der Hauptrollen zu sehen ist. Oder in „High Society“, einer ulkigen Gesellschaftskomödie mit Iris Berben, Emilia Schüle und Jannis Niewöhner, die fast zeitgleich mit dem dystopischen Drama „Jugend ohne Gott“ Premiere feierte.
„Jannik has an actor‘s face“, würde man in der Branche wohl sagen. Doch wer den schauspielerischen Werdegang dieses jungen Mannes nur en passant betrachtet, wer nicht mehr wagt als einen flüchtigen Blick, wer die Bandbreite seiner Charaktere vorschnell auf den „fiesen Schönling“ reduziert, der tappt in eine Falle.
Man muss nur ein kleines bisschen genauer hinsehen, um zu bemerken, dass sich Jannik Schümann mit vielen seiner Rollen genau die Themen aussucht, zu denen es in unseren Zeiten etwas zu sagen gibt. Wie beispielsweise 2015, als er in „Mein Sohn Helen“ eine transsexuelle Jugendliche spielte. Oder wie vor kurzem in „Jugend ohne Gott“, wo er mit seiner Figur des Titus zeigt, wie es ist, wenn eine Gesellschaft nur noch aus leistungsgetriebenen Individuen besteht, denen jegliches Mitgefühl abhandengekommen ist.
Seit unserem letzten Interview mit Jannik ist viel passiert auf der Welt. Als wir im Juni 2013 im Central Park saßen und uns unterhielten, hatten die USA noch keinen „Travel Ban“ gegenüber Muslimen mit bestimmter Nationalität verhängt, Hollywood wusste noch nichts von dem Hashtag #metoo und im Deutschen Bundestag war noch keine rechtspopulistische Partei vertreten. Wenn es in der jüngeren Vergangenheit eine Zeit gab, in der man gezwungen war, erwachsen zu werden, dann war und ist es diese. Und wie schnell es mit dem Erwachsenwerden gehen kann, zeigt der Welt gerade eine Gruppe 17-Jähriger aus Parkland, Florida.
Jannik Schümann – wir spoilern erneut – ist in den letzten fünf Jahren sehr erwachsen geworden. Und Gott sei Dank ist er nicht alleine. Jannik zählt zu einer jungen Generation deutscher Schauspieler, für die Haltung nichts ist, was man sich leisten können muss. Sondern etwas, das es erst ermöglicht, diesen Beruf ernsthaft auszuüben. Wie hat es Max Frisch 1946 beschrieben? „Die Zeit verwandelt uns nicht. Sie entfaltet uns nur.“
»Meistens ist es bei einem neuen Film so, dass ich mich selbst nicht wirklich mag, wenn ich mich zum ersten Mal auf der Leinwand sehe.«
Jonas:
Im letzten Jahr warst du fast zeitgleich in zwei Kinofilmen zu sehen, die unterschiedlicher nicht sein könnten: Ende August lief „Jugend ohne Gott“ an, eine Verfilmung des gleichnamigen Buchs von Ödön von Horváth aus der Zeit des Nationalsozialismus. Und gerade einmal zwei Wochen später startete die schräge Komödie „High Society“ in den Kinos. Kann einem Schauspieler aus PR-Sicht überhaupt etwas Besseres passieren?
Jannik:
Klar, medial war das für mich selbst natürlich ein glücklicher Umstand. Für die Zuschauer dagegen ist es eher ungünstig, wenn sich bei zwei Filmen, die im Abstand von zwei Wochen ins Kino kommen, gleich drei Schauspieler decken – wenn man Iris Berbens Gastauftritt mitrechnet, dann sogar vier. Eigentlich war geplant, dass einer der Filme bereits im März starten sollte und der andere erst im Herbst. Dann ist aber der zweite nachgezogen und man stand wieder vor dem gleichen Problem.
Aus inhaltlicher Sicht fand ich es persönlich aber gar nicht schlimm, dass beide Filme fast zeitgleich gelaufen sind. Ganz im Gegenteil: Ich mag beide Filme sehr und konnte aus beiden auch sehr viel mitnehmen. „High Society“ hat mir zum Beispiel die Möglichkeit gegeben, mich zum ersten Mal in meinem Leben komödiantisch auszutoben. Darüber hinaus war es eine große Ehre, an der Seite von Iris Berben spielen zu dürfen. Daher bin ich auf diesen Film auch irgendwie stolz. Und mindestens genauso stolz bin ich auf „Jugend ohne Gott“. Das ist einer der wenigen Filme in meiner Karriere, bei denen ich tatsächlich mal stolz auf meine eigene Performance bin. Denn meistens ist es bei einem neuen Film so, dass ich mich selbst nicht wirklich mag, wenn ich mich zum ersten Mal auf der Leinwand sehe. Ich muss einen Film erst zwei- oder dreimal anschauen, um mich selbst überhaupt betrachten zu können. Und ich brauche weitere zwei, drei Male, um kritisch beurteilen zu können, was ich da fabriziert habe.
Bei „Jugend ohne Gott“ war ich tief beeindruckt von dem Gesamtwerk. Nicht nur, weil die Dreharbeiten außergewöhnlich waren und ich alleine deshalb eine krasse Verbindung zu dem Film entwickeln konnte. Sondern auch, weil alle Leute, die in dem Film mitgespielt haben, einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen gewonnen haben. Das, was wir da gemeinsam auf die Beine gestellt haben, finde ich immer noch beeindruckend. Ich bin nicht nur stolz auf mich selbst, sondern auf uns alle. Vielleicht ist es mir deshalb auch leichter gefallen, mich selbst in dem Film anzuschauen, weil ich mich dabei weniger als einen einzelnen Schauspieler, sondern vielmehr als Teil eines tollen Ensembles wahrgenommen habe.
Jonas:
Warst du auch stolz auf den inhaltlichen Anspruch, den dieser Film hat?
Jannik:
Natürlich! Ich finde den Film wahnsinnig wichtig, nicht nur für Schulklassen. Was „Jugend ohne Gott“ für mich so besonders macht, ist die Tatsache, dass es uns nicht nur gelungen ist, die wichtigen gesellschaftspolitischen Inhalte des Romans zu transportieren. Der Film ist dabei auch sehr unterhaltsam und hat einen tollen Look. Insgesamt ist er so gemacht, dass die Teenies – unsere Hauptzielgruppe – ihn sich gerne anschauen. Und nebenbei können sie noch etwas lernen.
»Es macht mir grundsätzlich Angst, in welche Richtung sich unsere Gesellschaft entwickelt, das kann man gar nicht anders wahrnehmen oder auffassen.«
Jonas:
Und was genau kann man von „Jugend ohne Gott“ lernen?
Jannik:
In dem Film zeigen wir eine stark leistungsorientierte Gesellschaft. Es geht um eine Gruppe von Schülern, die in einer Art Leistungs-Sportcamp gegeneinander antreten müssen. Nur die Besten und Stärksten haben am Ende die Chance, an einer Elite-Universität aufgenommen zu werden. Soll heißen: Die Starken bilden die Elite, die Schwachen fallen zurück und bleiben liegen.
Ich glaube, dass sich da alle Schülerinnen und Schüler schnell an persönliche Situationen erinnert fühlen, in denen sie viel zu viel Druck von außen erhalten und man ihnen sagt, was sie zu leisten haben. Und dass sie, wenn sie das nicht leisten, nicht mit den anderen mithalten können.
Im Roman gibt es übrigens eine Metapher, die im Film nicht so stark herausgestellt wird: Ödön von Horváth zeichnet die jungen Leute als einen großen Schwarm stummer Fische, die sich gehorsam von außen leiten lassen und völlig emotionslos zur Kenntnis nehmen, was um sie herum geschieht. Nur wenige von ihnen haben den Mut, ihre Richtung zu ändern und gegen den Schwarm anzuschwimmen.
Jonas:
Vielleicht liegt das an den Zeiten, in denen „Jugend ohne Gott“ entstanden ist. Veröffentlicht wurde der Roman im Jahr 1937, vier Jahre nach der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten. Er zeigt uns, wie Jugendliche damals durch das NS-Regime zu teilnahmslosen Mitläufern erzogen wurden. Aber auch ohne die Metapher des Schwarms blinder Fische ist der Film ein dystopischer: Er zeichnet eine düstere Zukunft und wirkt mit seinem Bild der gnadenlosen Leistungsgesellschaft in unseren Zeiten eher real als fiktional: Bereits heute neigt unsere Gesellschaft dazu, jeden Einzelnen an seiner Leistung und Performance zu messen. Macht dir der Film Angst vor der Zukunft?
Jannik:
Es macht mir grundsätzlich Angst, in welche Richtung sich unsere Gesellschaft entwickelt, das kann man gar nicht anders wahrnehmen oder auffassen. Aber darauf hat mich nicht erst dieser Film gebracht – ich denke darüber schon sehr viel länger nach.
Jonas:
Dabei scheint der Roman von 1937 auch aus politischer Sicht gerade aktueller denn je zu sein: Momentan erleben wir, wie immer mehr Länder in Europa nach rechts rücken – ein Trend, vor dem auch Deutschland nicht verschont bleibt. Die Zahl rechter Gewalttaten steigt rapide an, völkisch orientierte Jugendliche organisieren sich in Gruppen wie der „Identitären Bewegung“ und seit wenigen Monaten sitzt eine rechtspopulistische Partei im Deutschen Bundestag. Verändert sich dadurch die Verantwortung, die man als Schauspieler trägt? Ist es in Zeiten wie diesen umso wichtiger, in Filmen wie „Jugend ohne Gott“ mitzuspielen?
Jannik:
Leider haben Filme wie „Jugend ohne Gott“ im deutschen Kino keinen so großen Erfolg wie beispielsweise Komödien. Sie werden hauptsächlich von Menschen gesehen, die ohnehin schon für dieses Thema sensibilisiert sind. Aber die große Masse, die man mit derartigen Themen eigentlich erreichen müsste, schaut sich solche Filme einfach nicht an.
Dennoch halte ich es für wichtig, als Schauspieler in Filmen wie „Jugend ohne Gott“ mitzuspielen und seine Bekanntheit, die man vielleicht durch kommerziellere Produktionen erlangt hat, dafür zu nutzen, um auf ernstere Themen aufmerksam zu machen.
»Jede Form von Kunst kann eine Art von Widerstand sein.«
Jonas:
Kann Schauspielerei eine Art von Widerstand sein?
Jannik:
Du meinst, weil man als Schauspieler bestimmte Charaktere darstellen kann, die gegen Ungerechtigkeit ankämpfen? (überlegt ein paar Sekunden)
Ich glaube, dass jede Form von Kunst eine Art von Widerstand sein kann. Ich finde auch, dass Kunst stellenweise sogar dafür gemacht ist und dass sie in diesem Fall geradezu dafür verantwortlich ist, Widerstand zu leisten. Ich persönlich übe meinen Beruf jedenfalls nicht nur aus, um mich als Schauspieler auszutoben und in verschiedene Rollen zu schlüpfen. Ich übe diesen Beruf auch für andere Menschen aus, um sie mit auf eine Reise zu nehmen. Mit dem, was ich tue, kann ich sie aus ihrem Alltag herausreißen und sie in Bereiche blicken lassen, die sie vorher nicht kannten. Und ich kann sie dazu bringen, über das Leben nachzudenken.
Jonas:
In „Jugend ohne Gott“ hattest du deinen ersten großen Filmmord. Werden die Charaktere, die du spielst, in Zukunft noch böser und martialischer?
Jannik:
Nö! Noch habe ich keinen neuen Bösewicht im Programm. Und jetzt gerade bin ich ziemlich froh, mal einen totalen Gutmenschen zu spielen – bei den Dreharbeiten zur zweiten „Charité“-Staffel, die zur Zeit des Dritten Reichs spielt. Meine Figur ist ein junger Sanitäter, der 1943 aus einem Lazarett an der Front zurück nach Berlin geholt wird. Damals herrschte in allen Krankenhäusern großer Ärztemangel. Aus diesem Grund gab man beispielsweise Kriegssanitätern die Möglichkeit, innerhalb eines halben Jahres ihr Examen im Schnelldurchlauf zu machen. Hatten sie bestanden, durften sie als Ärzte in den Krankenhäusern arbeiten. Wenn nicht, wurden sie als einfache Soldaten abkommandiert und mussten zurück zur Front.
Jonas:
Was macht diesen jungen Sanitäter zu einem Gutmenschen?
Jannik:
Auf der einen Seite ist er total traumatisiert von dem, was er an der Front erlebt hat. Auf der anderen Seite versinkt er nie in seinem Schmerz, sondern schiebt diese schlimmen Erlebnisse beiseite und versucht, nicht nur selbst glücklich zu sein, sondern auch den Menschen um sich herum Mut zu machen.
»Bei der Nachsynchronisation musste ich an einer Stelle ›Heil Hitler!‹ flüstern. Das war ein sehr, sehr unangenehmes Gefühl.«
Jonas:
Du hast im letzten Jahr bei einem anderen Projekt vor der Kamera gestanden, das ebenfalls im Deutschland der 1940er Jahre spielt: „The Aftermath“, eine Verfilmung des gleichnamigen Romans von Rhidian Brook. Das Drama kommt wahrscheinlich Anfang 2019 in die Kinos. Spielst du dort auch einen Gutmenschen?
Jannik:
Nein, in „The Aftermath“ spiele ich einen Trümmerjungen, der 1948 während der britischen Besatzung in Hamburg lebt und dabei hilft, die in Schutt und Asche liegende Stadt wiederaufzubauen. Gemeinsam mit vielen anderen Kindern und Jugendlichen wohnt er selbst in einer Ruine und nimmt als Ältester von ihnen die Rolle des Bandenführers ein.
Dieser Junge ist ein „Werwolf“, das heißt, er war Mitglied einer ehemaligen nationalsozialistischen Untergrundorganisation, die kurz vor Ende des Krieges gegründet wurde. Das Ziel dieser Geheimgruppe war es, hinter den feindlichen Linien Sabotage zu verüben und die Bevölkerung von einer Zusammenarbeit mit den Besatzungstruppen abzuhalten – nicht selten durch Ermordung. Nach dem Krieg hielten sich viele Werwölfe versteckt, die meisten von ihnen waren nach wie vor glühende Hitler-Verehrer. Daher ist auch auf dem Arm des Jungen, den ich spiele, ist die Zahl „88“ eingebrannt. Als ich bei der Nachsynchronisation war, musste ich an einer Stelle „Heil Hitler!“ flüstern. Das war ein sehr, sehr unangenehmes Gefühl.
Jonas:
Verändert es die eigene Wahrnehmung, wenn man bei gleich drei Filmen hintereinander so tief in die Materie des Nationalsozialismus beziehungsweise des Zweiten Weltkriegs eintaucht?
Jannik:
Diese Materie ist wahnsinnig spannend. Ganz davon abgesehen macht es meinen Beruf auch aus, dass ich mich mit den unterschiedlichsten Zeiten und Epochen so stark auseinandersetzen darf. Und das meine ich nicht nur historisch-thematisch. Ich lerne beispielsweise auch viel darüber, wie die Menschen damals den Alltag gemeistert haben oder – ganz profan – welche Kleidung sie getragen haben. Alleine die Recherche der Kostümbildnerin eröffnet mir ein Wissen, zu dem in allgemeinen Geschichtsbüchern kaum etwas zu finden ist. Dabei ist gerade der Aspekt der Kleidung super wichtig: Je besser das Kostüm und die Ausstattung eines Films sind, desto einfacher ist es für mich als Schauspieler, mich visuell in die entsprechende Zeit hineinzuversetzen und meiner Rolle gerecht zu werden.
Bei „The Aftermath“ zum Beispiel haben wir in einem tschechischen Dorf gedreht, das etwa eine Stunde von Prag entfernt liegt. Dort gibt es ganze Straßenzüge, die immer noch aussehen, als wäre der Krieg gerade erst zu Ende gegangen. Nachdem wir alle Komparsen in Trümmerfrauen-Klamotten gesteckt, die Nebelmaschine angeworfen und das Ganze noch mit etwas Schnee, Wind und großen Steinen dekoriert hatten, fühlte es sich am Set auf einmal so an, als würden wir tatsächlich Kriegsstraßen aufräumen.
Jonas:
In „The Aftermath“ spielst du an der Seite von Keira Knightley und Alexander Skarsgård deine erste internationale Rolle. Produziert wird der Film von der Firma „Scott Free Productions“, hinter der der renommierte Regisseur Ridley Scott steht. Was ist bei einer internationalen Produktion anders als bei einer deutschen?
Jannik:
Der Besetzungsvorgang ist sehr viel aufwendiger, weil die Tapes erstmal nach Amerika geschickt werden müssen und der Produzent entscheiden muss, ob er den vorgeschlagenen Cast will oder nicht. Was die Produktion selbst angeht, gibt es Drehtage, an denen es absolut genauso abläuft wie an einem deutschen Set und man keine Unterschiede merkt. Dann wiederum gibt es Tage, an denen einem plötzlich bewusst wird, was für ein immenses Budget hinter so einer amerikanischen Produktion steht – etwa, wenn es darum geht, in einem riesigen Studio ein komplettes Elbufer nachzubauen. Oder wenn man selbst kleine Stunts super aufwendig produziert, die man in Deutschland ganz anders filmen würde. Daher habe ich mich bei „The Aftermath“ stellenweise gefühlt, als wäre ich an einem Making of-Set von „Harry Potter“. Alles war absolut irre und riesengroß!
»Ich hoffe sehr, dass alle Menschen, die in diesem Geschäft in irgendeiner Weise tätig sind, nun mit einem neuen Empfinden durch die Welt gehen und auch offener sind, die Dinge anzusprechen, wenn sie nicht so laufen, wie sie laufen sollten.«
Jonas:
Nun ist es gerade Hollywood, aus dem in den letzten Monaten eher negative als positive Schlagzeilen zu lesen waren…
Jannik:
… wegen der #metoo-Debatte.
Jonas:
Genau. Glaubst du, dass diese Enthüllungen das Business nachhaltig verändern?
Jannik:
Ich glaube leider nicht, dass das der Fall sein wird. Auch wenn viele Frauen den Mut gefunden haben, mit ihren Anschuldigungen an die Öffentlichkeit zu treten, sind diese beschämenden Missbrauchsfälle letztendlich nichts, was die große Mehrheit verblüfft hat. Dennoch hoffe ich sehr, dass alle Menschen, die in diesem Geschäft in irgendeiner Weise tätig sind, nun mit einem neuen Empfinden durch die Welt gehen und auch offener sind, die Dinge anzusprechen, wenn sie nicht so laufen, wie sie laufen sollten.
Jonas:
Unser letztes Interview haben wir vor über vier Jahren in New York geführt. In diesen vier Jahren ist neben der #metoo-Bewegung noch viel mehr passiert, was es gesellschaftspolitisch in sich hatte – und immer noch hat. Wie hast du ganz persönlich die Zeit seit unserem letzten Treffen erlebt? Was hat sich in deinem Leben verändert?
Jannik:
Die letzten Jahre sind total schnell verflogen – und nicht nur die letzten vier: Es ist jetzt schon sieben Jahren her, dass ich nach Berlin gekommen bin. Wenn man diese Zahl auf ein Blatt Papier schreibt, sieht es nach einer wahnsinnig langen Zeit aus. Aber meine sieben Jahre fühlen sich einfach nicht wie sieben Jahre an. Dafür ist beruflich und privat zu viel passiert, es gab zu viele Aufs und Abs. Dennoch frage mich, was ich sieben Jahre lang gemacht habe. Klar, ich habe immer wieder gedreht. Aber was habe ich dazwischen gemacht?
Vor wenigen Monaten erst habe ich angefangen zu studieren. Diese Idee hatte ich zwar schon vorher, aber ich frage mich, warum es ganze sieben Jahre gedauert hat, bis ich wirklich den Entschluss gefasst habe, aktiv ein Studium anzufangen. Zwar habe ich zwischendurch mal kurz versucht, über eine Fernuni zu studieren, aber ich habe schnell gemerkt, dass das ein System ist, das mir nicht besonders liegt. Ich brauche einfach einen Ort, an dem ich physisch anwesend sein kann und echte Leute kennenlernen kann.
Vor allem was mein Privatleben angeht, hat sich in den letzten Jahren recht viel verändert. Um mich herum hat sich ein großer und vertrauter Freundeskreis aufgebaut, der sich mittlerweile total gesetzt hat. Das ist ein sehr schönes Gefühl. Für mich ist mein Privatleben das A und O, denn es lässt mich zur Ruhe kommen und abschalten. Ich habe mittlerweile das Gefühl, in meinem Leben wirklich tolle Freunde und die perfekte Zahl an engen Vertrauten zu haben. Das bringt mir ein großes Maß an Stabilität – und ich bin dadurch sehr ausgeglichen, vielleicht heute noch etwas mehr als vor vier Jahren.
Jonas:
Dabei hast du beruflich seit 2013 ein enormes Pensum absolviert und sehr viel gedreht – unter anderem hast du in der Romanverfilmung „Die Mitte der Welt“ eine der Hauptrollen übernommen. Nach der Premiere im Herbst 2016 hat der Film national wie international etliche Preise eingesammelt. Welches Résumé ziehst du heute, wenn du mit dem Abstand von über einem Jahr auf den Film zurückblickst?
Jannik:
Dass „Die Mitte der Welt“ weltweit alle möglichen Preise gewinnt, ist wunderbar und freut mich sehr – denn dieser Film ist eine der größten Perlen meiner Vita. Ich bin wahnsinnig stolz, bei diesem Projekt dabei gewesen zu sein – alleine deshalb, weil ich den Streifen filmisch so toll finde. Ich glaube, wenn ich diesen Film nur privat im Kino gesehen hätte, hätte ich ihn ebenfalls sehr gemocht. Das liegt an so vielen Dingen: etwa an der Art, wie Jakob M. Erwa das Drehbuch geschrieben hat. Oder an der tollen Kameraführung von Ngo The Chau. Oder an dem außergewöhnlichen Schnitt und der total modernen Montage von Carlotta Kittel. Und davon abgesehen ist „Die Mitte der Welt“ einfach eine wahnsinnig schöne Liebesgeschichte.
»Ich würde zwar ebenfalls von mir behaupten, dass ich ein Mindestmaß an Selbstbewusstsein habe, aber der Charakter von Nicholas übersteigt das um ein Vielfaches.«
Jonas:
Im Gegensatz zu deinen Rollen in „Jugend ohne Gott“ und „The Aftermath“ ist Nicholas – der Charakter, den du in „Die Mitte der Welt“ spielst – weder ein Mörder noch ein Werwolf, sondern ein ganz normaler Jugendlicher, der lediglich dadurch auffällt, dass er sich seinen Mitmenschen gegenüber unsozial verhält. Braucht es für eine Rolle wie Nicholas weniger schauspielerischen Aufwand?
Jannik:
Tatsächlich habe ich in meinem Leben Rollen gespielt, die viel weiter von meiner eigenen Persönlichkeit entfernt sind als diese. Nicholas ist kein Mensch, der besonders böse ist – dafür ist er aber wahnsinnig selbstbewusst und weiß ganz genau, wie er die Leute rumkriegt. Und hier liegt auch der größte Unterschied zu mir selbst: Ich würde zwar ebenfalls von mir behaupten, dass ich ein Mindestmaß an Selbstbewusstsein habe, aber der Charakter von Nicholas übersteigt das um ein Vielfaches. Dementsprechend musste ich mich auf meine Rolle in „Die Mitte der Welt“ genauso vorbereiten wie auf jede andere.
Jonas:
Neben diversen Kino- und Fernsehfilmen gibt es seit 2015 eine weitere, riesgengroße Bühne, die du bespielst: Instagram. Als wir uns vor gut vier Jahren zu unserem letzten Interview getroffen hatten, warst du auf Instagram noch nicht aktiv. Welche Bedeutung haben Soziale Netzwerke heute für dich und deinen Beruf?
Jannik:
Ich habe mich sehr lange dagegen gesperrt – und das hatte auch einen guten Grund. Ich dachte mir immer: Wen interessiert’s, wenn ich auf Instagram oder Facebook ein Foto poste? Mittlerweile weiß ich zwar, dass es genügend Leute gibt, die das interessiert. Aber das ändert nichts daran, dass es mir wahnsinnig schwerfällt, dort die Balance zu finden zwischen einerseits dem Anspruch, als ernstzunehmender Schauspieler wahrgenommen zu werden, und andererseits dem, was man als – ich hasse das Wort – Influencer bezeichnen würde.
Heutzutage ist es einfach so, dass es in bestimmten Kreisen immer wichtiger wird, viele Follower zu haben. Das kann auch ich nicht ignorieren. Ich habe mich daher ausführlich mit dem Ganzen beschäftigt und für mich akzeptiert, dass ich in den Sozialen Netzwerken irgendwie stattfinden muss. Und nach gut zwei Jahren Instagram stelle ich fest, dass die Leute es scheinbar wahnsinnig spannend finden, einen klitzekleinen Einblick in mein Privatleben zu erhalten. Alleine durch diesen kleinen Einblick kann ich viele Follower glücklich machen.
»Die Genugtuung, mich auf bestimmte Kommentare einzulassen, gebe ich den entsprechenden Usern nicht.«
Jonas:
Wenn man sich die Kommentare auf deinem Instagram-Account genauer anschaut, liest man Einiges, was weit über die reguläre Fan-Liebe hinausgeht und stellenweise richtig unangenehm wirkt. Wie gehst du damit um, wenn man dir im digitalen Raum zu nahetritt?
Jannik:
Ich bin ganz ehrlich: In meinen ersten Monaten auf Instagram hatte ich keine Ahnung, wie ich damit umgehen sollte. Anfangs habe ich derartige Kommentare noch selbst kommentiert, später habe ich sie nur noch gelöscht. Aber irgendwann kommt man mit dem Löschen nicht mehr hinterher. Also habe ich wieder damit aufgehört und beschlossen, dass ich von jetzt an einfach akzeptieren werde, dass so etwas passiert, auch wenn ich es nicht gut finde. Die Genugtuung, mich auf bestimmte Kommentare einzulassen, gebe ich den entsprechenden Usern jedenfalls nicht. Sonst würden vielleicht noch mehr von ihnen darauf anspringen.
Insgesamt überwiegt auf meinem Instagram-Account aber das positive Feedback – und zwar deutlich. Dafür bin ich wirklich dankbar. Ich finde es toll, dass ich dort von meinen Fans direkt mitbekommen kann, was sie an einem Film mögen. Außerdem gibt es immer wieder Nachrichten, von denen ich total gerührt bin: Als etwa „Die Mitte der Welt“ in den Kinos anlief, haben mir Menschen aus der ganzen Welt geschrieben, wie sehr ihnen der Film in ihrer persönlichen Lebenssituation geholfen hat und wie dankbar sie dafür sind. Das hat mich nicht nur riesig gefreut, sondern mir auch sehr viel Kraft gegeben.
Jonas:
Etwas, was du im Jahr 2013 ebenfalls noch nicht hattest, war ein Netflix-Account – der Streamingdienst kam erst 2014 nach Deutschland. Wie bewertest du das, was sich da in den letzten Jahren parallel zum linearen Fernsehen – und auch zum Kino – entwickelt hat?
Jannik:
Netflix ist in meinem Leben fest verankert und nicht mehr wegzudenken. Das Fantastische daran ist, dass man als Konsument die Möglichkeit hat, Serien aus der ganzen Welt zu schauen, die man sonst nie sehen würde – vor allem nicht im linearen deutschen Fernsehen.
Ich würde sagen, dass Netflix, Amazon und andere Plattformen in nur wenigen Jahren die Serienlandschaft in ganz Deutschland total verändert haben. Gerade jetzt erleben wir, wie hier in Deutschland immer mehr Serien und Filme gedreht werden, die sich sehr an den amerikanischen Netflix-Formaten orientieren. Ich denke da etwa an „Dark“: Diese Serie gibt uns etwas, was wir in Deutschland immer wollten: einen neuen Look und neue Erzählstrukturen. „Jugend ohne Gott“ ist da ebenfalls ein super Beispiel. Der Film hat ebenfalls keinen deutschen Look und sieht in Bezug auf seine Bildgewalt sehr amerikanisch aus.
Jonas:
Und ein wenig skandinavisch.
Jannik:
Nein, dafür hat der Film zu viel Glanz. Skandinavische Filme sind ausschließlich rau und düster – aber das ist natürlich auch ziemlich geil! Davon abgesehen gibt es in „Jugend ohne Gott“ auch keine lineare Erzählstruktur, das ist für einen deutschen Kinofilm absolut untypisch.
Meiner Meinung nach ist diese neue Netflix-Serienwelt auch dafür verantwortlich, dass man in den letzten Jahren immer mehr verschiedene Erzählstrukturen kennengelernt hat und mittlerweile auch geübt darin ist, so etwas zu schauen. Und das meine ich wörtlich: Das muss sich das Augen antrainieren. Daher hätte wahrscheinlich „Jugend ohne Gott“ mit seiner modernen Erzählstruktur vor zehn Jahren gar nicht funktioniert.
Jonas:
Hast du eine Lieblingsserie?
Jannik:
Meine absolute Top-Serie ist „Stranger Things“ – wie für so viele von uns. Ich finde die Charaktere einfach großartig, vor allem die Kids. Danach kommen in meiner Liste direkt „Fargo“ und „The Crown“.
Jonas:
Es ist interessant, wie schnell sich scheinbar das Seh- und Mediennutzungsverhalten einer ganzen Bevölkerung verändern kann. Ist diese Dynamik in der der Film- und Fernsehlandschaft einer der Gründe, warum du angefangen hast, Medienwissenschaften zu studieren?
Jannik:
Mein ursprünglicher Plan war, Englische Literatur und Anglistik zu studieren. Schon in der Schule war Englisch mein Lieblingsfach – vor allem das Shakespeare-Semester hatte es mir total angetan, weil ich diese Sprache so wundervoll finde.
Dann ist Folgendes passiert: Seit zehn Jahren bin ich Synchronsprecher bei „Drei Fragezeichen Kids“, wo ich die Stimme von Justus Jonas spreche. Als ich vor einigen Monaten wieder mal im Studio saß, habe ich mich mit meinem Kollegen David Wittmann – die Stimme von Bob Andrews – darüber unterhalten, dass ich Englische Literatur und Anglistik studieren will. Die Idee, ein Studium anzufangen, fand er irgendwie auch gut und entschied sich spontan, sich ebenfalls für diesen Studiengang einzuschreiben. Daraufhin haben wir die Abmachung getroffen, dass er sich nun ein zweites Fach aussuchen darf, dass wir gemeinsam belegen. David hat sich für Medienwissenschaften entschieden, also wurde es das. Und jetzt, da mein erstes Semester an der Uni so gut wie vorbei ist, muss ich zugeben, dass ich das Fach Medienwissenschaften sehr viel spannender finde als Englische Literatur.
»Das Studium gibt mir eine Routine und Tagesordnung, die ich in dieser Stringenz in meinem Leben als Schauspieler nicht habe.«
Jonas:
Du drehst und arbeitest sehr viel. Warum wolltest du neben deinem Vollzeitjob noch ein Studium beginnen?
Jannik:
Ja, ich arbeite sehr viel, aber es gibt auch sehr viele Tage im Jahr, an denen ich nicht arbeite. Und an diesen Tagen tut es wahnsinnig gut, seinen Kopf mit anderen Dingen zu füllen als mit Film. Darüber hinaus gibt mir das Studium eine Routine und Tagesordnung, die ich in dieser Stringenz in meinem Leben als Schauspieler nicht habe. Etwas Besseres hätte mir gerade nicht passieren können.
Jonas:
Angenommen, wir treffen uns in vier Jahren wieder zu einem Interview. Was ist in dieser Zeit idealerweise in deinem Leben passiert?
Jannik:
Was ich bis dahin schauspielerisch erreicht haben will, weiß ich gar nicht so genau. Ich könnte jetzt eine langweilige Standardantwort geben wie „Ich wünsche mir die verschiedensten Rollen, in denen ich mich austoben kann“. Aber das tue ich ja schon. Idealerweise habe ich in vier Jahren einen Bachelor in der Tasche. Und idealerweise bin ich in vier Jahren von den gleichen tollen Menschen umgeben, die mich jetzt auch umgeben. Mehr braucht es gar nicht.
Jannik Schümann online:
jannikschuemann.com
facebook.com/schuemannjannik
instagram.com/jannik.schuemann
Fotos: Maximilian König
Produktionsassistenz: Christopher Müller
Young Fathers
Interview — Young Fathers
A Constant Tug Of War
Already known for their experimental sound, Young Fathers have once more managed to create something unique with their new LP »Cocoa Sugar«. Three albums in, they still don't submit to any norms, even after having tried really hard to be nothing but just normal.
8. März 2018 — MYP N° 22 »Resistance« — Interview & Text: Christina Heckmann, Photography: Moritz Jekat
Back in 2014 Young Fathers came into the limelight with their Mercury Prize win for their debut album “Dead”, while their follow up “White Men Are Black Men Too” established them as an unconventional band with mass appeal. Big markers on their journey are the many collaborations with Massive Attack, being heavily featured on the “T2: Trainspotting” soundtrack and touring around the world for years.
Once the traveling stopped for a while, Kayus Bankole, Graham ‘G’ Hastings and Alloysious Massaquoi settled back into their hometown Edinburgh to put their experiences into music. The outcome is called “Cocoa Sugar” and it surprises with every song and its distorted sounds. Consisting of tracks that are catchy enough to be liked at the first listening, they then get hold of you even more once you dive in deeper: There is no getting out. Merging all musical influences that are out there, making it impossible to pinpoint: From rock, pop, hip-hop, afrobeat, grime, experimental hip-hop, traditional pop, world music, you name it, it’s in there, it’s in them.
Resisting against being labeled seems to come naturally to Young Fathers, an organic development to subvert expectations with every move. Open to addressing sensitive issues related to race, the music industry, politics, religion, Young Fathers don’t shy away from showing critical attitudes. One might imagine three aggressive guys on a mission, but even though they are constantly taking people out of their comfort zones, they are at the same time turning it into a good experience.
After all, they just want to have a good time while staying true to themselves and who they are: Three guys from Edinburgh just making some music. May as well bring the power to talk about social and political issues back into pop music along the way.
Christina:
When I heard about MYP’s current topic being “Resistance”, I immediately felt Young Fathers were perfect for this. You are opposing forces in the music industry while managing to reach masses by making pop music after all. You are creating unique sounds that are still accessible. With your new album, you have done that again. I recall with “White Men Are Black Men Too”, your last album, you specifically went out there and tried to make a pop album. How did it go this time?
Alloysious:
That was our first attempt at applying pop sensibility and staying true to ourselves, with “White Men Are Black Men Too”. Having a marriage of those two. During that time, we were on the road a lot and would listen to stuff on the radio. There was a sense of songs being driven, and we liked that, we tried to apply that to the record. This time I feel like we succeeded in whatever notion that we had initially. This time we were just more self-aware about things, how the industry works, how we are as people, individually and as a group, what our strength and weaknesses are. In this whole creative sphere, weaknesses become strengths. In a way, this is a foolproof recipe, you can always take something away from any situation and turn it into something else. We love to subvert, and it was a continuation of that process from the previous works in combination with the newfound confidence.
»You know what's right from the get-go. It's all within you.«
Christina:
Did you find any new approaches for this album?
Alloysious:
This time around we had a lot more time at home in Edinburgh, seeing friends and family, just being regular people, just enjoying the mundane stuff. That was the balance that was needed after a period of touring for like five, six years. You get that injection of reality, it adds and feeds to grow something inside of you. You get to the point where you are ready to go back in and do a new record. In general, you always have an idea about things and then we create triggers, words, phrases, films, pictures, conversations, all these stories in the back of your mind or written down in your phone. Gather it, gather it, experience, gather it, and then, when we go into the studio we don’t talk about it, it just comes through. You know what’s right from the get-go. It’s all within you. You do it, you release it, you walk away from it, proud and happy about having been able to let it out. The process after that is being able to talk about it and understand it in hindsight, looking at it from different perspectives.
Christina:
You got a lot of recognition from the music industry, which, I imagine, certainly gives you confidence going into the recording stage. At the very least for the fact that you know the album will be heard because people will be eager to check it out. Compared to the early beginnings of any newcomer, you don’t have to fight to get listeners anymore.
G:
True, you start to appreciate that more.
Kayus:
I think the fight never ends though, to be honest. I doubt that we all feel complacent about a couple of ears. It’s just a new stage that we’re at, where we have more ears than we did before, especially compared to when we did the Tapes. (Editor’s note: EPs “Tape One” and “Tape Two”)
G:
At this point, we have built up a fan base of a bunch of people that love you for whatever you are and that’s great. We are very aware though that to stay relevant and to be able to be here and do interviews, you have to make an effort. It is always a struggle to try and get more people involved. There is so much music out there that is great but hardly gets heard. So, the fight never stops, to be able to keep doing that.
Christina:
Do you feel pressure to create something that the industry will consider worth spreading?
G:
Not at all for the industry, but more for ourselves. We got bored after touring for so many years and generally, we always get bored with what we have done before. That’s where you get the pressure to do something new, to create something new. And we had time to go home, time to reevaluate everything. The new album was meant to be more linear, more normal because we had not done that before. The title “Cocoa Sugar” is a play on something bittersweet, because we were trying to question this concept of us being strange. When we came up with our plans for the album, we thought we just wanted it to be normal. Especially because our perception as a band is always so fucking strange, we can never fucking be normal. No matter how hard we’d try. But in a way, it also doesn’t even mean anything.
»I like everything to be a glorious fucking free fall.«
Kayus:
That was a fucking challenge for me personally. That’s the bitter part of it. Bursting out of the tour bubble. There is always this abundance of ideas when you’re on tour. And, when you come back, there is so much excitement of going into the recording process again, you want to put it all out there. But then you have to be strict on yourself. Eliminate all the shape. All the fluff. All that is unnecessary within it. And I don’t like that. I like everything to be a glorious fucking free fall.
Christina:
People always struggle to define you and your music. Do you find it difficult to stay in the realm of indefinability and do you intentionally try to resist against being labeled?
Alloysious:
No, it’s honestly not very hard for us. That’s just the way we are.
Kayus:
A bunch of mad cunts.
(Everyone laughs)
G:
Like we noticed when working on this album, it is actually harder for us to be a straight-in-the-line band and be normal.
»We naturally have that filter within, that when we come across something that has been done before, we want to go against it.«
Alloysious:
We naturally have that filter within, that when we come across something that has been done before, we want to go against it.
G:
Why the fuck would we want to do something that has already been done before? We push against that.
Kayus:
That’s the resistance part.
Alloysious:
Also, there is a lot of resistance when you have created something as a band and two members like it, but I, for example, don’t. I then have to find a new approach to it and see it from their perspective and go against my initial feeling.
G:
It’s not resistance though, that’s us being contrary in nature.
Kayus:
It is resistance, man!
G:
But resistance sound so negative, it is actually too enjoyable to call it resistance.
Kayus:
True, there is so much excitement in this process. Maybe we’re just excitement junkies and constantly want to explore that feeling. It’s like a constant tug of war.
Alloysious:
Whatever, I think it’s resistance. (Everyone laughs) Let’s just go against the connotation of what it is. There is this push and pull factor, even just within our relationships. Agreeing, disagreeing, compromising. Resistance. And also, acceptance.
Kayus:
That is all there, but it is just another aspect of it all.
G:
The way our songs come together is in a very forward moving way, our energy is going that direction.
Christina:
You said you consider yourself a political band.
Alloysious:
Did we really say that?
G:
Yeah, we did. Sometimes we would consider ourselves a political band, some days we personally differ. We also don’t really have a choice in this, as we do not get to define ourselves. We just are as a band who we are as people and as soon as you are moving within the industry you get put on sides.
Alloysious:
You say no to one thing and then everybody considers it a political stance.
Christina:
Just as it happened with the BDS issue. You withdrew from last year’s “Pop-Kultur Berlin” to protest the festival’s acceptance of sponsorship from the Israeli embassy.
G:
I think people look at us thinking about these things in a certain way, but our approach is actually quite pure. We’re just people and when something doesn’t feel right, you decide not to do it.
Christina:
Again, do you feel people are trying to put a label on you?
G:
It’s in people’s nature to try and simplify things. The reason why we’re a bit uneasy this political frame is that we don’t want to have an aggressive take on it. We’re not overtly political, but of course, we try to make people think about things. The smartest way to include people is by showing them how we feel in the form of a pop song. They might sing along and think about the words.
»We are very aware that whatever we do as a pop band, in the grand scheme of things is still a very minute thing.«
Christina:
If it doesn’t solve the problem, it opens a public discussion about it and raises awareness at the very least.
G:
Yes, you try to get people to understand things themselves. We are very aware that whatever we do as a pop band, in the grand scheme of things is still a very minute thing.
Christina:
Even if it is small in the scheme of things, it does give you a certain kind of power though.
G:
Of course, it does. It’s a little tiny increment, but of course, it is still worth it.
Kayus:
Generally, the topics we deal with are topics that we want to talk about, the things that interest us. On this album, there is a lot of character imagination going on. We tried to imagine to our best abilities what some evil bastard thinks like. We tried to imagine what it feels like to be trampled on. We’re not waving the finger at people and say what is bad and what is good, we are just presenting it and bring it to the forefront so that people can decide for themselves.
Alloysious:
We are saying: Think about it and let’s have that conversation. We want to engage in them. No matter how difficult they are. Worth mentioning though, in discussions sometimes our answer is also that we just don’t know.
»As an artist, you're always on a pedestal. Sometimes I just want to be able to say: I don't know. I don't have the answer.«
Christina:
That should be totally acceptable as well.
Alloysious:
Because as an artist you’re always expected to have all the answers and opinions. You are always on a pedestal. Sometimes I just want to be able to say: I don’t know. I don’t have the answer.
Kayus:
Yes, sometimes we don’t want to talk about things. Sometimes we just want to dance.
More about Young Fathers:
young-fathers.com
facebook.com/youngfathers
instagram.com/young_fathers
More about photo artist Moritz Jekat:
moritzjekat.de
facebook.com/moritzjekat
instagram.com/moritzjekat