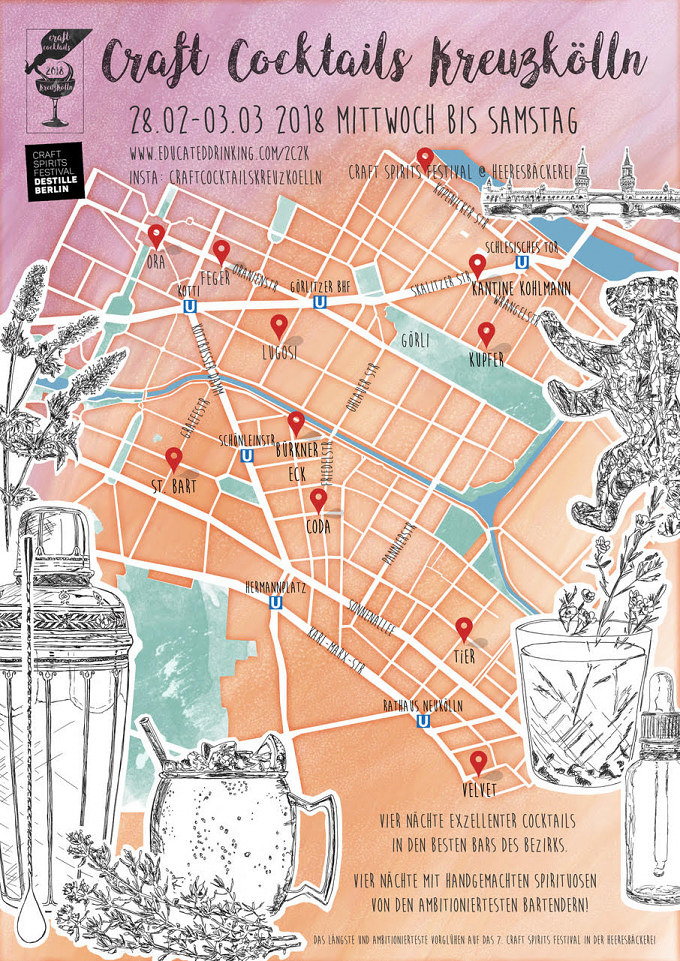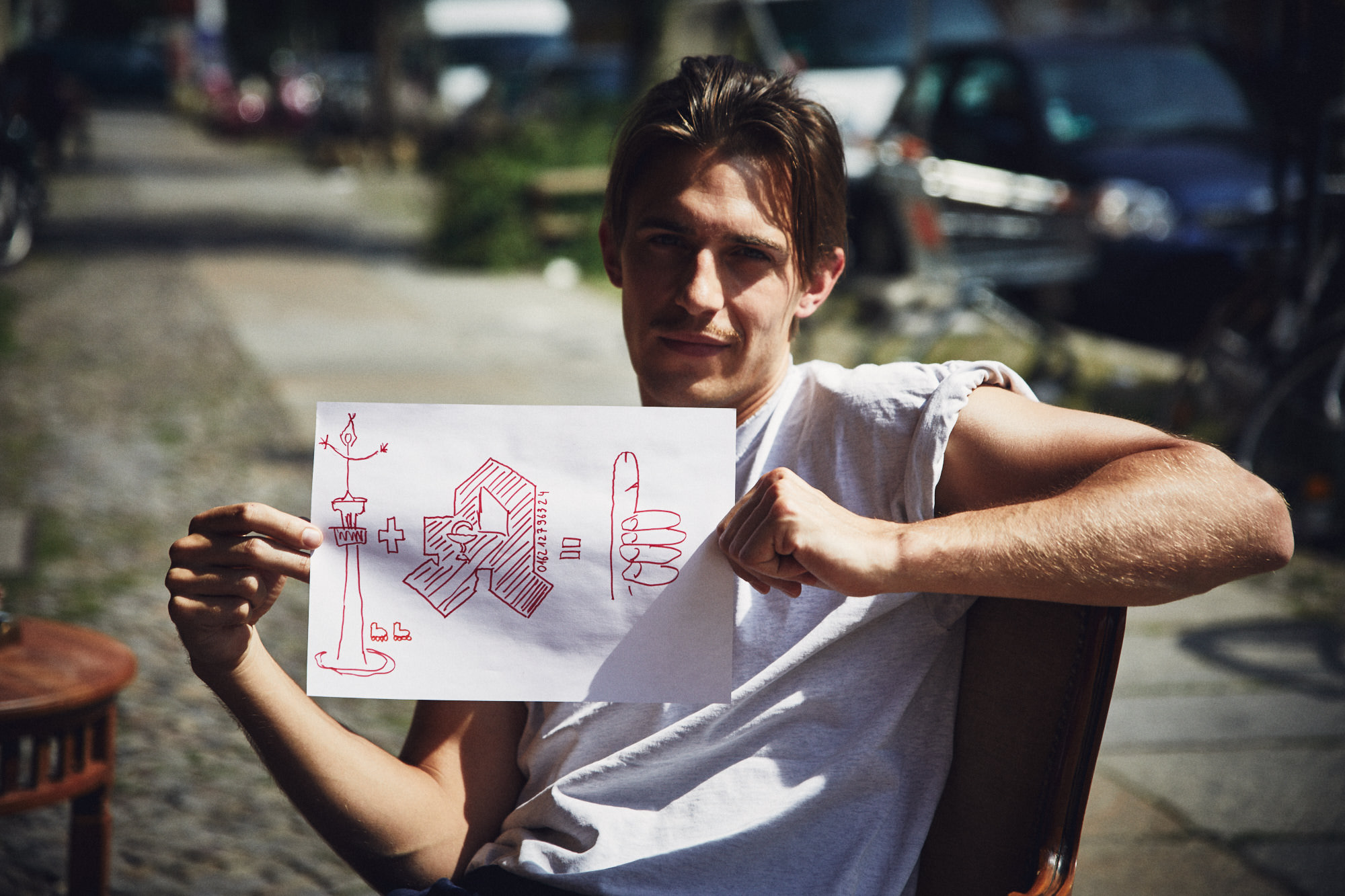Fye & Fennek
Interview — Fye & Fennek
Von Licht und Finsternis
Mit Fye & Fennek auf Großstadtsafari: In der Berliner Kneipe „Dschungel“ haben wir mit der Band über ihr neues Album „Separate Together“ gesprochen – und erfahren, dass es immer einen prägenden Moment braucht, um einen guten Song entstehen zu lassen.
2. Oktober 2018 — MYP N° 23 »Instinkt« — Interview: Katharina Weiß, Fotos: Ansgar Schwarz
Wer aus der grellen Helligkeit des Tages in das Dickicht des Urwalds tritt, ist erst mal blind. Doch wessen Augen sich an die Schummrigkeit gewöhnt haben, der erkennt zwei exotische Wesen, die sich im Unterholz zu eleganten Verrenkungen zusammengerollt haben: Ihre blauen Augen funkeln neugierig, und wer ihre Klänge vernimmt, der hört kein Brüllen oder Zischen, sondern das atmosphärische Klingen sphärischer Purität.
Was das Poetenherz so romantisch zu verpacken weiß, hat einen Anker in der Pragmatik: Im Dschungel, einer ehrlichen Berliner Kneipe mit tropischer Deko, treffen wir Fye & Fennek, die gerade ihr erstes Studioalbum „Separate Together“ veröffentlicht haben. Die Neuköllner Bar bietet hochqualitative Cocktails ohne Schnickschnack zu einem Preis, der stets dazu einlädt, noch ein bisschen länger zu bleiben.
So natürlich und sympathisch wie die Location sind auch die beiden Musiker. Während Fye (30) mittlerweile in Berlin wohnt, ist Fennek (27) extra aus Kassel angereist, wo er mit seiner kleinen Tochter lebt. Die unzähligen Musikinstrumente, mit denen sie ihre Songs einspielen, haben die beiden dieses Mal zuhause gelassen. Dafür bringen sie gute Laune und Trinkfestigkeit mit – und das ist bei einem Treffen mit Journalisten bekanntermaßen nie verkehrt…
Katharina:
Ihr seid weder verwandt noch verliebt, sondern habt beruflich zueinander gefunden. Fye, wie hast du Fennek kennengelernt?
Fye:
Ich kannte seinen Mitbewohner! Der hat mich zu seiner WG-Party eingeladen, dort haben wir Musik gemacht. Da war Fennek auf einmal im Raum. Wir haben zuerst über Songs geredet und danach ordentlich einen weggetrunken.
Fennek:
Ich hatte davor schon ein Soloalbum und eine Platte mit einer anderen Künstlerin produziert – aber beide wollte ich dann doch nicht veröffentlichen. Die Arbeit vor unserer Begegnung war mein Boot Camp. Ich musste wissen, was ich machen kann und wer ich bin. Und dann kam Fye und innerhalb einer Nacht haben wir beschlossen, am nächsten Tag einen Song aufzunehmen, den wir einen Monat später veröffentlicht haben.
»Ich empfinde es eher als Erleichterung, dass meine Familie beruflich nichts mit Musik am Hut hat.«
Katharina:
Habt ihr musikalische Eltern, oder woher kommt die kreative Ader?
Fennek:
Meine Eltern haben eine spannende Geschichte: Sie sind als Flüchtlinge aus Polen gekommen. Dort war meine Mutter Schauspielerin und mein Vater Rennfahrer. Die Zeiten waren nicht so gut…
Katharina:
…du sprichst vom Eisernen Vorgang?
Fennek:
Genau. Mein Großvater sagte zu meinem Vater: „Mit diesen Jobs verdient ihr kein Geld.“ Deshalb haben die beiden dann Medizin studiert. Und danach sind sie mit dem Trabbi über Schlesien nach Saarbrücken geflohen, mit tausend Złoty in der Tasche. Tja, und so haben sie sich hier ein Leben aufgebaut und fünf Kinder großgezogen. Die beiden haben eigentlich ihre künstlerische Freiheit für uns aufgegeben, um uns ein besseres Leben zu ermöglichen. Meine Schwester zum Beispiel hat Geige gespielt, und ich durfte unter anderem Klavier und Schlagzeug lernen. Doch als ich älter wurde kam die Frage: „Hast du dir schon ein Berufsfeld ausgesucht?“ Und ich dachte mir: Fuck, wie erkläre ich ihnen, dass ich weiterhin Musik machen möchte? Dafür musste ich mich schon rechtfertigen.
Fye:
Meine beiden Eltern sind Lehrer – aber nicht für Musik. Ich habe es vielleicht von meiner Oma. Sie war die Einzige, die wirklich musikalisch war und sich autodidaktisch jede Menge Instrumente beigebracht hat. Ansonsten empfinde ich es eher als Erleichterung, dass meine Familie beruflich nichts mit Musik am Hut hat. Ich wurde nicht in ein Feld gesetzt, sondern kann mich ganz frei bewegen. So bin ich der kleine Exot und das ist auch ganz positiv.
Katharina:
Wo in Berlin entstehen eigentlich eure Songs?
Fennek:
Wir haben Ewigkeiten kein passendes Studio gefunden. Am Ende war das Label so frei und hat uns ihre Raucherkammer angeboten. Das ist ein kleiner, schöner Ort in Mitte – genau richtig für uns. Ich penne dort auch meistens, wenn ich in Berlin arbeite.
Katharina:
Hat dir Fye keine Couch angeboten?
Fennek:
Doch, doch! Aber wenn wir den ganzen Tag zusammen spielen und ich noch an ihrem Gesang herumproduziere…
Fye: (lacht)
…dann kann er meine Stimme irgendwann nicht mehr hören.
»Ein Song kommt immer aus einem gewissen Moment, von dem er getragen wird.«
Katharina:
Dass ihr euch erst später im Leben getroffen habt, als ihr beide schon eine Geschichte hattet, merkt man an der Vielseitigkeit eurer Songs. Was habt ihr euch bei der Zusammenstellung des Albums gedacht?
Fye:
Das Album ist unser beider Sprachrohr und wir haben einen gemeinsamen Klang gefunden. Ansonsten wollten wir einfach frei damit sein und kein Konzeptalbum machen, sondern viele verschiedene Elemente mitnehmen. Jedes Lied hat sein Eigenleben.
Fennek:
Bei uns geht das wahnsinnig schnell. Wir machen einfach und probieren uns aus. Wir schreiben einen Song, manchmal in ein paar Stunden – und lassen ihn dann nicht ewig rumliegen, sondern produzieren ihn zügig fertig. Ein Song kommt immer aus einem gewissen Moment, von dem er getragen wird: ein Gefühl oder ein prägendes Ereignis, ein Highlight oder ein Absturz.
Katharina:
Wenn so viele Emotionen in Songs fließen, dann muss man sich ganz schön nackt voreinander machen. Ist das manchmal komisch? Vor allem für dich, Fye, weil du größtenteils die Texte schreibst?
Fye:
Da war nur eine kurze Phase des Kennenlernens – danach gab es keine Tabus mehr.
Fennek:
Ein bisschen wie Bruder und Schwester. Fye konnte mir erzählen, wenn irgendein Typ wieder Scheiße gebaut hat – dann habe ich mir den vorgeknöpft.
Fye:
Als ich nach so einem Liebeskummer mal mit Fennek im Studio war, kam eine Freundin dazu und meinte: „Mensch, Fye! Du bist halt auch so eine, die das Drama braucht. Denn danach kannst du einen Song schreiben, der richtig geil wird. Du bist einfach nicht der Typ, der fünf Jahre in einer Beziehung steckt, und nie passiert irgendwas Spannendes.“
Fennek:
Du brauchst auf jeden Fall die Reibung. Du bist wie ein Schloss, in dem überall kleine Türchen sind, hinter die man nochmal schauen kann…
Katharina:
Ein Adventskalender der Erotik.
Fye: (alle lachen)
Geile Metapher.
Katharina:
Und wie ist das bei dir Fennek, wann wirst du am kreativsten?
Fennek:
Viele Songs entstehen auf dem Weg von Berlin nach Kassel – oder umgekehrt. Ich nehme Gefühle mit und versuche sie auf der Reise in Melodien zu verwandeln. Das klingt abstrakt, für mich ist es aber sehr greifbar. Ich singe bewusst nicht mehr so viel, weil mittlerweile die Töne meine Worte sind. Und wenn Fye dann über meinen Song jammt und einen Text findet, spricht sie mir total aus der Seele. Wir sind musikalisch eins geworden.
»Jeder von uns hat Licht und Dunkelheit in sich.«
Katharina:
Welche Motive beschäftigen euch besonders?
Fye:
Licht und Dunkelheit – jeder von uns hat beides in sich. Ein Kontrast muss da sein. Auch schlechte Sachen haben meistens einen guten Aspekt. Im Lied „Dark Lights“ geht es zum Beispiel um meine Anziehung zu dem Dunklen. Wenn man weiß: „Der Typ, der tut mir gar nicht gut, aber ich renne ihm trotzdem hinterher.“ Und dadurch lernt man. Man wird mit der Zeit nicht mehr beschädigt, sondern stärker.
Fennek:
Traut euch, Mut zu fassen! Wenn man jung ist, hat man so viele Träume und Ziele. Viele schmeißen ihr Talent aber weg und verlieren sich. Dabei kann man all die großartigen Dinge nur einmal machen, wenn man das ewig verschiebt, ist es schade.
Fye:
Wir sind mit diesen Herausforderungen zwar auf uns alleine gestellt – aber die Tatsache, dass wir alle mit gewissen Herausforderungen zu kämpfen haben, haben wir gemeinsam. Deshalb heißt das Album auch „Separate Together“.
Katharina:
Was sind eure Herausforderungen?
Fye:
Momentan ist es noch ein steiniger Weg, finanziell mit der Musik über die Runden zu kommen. Manche Leute denken, das ist ein geiles Hobby für uns. Ne! Wir sind Vollblutmusiker und machen das im zeitlichen Umfang eines Vollzeitjobs. Und wir glauben daran, dass es Menschen gibt, die feiern werden, was wir für Lieder schreiben.
»Es gibt wenige Talente, die es schaffen, mit 20 gute Songs zu schreiben.«
Katharina:
Wer in die deutschsprachigen Charts schaut, sieht jede Menge Leute, die sich—noch als Minderjährige—riesige Follower-Schwärme über YouTube oder Instagram aufgebaut haben. Die sind zehn Jahre jünger als ihr. Habt ihr manchmal das Gefühl, dass euch die Zeit davonrennt?
Fye:
Gar nicht. Ich mache schon lange Musik und habe schon als Teenie eigene Songs geschrieben. Aber aus heutiger Perspektive weiß ich: Mit 20 habe ich andere Sachen erzählt, vieles wusste ich noch nicht. Ich brauchte die Zeit. Es gibt wenige Talente, die es schaffen, mit 20 gute Songs zu schreiben. Oft stehen da erfahrene Songwriter dahinter.
Katharina:
Eigentlich ein spannender Punkt: dass die allermeisten jungen Popstars zwar den Körper von Teenagern haben, aber mit der Weisheit viel älterer Menschen singen, die ihnen ihre Geschichten sozusagen „ausgeliehen“ haben.
Fennek:
Totale Körperwirtschaft. Es ist ja auch geil für die Leute, da ein junges Mädel mit Knackarsch zu sehen und den Eindruck zu gewinnen: „Wow, die ist ja so reif! Oh mein Gott, die hat ja schon so viel durch.“ Da springt die ganze Industrie auf. Ich finde das durchaus auch bewundernswert, so funktioniert die Branche eben. Aber es gibt auch immer wieder andere Talente, die sich trotz dieser Vorherrschaft durchsetzen können.
Katharina:
Fennek, welche Abgründe faszinieren dich am meisten?
Fennek:
Extreme! Zum Beispiel in der Feierszene. Wenn ich mal rausgehe, begegnen mir in Berliner Clubs Menschen, die Dinge sagen wie: „Ich bin seit acht Tagen da, was ist mit dir?“ Ich dann zwar erst seit acht Minuten – aber ich feiere das total: in richtige Dark Clubs zu gehen, um in dieser Leere zu sich selbst zu kommen.
Fye:
Ich bin ständig auf Achse und total schlecht darin, nichts zu machen. Ich mag eher lichtdurchflutete Festivals als dunkle Clubs. Für mich ist es außerdem schon mal ein Erfolg, nicht planen zu müssen. Wenn ich immer fünf Tage beim Feiern versacken würde, dann hätte ich schon längst meinen Job verloren – ich arbeite auch als Kunstlehrerin. Mir geht es am besten, wenn ich in der wilden Natur bin oder etwas erschaffe.
#fyeandfennek #mypmagazine
Mehr von und über Fye & Fennek:
filtermusicgroup.com
facebook.com/fyefennek
instagram.com/fyeandfennek
Interview: Katharina Weiß
Fotografie: Ansagr Schwarz
ansgarschwarz.de
facebook.com/AnsgarSchwarzFotografie
instagram.com/ansgarschwarz
Metric
Interview — Metric
Underlining The Black
Last Friday Canadian rock band Metric released their new record, “Art Of Doubt”. Lead singer Emily Haines explained to us why doubt is one of the most important human instincts—and why people sometimes wonder if the band is having dinner together.
26. September 2018 — MYP N° 23 »Instinct« — Interview: Jonas Meyer, Photography: Maximilian König
“If you would be a real seeker after truth, it is necessary that at least once in your life you doubt, as far as possible, all things.”—What French philosopher René Descartes noted almost 300 years ago, sounds so simple and all-comprehensive. But let’s be honest: not every one of us feels good with questioning the world. The thought of doubting—especially doubting everything—causes most of us some kind of discomfort. But why’s that? Why are we more inclined to look for security than to permanently redesign our lives and environment? Have we made ourselves too comfortable in the status quo?
Emily Haines, lead singer of Canadian band Metric, believes that the process of doubting is urgently necessary because it can bring some sort of healing. With the band’s new record, “Art Of Doubt”, Metric keeps an energetic and wise plea for a creative questioning of everything—a plea that motivates you to get off the couch and do something. We met Emily at SoHo House Berlin for an extensive interview, a few days before releasing the new record.
»All the statistics are showing that people are more and more lonely and unhappy.«
Jonas:
There is a photographer’s saying, I don’t know if you’re familiar with it, but it says that “black and white reduces a photo to its essentials”. In early July your Instagram feed started to turn into black and white, with just a little blue here and there. Reducing your band’s imagery to black and white, does it mean that you want to focus more? Or do you want your audience to focus more?
Emily:
I like the idea of the essentials—an idea of stripping everything away and going back to the source. That definitely feels representative for us. But it’s also just a stylistic choice and a lot of the sonics on the album are referencing our past and also, you know, early days of rock music and punk music that has inspired us. So, it’s definitely about authenticity and grit.
Jonas:
The latest music videos you released for your new songs “Dressed to Suppress” and “Black Saturday” are filmed in black and white, too. Besides that, the “Dark Saturday“ video seems extraordinary for another reason—because of the way it was edited: the video shows a split screen, with four single storylines of you and the other guys of the band. Although you’re united on one screen, every one of you seems a little lonely when striving around in the wee hours of the morning. Is loneliness a danger you have to deal with in your job as a musician?
Emily:
I think it’s an occupational hazard, yes, but it’s something we’re all grappling with. It’s quite well documented that—as our supposed quality of life improves and as we are surrounded by more and more stuff—all the statistics are showing that people are more and more lonely and unhappy, which is kind of ironic. So, I feel you and I agree.
»That’s where being self-obsessed can lead you: to a pretty dark place.«
Jonas:
In this video, you’ve worked together with award-winning director Justin Broadbent…
Emily:
… Justin did a great job with that video because he really captured that feeling that we’ve all had had of just sitting around alone with your phone. It’s like the most depressing thing, and Justin just combined those moments where the four of us are united momentarily, but everyone’s very focused on themselves—and that’s where being self-obsessed can lead you: to a pretty dark place.
Jonas:
It’s interesting anyway: Today you see everywhere people sitting at tables, two or three people, and they’re not chatting with each other, they’re chatting with someone else on their smartphones…
Emily:
It’s sad, isn’t it?
Jonas:
How did you find Justin Broadbent and how did this idea come up?
Emily:
We have an incredible crew of people in Toronto. There’s a really thriving art scene in the neighborhood where our studio is, and Justin has already done videos and artwork for us: we worked with him on our album “Synthetica”, he did the video for “Sick Muse” from the album Fantasies”, so it was very natural. He has a really good rapport with us that’s all about spontaneity and collaboration. For my solo album “Choir Of The Mind” we did that whole campaign together: visuals and everything. He’s just someone that is very much part of the community.
Jonas:
The “Dark Saturday” video was produced with an iPhone and that’s something that would not have been possible 20 years ago when you founded the band: the first smartphone with a camera was released in the 2000s, I guess. What do you think? What impact has the evolution of technology had on your music and on your career as a band in the last 20 years? Or is there even an impact?
Emily:
Well, there’s definitely an impact. We’re very fortunate to have straddled those eras when we were starting out to put up a poster and people came to your show.
Jonas:
Good old days!
Emily:
Yeah! You know, massive multi-million dollar careers were made before this new world that we live in…
Jonas:
…by people like Justin Bieber who got discovered on YouTube?
Emily:
I wasn’t thinking about him. He’s definitely part of the current reality. I’m talking about bands like The Eagles. Back then, everyone was able to not only function but thrive previous to this. But somehow now you just can’t exist without existing in that digital world. So, I think we’ve done a good job of adapting. We’re incredibly adaptable and it’s partly because we run our own company because we refused to be buried by the changes. And you know, that’s not true for everyone, but we’re fortunate. We have a very small and driven team, we just embraced the changes together.
»Somehow now you just can’t exist without existing in that digital world.«
But just to put it in perspective: the day that we released our album “Pagans In Vegas”, Apple went to streaming. Not only did they go to streaming, they just announced that they were going to not pay their artists for three months. That almost destroyed our whole company. I mean, can you imagine? Well, we adapted to streaming, to everything else, but it’s not true for everyone. And that was particularly brutal, just from a pragmatic standpoint. The model forever has been: you make a record and spend a few hundred thousand dollars producing it, and then you put it out and people buy it. That equation is no longer in place, and it’s so surreal. We now spend even more maybe paying producers, buying equipment, making something really of the best quality we can. And then it’s just like “here you go” on the internet. That’s just so retrograde, but we’re embracing it.
Jonas:
A couple of weeks ago we met The Kooks’ frontman, Luke Pritchard, for an interview. He told us that today, in his opinion, only rich people, or people with rich parents, are able to make music—because you can’t afford it otherwise. Do you agree?
Emily:
I mean, yeah! I don’t know how people do it. In our case, we started with nothing, and you know this is what I mean: it’s been 20 years now, or 15 with all four of us, but there’s a work ethic there… It’s a tricky question actually, because The Strokes, for example, were also rich kids.
Jonas:
He said when he grew up, being in a band was a working-class thing, mentioning the Gallagher brothers, The Beatles and so on…
Emily:
Yeah, and I suppose that’s true and that’s how we feel, too. A lot has changed and will continue to change. That’s the other thing we have to remember. And that’s positive, too. Everything’s in flux.
Jonas:
I found an interview with you from 2013 where you said your “favorite thing was not being in a video”. You also said that it’s a strange medium. Is it still your opinion? And if yes, what makes it a strange medium to you?
Emily:
I’m trying to think of the context it would’ve been.
Jonas:
It was in Toronto at the Music Festival in December 2013 after you had released a video for “Lost Kitten”.
Emily:
Oh, that makes sense! Ok, yes. Because I love that video…
Jonas:
…because of the colors and the extraordinary actor?
Emily:
Yeah, and the idea of making someone else a star. I do enjoy it, but in that context that makes sense that I would have said that. It depends on who I’m working with and if it’s a good story. And I like it, you know, but I came into music to be a sound, not a model.
»Doubt is the origin of science and the arts and poetry and everything we know.«
Jonas:
In the same interview, you were asked to describe Metric in one word and you said “love”. James answered “family”. Would you still say the same word when asked again?
Emily:
Uhm, yeah! Maybe more so in fact because of the producer that we worked with on this new record, Justin Meldal-Johnsen. He came in and said: “I see the four of you for who you are as a band. I remember you from The Silverlake Lounge in L.A. in 2003, I’m determined to get you on tape as the live band that you are—and as the four individuals that you are.” For every moment of making the record, every single person was in the room to one hundred percent, and it continues to amaze me. Our friendships evolve, everyone individually evolves, and when we come back together, it’s fresh. You know, there are bands out there that don’t even have dinner together, but we do. Sometimes people ask: “Wow, you guys have dinner together?” Of course, we do! We played with The War on Drugs just a couple days ago, headlined a festival with them in Vancouver, and we were so excited, like, just to connect with another band. I’m a huge music fan and that was always part of the incentive for me to meet all these other artists.
Jonas:
Another big word that has recently become pretty important to you is the word “doubt”. I mean, you’ve dedicated an entire album to it: your new record “Art Of Doubt”. Is doubting a human property that is more positive or more negative?
Emily:
More positive. I would say it’s the origin of science and the arts and poetry and everything we know—because we’ve questioned: What’s in the sky? What is the world made of? Doubt and questioning are the heart. That’s where all the good stuff happens.
»Views are shifting all around the world and politicians are exploiting fear.«
Jonas:
Sometimes Canada seems to be the opposite of what’s going on in the United States. Is it a Canadian property to be more reasonable or doubtful?
Emily:
Possibly… and if so though to me, it’s not really related to the album that we made. Partly because we’re an unusual mix. The drummer and bass player are American, I’m dual, Jimmy was born in England and so we’re kind of this mixed bag. We consider ourselves a Toronto band at this point, but it’s, you know, I think we all want to romanticize places and people.
The political climate in Canada is also difficult. We just selected a premier in Ontario, it’s like a governor’s position, who is a doppelganger for Donald Trump. You know, views are shifting all around the world and politicians are exploiting fear. So, in fact, it’s the opposite of doubt. It’s that they’re like exploiting a sort of arrogance or a sense of entitlement in people as opposed to a sense of looking and examining at the world realizing you’re just one part of it. I feel like the world is really in a questioning moment, but I think we could use a little more doubt that these leaders have our best interest in mind they’re scapegoating a certain group of people. I think that’s a good sign that somebody is full of shit. You know, they’re like: “I’m gonna scapegoat that guy and then cut taxes for another guy!”
Jonas:
In the press kit we got there’s a quote related to your song “Dressed to Suppress” and let me repeat it: “Lyrically, the song explores the maze of conflicts we encounter in our attempts at finding and holding onto love; the absurd mating rituals we routinely perform.” I immediately had to think of all these technologies we use today to find someone we can love. Do you think our behavior becomes even more and more absurd with all these technologies or is it such a timeless human thing, this strange behavior of finding someone?
Emily:
I think it’s probably the latter. Like, technology definitely doesn’t seem to be helping. I think that those fundamental desires are still the same. It’s just sort of saddening somehow that there’s this sense that the tools that are supposed to help people are actually just amplifying the sense of distance and insecurity and paranoia. Is there anything more nightmarish than being in love with someone, then breaking up and then having to watch them parade their life through your Facebook and Instagram? I’m luckily not in the position of having to endure that…
It’s interesting when you think about the people who created this technology. They are all like deeply anti-social people, who needed these tools and it’s an interesting thing to reflect on and take ownership of. Then there’s the rest of us. And by the rest of us, I mean you and me being able to have this conversation and anyone who’s capable of human interaction without all of those crutches. It’s like there is a lack that’s being exploited. But for those of us who don’t feel that lack and are capable of connecting as humans, there’s no responsibility to adapt to this and enlarge that lack, right? It’s like: “Oh, sorry that I’m not sitting here communicating with you through fucking Bumble.” I can actually be like: “Why don’t we just kiss?” If you’re that way, it’s heartbreaking to me that someone feels that they have to become more robotic to be modern. Meanwhile, there’s a super babe sitting across from them at the table, and they are just looking on Tinder for a match with her.
»My writing process is excruciating, I go very deep, it’s very isolating, and I bring really slow heavy songs to the studio: the most honest I can be, the most doubtful and damaged and vulnerable.«
Jonas:
Listening to your new record is like someone showing you the very shady sides of yourself and simultaneously kicking you in the ass and giving you so much energy to change your life. It’s like a big “Get off the couch and do something!” So, I would also call your new record the “Art Of Motivation”, wouldn’t you?
Emily:
Oh, interesting. In fact, it’s something we’ve been talking about in the band. We wanted to be distilling down what it is exactly what we do. Justin Meldal-Johnsen could sense that and really honed in on that for this record.
There’s something very special that is only us in every record we make, whatever the sonic choices, it’s a certain feeling that we try to follow. We don’t know what it is until we find it and then we say: “That’s us!” And I think it’s exactly that. My writing process is excruciating, I go very deep, it’s very isolating, and I bring really slow heavy songs to the studio: the most honest I can be, the most doubtful and damaged and vulnerable. And then we speed that shit up and make it really loud so there’s the motivation and the urgency. It’s not loud and energetic because you’re ignoring or avoiding. It’s because you’re…
Jonas:
… underlining?
Emily:
Yeah, underlining the black! It’s taking the most difficult thing, being honest about it and then just getting the fuck up and changing it. The crazy thing is that this is actually my experience with being in this band. Really painful times that I have expressed in my work have led me to then find myself in front of thousands of people with all this energy. It’s the kind of case in which it works: it works to energize the most unpleasant realities.
Jonas:
When you look back at your 20-year-long history of making music: what was your biggest motivation to keep doing that?
Emily:
Making music has always pulled me forward to never give up and to never succumb to what to me is the pull of depression, which is just waiting for me all the time. And I think we get tricked into thinking that you should ignore it, but I say go towards it and make art out of doubt. You don’t presume, you don’t put on overconfidence exploring and it’s a lie, you know.
More about Metric
ilovemetric.com
facebook.com/metric
instagram.com/metric
twitter.com/metric
#metric #emilyhaines #mypmagazine
Photography by Maximilian König
Interview by Jonas Meyer
Kupfer Bar
Portrait — Kupfer Bar
Trinken an Harald Juhnkes Tresen
In der faszinierenden Unterwelt der Berliner Bars und Kneipen gibt es einen Geheim-Tipp: Wir bestaunen in der Kupfer Bar in Kreuzberg die Tricks der Cocktailkunst und lassen uns erklären, warum eine gute Bar wie eine Affäre ist.
10. September 2018 — MYP No. 23 »Instinkt« — Text: Katharina Weiß, Fotos: Maximilian König
Auf der einen Seite der Couch flirtet die Rechtsanwältin mit dem Bohemien im Stresemann-Anzug, auf der anderen Seite sind ein bis zum Hals tätowierter Musiker und die Studentin mit den Blumen im Haar ins Gespräch versunken. Das Publikum ist so einzigartig gemischt wie die extravaganten Cocktails, die hier ausgeschenkt werden. Vor allem aber leistet die Kupfer Bar – dieser Kreuzberger Geheim-Tipp mit dem Flair der Speak Easys aus der amerikanischen Prohibition – etwas, das in der gentrifizierten Feierszene der Hauptstadt selten geworden ist: Sie ist chic, aber nahbar. Und schafft eine Atmosphäre, in der man mit fremden Menschen echte Gespräche beginnt, die erst mit der allerletzten Wermut-Runde enden.
Wer das Kleinod finden will, muss sich zuerst durch die Tische des Restaurants „Nest“ schieben und sich dann an einer Wendeltreppe emporschlängeln. Oben angekommen, warten meistens schon Barchef Robert Schröter oder die Conférencieuse Wera Bunge auf die abendlichen Gäste.
»Eine Bar ist wie eine Affäre: Intim, nicht prätentiös, es dürfen nicht zu viele Leute davon wissen. Nichts muss, alles kann.«
Manche Menschen gehen in Rente und buchen sich eine Kreuzfahrt zu den Balearen – Wera Bunge wurde lieber Teil einer „ehrbaren Bar“. Die charismatische Dame, die unter anderem als Schauspielerin arbeitete, hat einen Sohn und eine Tochter. Von 1994 bis 2009 hatte sie eine Anstellung als Assistentin der Musik- und Operndirektoren in Saarbrücken inne. „Als die Pensionierung anstand, habe ich überlegt: Will ich hier alt werden? Nein! Dafür will ich in eine große, pulsierende, verrückte Stadt“, sagt Wera Bunge. Passend dazu hatte sie sich nur wenige Monate zuvor in den Kopf gesetzt, ihrer geheimen Leidenschaft für die Barkultur nun endlich nachzugeben. Nach ihrem letzten Arbeitstag packte sie die Koffer – und zog am nächsten Tag nach Berlin, um die illustre Hauptstadt um eine wilde Lebensgeschichte zu bereichern. „Eine Bar ist wie eine Affäre: Intim, nicht prätentiös, es dürfen nicht zu viele Leute davon wissen. Nichts muss, alles kann“, sagt sie weise mit ihrer rauchigen Stimme, die nach ganz viel Leben klingt.
Während der Anfänge arbeitete das Kupfer mit einem Gastbartender-Konzept, Wera war der rote Faden zwischen all den wechselnden Charakteren. Dadurch lernte sie Robert Schröter kennen. Der ambitionierte Barmann mit der lockigen Tolle kennt die Trinkkultur der Hauptstadt, wie es nur einem Original möglich ist: Mit drei Jahren zogen seine Eltern nach Berlin, er erinnert sich noch an wildere Zeiten in Technokellern mit der älteren Schwester und an mittägliche Häuserräumungen neben dem Schulhof. Die Aufbruchsstimmung nach dem Fall der Mauer und die explodierende Feierkultur um die Jahrtausendwende haben sich in seine Biografie eingebrannt: Noch minderjährig begann Robert Schröter, in Berliner Technoklubs zu arbeiten, und mit 21 eröffnete er seine erste Bar. Die hieß „Fledermaus“, öffnete nur für Freunde und bedeutete einen Haufen Arbeit. „Die Halbwelt der Bars, die so schillert und glitzert, hat mich immer schon fasziniert. Ich wollte unbedingt hinter dem Tresen arbeiten. Damals war ich noch wahnsinnig jung – so jung, dass mich keiner als Bartender anstellen wollte. Ich hatte einigen Bars sogar angeboten, dort kostenlos zu arbeiten! Letztendlich entschloss ich mich dann trotzköpfig, einen eigenen Laden hochzuziehen.“
»Bei uns ist der Tresen keine Schranke gegen den Gast.«
Mittlerweile hat Robert Schröter sich anderweitig selbständig gemacht, widmet sich mit dem „Artisan Bar Camp“ lieber der Ausbildung und Vernetzung der Berliner Barszene. Nur freitags und samstags schmeißt er noch die Nächte in der Kupfer Bar. „Bei uns ist der Tresen keine Schranke gegen den Gast“, sagt er. „Die Stimmung ist offen und nahbar – durch die Enge des Ausschankraums wäre alles andere auch keine Option.“ Der gemeinsame Nenner der Stammgäste? „Sie alle sind Genießer und elegant von innen.“
Es ist ein zeitloser Stil, der von den Wänden perlt und in den Drinks schimmert, die “Bring the ‘pagne” oder “Alter Stil” heißen und durchschnittlich zwischen zehn und zwölf Euro kosten. Vielleicht liegt es am Geist von Harald Juhnke, der unvergessenen Berliner Legende. Er unterhielt die Nation in einer Zeit, als Menschen wie er noch „Showmaster“ hießen und diesen Titel zu Recht trugen. Denn der Tresen, hinter dem Robert Schröter seine Spirituosen anrichtet, stammt aus dem ehemaligen „Hotel Bogotá“ vom Kurfürstendamm, in dem sich Harald Juhnke während seiner berühmt-berüchtigten Kneipentouren durch West-Berlin volllaufen ließ.
Auch ein anderes Kuriosum fand durch Zufall seinen Weg in die Kupfer Bar: An einer Wand wacht ein Riesenkrokodil über das Vergnügen der Besucher. Dessen Geschichte reicht unter Umständen hundert Jahre zurück – und ist so verwunden wie nebulös. Doch diese teilen Wera Bunge und Robert Schröter zuweilen über ein Glas auf dem Cocktail-Balkon des Kupfers. Vielleicht fühlt sich auch aufgrund dieser Geschichtsträchtigkeit der innere Kreis der Berliner Partyreihe „Bohème Sauvage“ hier so wohl? Auf exklusive Einladung hin können 1920er-Fans und Stammgäste der Kupfer Bar ab und an einen flamboyanten Abend zwischen Flapper-Girls und Dandys genießen.
»Es geht nicht um die platte Gleichmachung in Form plumper Markenpräsentation.«
Wer jetzt richtig Lust auf hochklassige Cocktailkultur bekommen hat, der sollte sich das diesjährige „Craft Cocktails Kreuzkölln“ nicht entgehen lassen, das vom Kupfer angestoßen wurde. Die Barwoche ist der sichtbarste Teil des Projekts „artisanbar.camp“. Vom 12. bis zum 15. September mixen zwischen Heeresbäckerei und Hermannplatz verschiedene Locations wie „Velvet“, „Bar In A Jar“, „Bürkner Eck“, „Feger“, „Herr Lindemann“ oder „TiER“ unter einem gemeinsamen Banner Cocktails aus handgemachten Spirituosen. „Dabei geht es nicht um die platte Gleichmachung dieser Bars in Form plumper Markenpräsentation“, sagt Robert Schröter. „Vielmehr sollen diese sehr unterschiedlichen Orte mit ihrer sehr diversen Couleur punkten. Und so auch einen nächsten Schritt machen, die so zerfaserte Berliner Bartender-Gemeinde zumindest in diesem Teil der Stadt an einen Tisch zu bringen. Durch Einheit in Vielfalt.“ Alle an einen Tisch beziehungsweise Tresen zu bringen, ist das Alleinstellungsmerkmal der Kupfer Bar, die ihre Gäste zum Schillern bringt und ihnen ein Geheimnis schenkt.
Mehr über die Kupfer Bar:
Görlitzer Str. 52, 10997 Berlin
Freitag und Samstag ab 20 Uhr geöffnet
Craft Cocktails Kreuzkölln:
artisanbar.camp/2c2k
instagram.com/craftcocktailskreuzkoelln
facebook.com/robert.schroter.524
Text: Katharina Weiß
Martin Johnson
Interview — Martin Johnson
Let`s Play The Night Game
We take a talk on the wild side with Boston-born musician Martin Johnson of The Night Game: a retro-ride to the heart of rock ‘n‘ roll.
5. September 2018 — MYP N° 23 »Instinct« — Interview: Katharina Weiß, Photography: Lukas Papierak
Have you ever wondered where the rock stars have gone? They’re probably buried under an oversized Adidas t-shirt, going under the moniker of “A$AP…” and posting Instagram photos of the geometrical tattoos they got at their last techno rave bender. Observing today’s landscape of pop culture, one might get the impression that the conventional rock star—the leather jacket wearing type that has a passion for guitars and sex—has died out. Martin Johnson, who currently helms the new wave band The Night Game, flew over from L.A. to give us some hope. Johnson sports that ruffled hair-do, rough accent, chest hair, denim, leather, tattoos, and snakeskin cowboy boots, to which he comments, “the heel is like three inches, probably the highest ones I’ve ever rocked”. He embodies all the bad-boy aesthetics that died out about in 2003.
But stop! Some things just never die out. The debut album—also called “The Night Game”—is due to be released on September 7th. Johnson has produced eleven tracks that demonstrate the versatility of his talent. Lovers of upbeat pop music will be into sexy tracks, like “Bad Girls Don’t Cry”. Indie lovers will be inspired by “The Outfield” and “Once In A Lifetime”. Those seeking a little electronic twist to their guitar might like “The Photograph”. On “Back in the Van”, The Night Game throws some funk and country inspired sounds into the mix. We explain who Martin Johnson, the singer with the piercing blue eyes, is today.
»All I can be is myself and there is not much I can do about that.«
Katharina:
You mentioned that “The Night Game” record is about sports, sex, and rock ’n‘ roll. There is a certain type of masculinity in your songs that is not often found in the current creative productions. What do you think about masculinity in pop culture today?
Martin:
It is a very strange time to be a white American male—like you almost have to apologize immediately for who you are. All I can be is myself and there is not much I can do about that. Should I dress differently than I want to, just to fit in modern pop culture? Maybe I am not in fashion. It has been in fashion to be a white American male for a very long time, but this ship has sailed.
Katharina:
Although you have great people like Australian artist Kirin J Callinan on the record, The Night Game is basically your solo project, right?
Martin:
Yes. For a long time, the project run under my name, Martin Johnson. But with what my past is, I wanted my music to speak first (editor’s note: From 2005-2011, Martin Johnson was the frontman of the American pop-rock band “Boys Like Girls”. After his worldwide success, he built up a career as a songwriter for artists like Avril Lavigne or Taylor Swift). I am not embarrassed by anything that I have done or who I am. But I wanted the songs to come fist and I fancied a little bit of mystery.
Katharina:
You started your career back then when people played CDs. Today, most people don’t even have a CD player at home. You are still young, but do you sometimes feel the music industry ages faster than usual?
Martin:
I’m fine with the disappearance of the CD. But when you used to buy a record, you invested in this piece of music—so you would be going to like it. You were spending twelve bucks on it, so you were going to listen to it more than once, you would really give it a try. And often, a song that was not outstanding on the first listen, started to grow on you. Now it has to hit you in the first round while the song is streaming. I also compare contemporary music to chains like Urban Outfitters: It is like taking a cool new trend, make it done cheap, and throw it back into the crowd. That is a bit disheartening about modern music.
Katharina:
So, what did you decide to do?
Martin:
Let me say it with a metaphor: if you stay being a broken clock, you show the right time twice a day. But if you’re chasing everything ten minutes behind, you will never catch up. I just gotta do what I gotta do. And this is hard… As a creative, so much of your personal validation comes from whether or not the people like what you show them.
»I had to really rinse myself off former influences. A lot of it was desperation for success.«
Katharina:
A friend of mine once said, “all art is just an abstract tool to scream for love”. To what extent do you agree?
Martin:
Yes, for this record, I had to really rinse myself off former influences. A lot of it was desperation for success. I wanted to know how I would sound like when it was not about that anymore, but just about the music. At the end of the day, I was doing this record to feel something with music again.
Katharina:
It’s been a while since you’ve toured in a tour bus. With a new tour ahead, are you afraid you might get a backache?
Martin:
My back already fucking hurts. There is this illusion of the glamorous lifestyle of the music industry. The reality is more like staying in a budget hotel or entering a venue that smells like piss with a beer-soaked floor.
Katharina:
Are you not drinking anymore?
Martin:
No, I have not had a drink in eight years.
Katharina:
What happened?
Martin:
I probably wouldn’t have made it to this interview if I would still be drinking. But here we are.
Katharina:
Is it harder to live the rock ’n‘ roll lifestyle without the high?
Martin:
It is actually easy. I honestly was a pretty unhappy person when I was drinking. I really like to do everything I do to the extreme. I was very good at drinking and taking pills and cocaine. But I wasn’t really good at being a son or a friend.
Katharina:
Have you found other vices to fill the void?
Martin:
Working, sports, playing poker, sex.
Katharina:
“American Nights” is that kind of atmospheric anthem for your late teen years, when you get drunk on Jack Daniel’s and Coca-Cola while making out in the backyard of some countryside house party. What is your connection to that song?
Martin:
A different one. I wrote this track about the disillusionment of the American Dream. I am asking myself like so many Americans ask themselves: what is the dream supposed to look like and what does that mean for me?
»I live right next to the Hollywood sign, it is just a gigantic cloak of bullshit.«
Katharina:
How does living in L.A., the dream machine, play into these thoughts?
Martin:
I live right next to the Hollywood sign, it is just a gigantic cloak of bullshit. When I was making music for other people, it was good to work there, and the weather is okay. But I don’t really find a tremendous amount of happiness there. It is more about fame than it is about art.
Katharina:
You graduated from high school in 2004 and got famous with “Boys like Girls” in 2005. Did you have the time to think about your dream at all?
Martin:
I never was going to do anything else.
Katharina:
Do you think you have now a better connection to the audience? Is your stage performance better?
Martin:
Yes. But on the other hand, very often I still think that I’m faking it. Do you, as a journalist, ever get the same feeling?
Katharina:
Constantly.
Martin:
I forget how to write a song every day. I wake up in the morning thinking, “here I am faking it again, I hope I don’t get caught”. I am waiting for the fraud police to come in, pointing their finger at me and saying, “this is all bullshit”. I will get kicked out of this arena I was supposed to play in, I clearly don’t have a backstage pass.
»As an artist you seek a lot of validation, like a pat on the back.«
Katharina:
What comforts you?
Martin:
As an artist, you seek a lot of validation, like a pat on the back. I tried to flip that game with this album. I want to separate my happiness from direct successes in the entertainment industry. In my experience, this happiness lasts a bit, but gets very empty at the end. I want my life to be more about family and friends, I am trying to be a good man.
Katharina:
What is your best quality in being a friend?
Martin:
I’ll show up. Believe me. I put my dear ones first. For my friends, I am pretty much someone to call when they have a question, because they know I will give it to them straight.
Katharina:
So, you are not a friend of the beautiful lie…
Martin:
No. A lie is always a waste of time.
Katharina:
Has anyone ever written a song about you?
Martin:
Yeah. A couple were nice love songs, and a few were really angry.
Katharina:
Has Taylor Swift ever written a song about you?
Martin (laughs):
Who knows?
More about The Night Game:
thenightgame.com
facebook.com/thenightgame
instagram.com/thenightgame
twitter.com/thenightgame
#thenightgame #martinjohnson #mypmagazine #katharinaweiss
Interview: Katharina Weiß
Photography by Lukas Papierak
The Kooks
Interview — The Kooks
Music Like A Good Friend
With “Let's Go Sunshine”, The Kooks have just released an album that feels both refreshingly new and fun. In our interview with the band’s frontman Luke Pritchard, he discusses the importance of bringing some light and positivity into the world. And he tells how he managed to revive his late father's voice on the new record.
31. August 2018 — MYP N° 23 »Instinct« — Interview: Jonas Meyer, Photography: Steven Lüdtke
When we initially met Luke Pritchard back in the spring of 2015 for our first interview, the frontman seemed rather pensive. At the time, The Kooks had just released their fourth album “Listen”. After three “extremely turbulent years” leading up to the release of the new record, Luke explained that this album felt like a “fresh start”: The band has been through several ups and downs throughout their more than a decade-long career, but for Luke that time felt especially difficult. So, the work on “Listen” was a “catharsis” for the band: a spiritual cleansing. In terms of form and content, The Kooks placed into question everything that was before and decorated the cover of their album with the illustration of a torn-out heart. Pritchard told us that this heart was not just a symbol of the fragility of the human soul, but also stood for what he had experienced privately in the years before.
We recently met with Luke Pritchard to discuss the band’s latest album, “Let’s Go Sunshine”. “Sunshine”—now we’ll be cheesy for short—seems like an apt title for the band’s brand-new record, and mirrors Luke’s facial expression to which he welcomed us when we met back in June. The severity of three years ago has given way to serenity: the frontman seems at peace with himself—and it seems as if this time round, Luke feels “no pressure”, which also happens to be the title of one of the songs on the new album.
We carried out our interview in the showroom of Gibson Guitars in Berlin-Mitte. Luke remarks how his father once had a Gibson guitar at home as well. Although his father had passed away when he was a young boy, the band have managed to recover several voice recordings of Luke’s dad using the latest technology. On “Let’s Go Sunshine”, both father and son duet together on the song “Honey Bee”. What a moment!
In any case, “Let’s Go Sunshine” is a great album, not only for diehard fans. The band has managed to translate their typical The Kooks sound into 2018. If you hear the new record in the car, you’ll inevitably start tapping your feet and drumming on your thighs. This album is just a lot of fun, but without being irrelevant at any point. From “All The Time” to “Fractured And Dazed” to “No Pressure”, The Kooks deliver an emphatic mix of sounds and lyrics—with hooks that you’ll be hooked on.
“Let’s Go Sunshine” stands firmly on the ground with both legs and does not look back, but with full confidence to the front; music that feels like a good friend. Most likely, that’s the reason why Luke Pritchard can’t help but wear a satisfied smile on his face just before the release of this new album.
»›Let’s Go Sunshine‹ was emotionally a lot more stable than our previous album.«
Jonas:
When we met in 2015 for our first interview, you had just released your record “Listen”. Back then, you told me that you had gone through a hard time, what you called a process of “destruction and recreation”. You described that working on that record felt “cathartic”, like a cleansing of the soul. Three years later, with your latest record “Let’s Go Sunshine” due to be released, how would you describe the creative process this time round?
Luke:
Creating the new record was like going back to the ethos I started with in a sense. “Listen” was like destroying anything I knew about music and doing it in a completely different way. The new album was about “bang chemistry” and about going back to writing songs and focusing on the lyrics—just a really different process. “Listen” was very impulsive, it was literally like a lot of times just me in flow with the computer…
Jonas:
… and created in California with all its vibe.
Luke:
Yeah! “Let’s Go Sunshine” was emotionally a lot more stable than our previous album. I think you can hear it… Everyone in the band was feeling good and positive, we were really enjoying it—the mental state of all of us was probably clearer.
Jonas:
I have to state that you smile and laugh more than three years ago.
Luke:
Yes, I definitely do smile more…
»When I was growing up, being in a band was kind of a working-class thing.«
Jonas:
…many people say that we’re facing darker times than three years ago. In 2015, the world seemed to be in a very different place—in terms of politics, in terms of society, in terms of war and peace. As artists, are you able to detach and free yourself from all the shit that always has been going on in the world?
Luke:
No one really can; it seeps into what you do—but that’s our job, isn’t it? As songwriters or performers, our job is to bring a bit of light and a bit of positivity into the world and to allow people to escape—to share their angst. There’s a few songs on our new album that are definitely spiking out the frustration.
We’re living in a mad time. The UK is becoming harder and harder to live in. We have a very militant, right-wing Tory government. There’s a lot of greed—it feels like money is taking over. At the same time, culture is kind of being left in the dirt… All of that is very frustrating. Even as being a band, on a very small level. There are not as many places to play, there isn’t as much help. Unless your parents are rich, it’s very hard to become a successful artist nowadays—that’s a big deal. If you look at all the latest successful singers from the UK, it’s actually really fascinating: a lot of the megastars, they all had really rich parents. They can afford to spend the time working on music. When I was growing up, being in a band was kind of a working-class thing, whether it’s the Gallagher brothers or Paul McCartney. Today it’s definitely different and that’s really sad… It’s up to us to change it and we can. We have to believe that.
»We wanted to do a fucking great guitar record!«
Jonas:
Listening to your new record feels like meeting an old friend again after a few years of not seeing them. When you meet that old friend, something feels different; they’re stronger, more confident. You try to figure out what’s changed, and you realise that they’ve just grown up. What is it what made you grow as The Kooks and what is it that has helped you to stay who you are?
Luke:
I like that analogy a lot! You have to regard the journey that we’ve come on—and that I’ve personally come on to be right here. You can’t differentiate the album, and the work on it, from this journey…
Jonas:
…but how do you manage certain expectations of people who want The Kooks to remain the same and fans who want The Kooks to progress and evolve?
Luke:
For us, this album really was about us doing what we do best. We were progressing in the sense of doing things better. There’s a lot more orchestration and layering on the album. That said, it is unashamedly The Kooks—even the album title. I wanted it to be one that was like call it up in your face about what The Kooks is. I think that “No Pressure” particularly, on the first songs, is so us, but it also is sonically maybe a progression. We don’t feel a fight about it. We wanted to do something else and we did something else than we did on “Listen”. Don’t misunderstand me, “Listen” was great. But with “Let’s Go Sunshine” we wanted to do a guitar record, a fucking great guitar record! (laughs)
Jonas:
By now, you have released three songs from the new album: “All The Time”, “No Pressure” and “Fractured And Dazed”. The music videos that introduce these three songs on YouTube put the lyrics into the spotlight. Are words today more important to you than ever before?
Luke:
On this album, I probably thought more about the lyrics than ever before. And I had a lot of fun with that! There’s a lot to play with these lyrics because each song has a real meaning, a real part. I think that, more than a vibe thing, the songwriting was massively considered to me this time. On our previous albums, we were quite impulsive, especially on “Listen”. It was very much me acting like a rapper: I was just writing words and singing them. Whereas with our new album, there’s characters—like Catherine in “Tesco Disco”, for example. There’s a message. And there’s an overriding positivity!
Jonas:
When we met in 2015, we also talked about the typeface of your logo: this font has been a constant element that has always been with you since the very first day. Now it has changed, and it seems that you made the typeface dance a little bit. What was your purpose to change something that was so elementary for you over all the years?
Luke:
The previous logo was like a stamp, quite simple. So, it felt that it was time for us to have a change: we wanted our logo to be a little more playful. “Let’s Go Sunshine” is an exciting new record and a new chapter, that’s the reason why the redesign of our logo just felt right.
»The reason why I’m a musician is that, when my dad died, I was left with his books, his records, and his guitars.«
Jonas:
On this new record, there’s a song called “Honey Bee” that is especially touching. You made your dad sing with you who died when you were a child. Do you remember what kind of person your father was?
Luke:
I was three when he died, I didn’t really know him, unfortunately, so creating that song was a magic moment for me. I really think that the reason why I’m a musician is that, when my dad died, I was left with his books, his records, and his guitars. He had a Gibson Les Paul guitar in the corner and lots of records from Eddie Cochran, Albert Lee, Bob Dylan, The Beatles—that lineage back to the 60s really comes from him. That’s how I got to know him, I got to know him through that.
I didn’t know that we actually could put his vocal in. I just had the idea in the studio, it was kind of an afterthought. When we saw that we could realise it, it was very emotional to me. “Honey Bee” was the last song that I sang for the record and it was just overwhelming.
Jonas:
Your new album ends with the song “No Pressure” that seems to be a very important song because its melody is also used in the intro of the record. In “No Pressure”, you’re referring to another song on the album, “Fractured And Dazed”. Do these both songs represent the sunny and the shady side of life?
Luke (laughs):
Essentially yeah, you pinpointed it! These songs represent that idea very well. They coexist because the thing I was dealing with on the new album was letting go: a lot of past stuff and particularly a past relationship I had. I’d had pretty bad experiences with girls. So “Fractured And Dazed” is a song that is really about not going to give up when you think you should.
In contrast, “No Pressure” was written halfway through when I totally fell in love and we had that bubbly moment that I’m still in. I feel so happy that it happened during that process. I think our new record can be seen as a full life circle: coming from giving up the past to starting something new.
»Our new record can be seen as a full life circle: coming from giving up the past to starting something new.«
Jonas:
The young boy on your album cover is looking pretty serious and simultaneously holding colourful balloons in his hand. Is he a symbol of this sunny and shady side of life?
Luke:
I’m really happy with that photo. The imagery basically was meant to represent the letting go in life. I actually wanted to call the album “Weight Of The World”—referring to the song of the same name. In my opinion “Weight Of The World” became the pinnacle moment of the new record because this song represents what the entire album stands for: letting go of the past, letting go of the youth. But I found it was too negative for a title, whereas “Let’s Go Sunshine” feels really positive. And that’s what the album really is in the end.
#thekooks #letsgosunshine #mypmagazine
More about The Kooks:
thekooks.com
facebook.com/thekooksofficial
instagram.com/thekooksmusic
Photography by Steven Lüdtke:
Interview by Jonas Meyer:
Editing by Alexander Salem:
Milliarden
Interview — Milliarden
Leben im Extrem
Wir haben mit der Punkrockband Milliarden ein Bild gemalt, von bodenloser Liebe geschwärmt und uns erklären lassen, warum wir alle Plastikmüll sind.
16. August 2018 — MYP N° 23 »Instinkt« — Interview: Katharina Weiß, Fotos: Steven Lüdtke

Das neue Album „Berlin“ von Milliarden gehört zu den Platten, deren Lieder einem bereits beim ersten Zuhören recht gut gefallen können. Ihre wahre Magie entwickeln sie aber erst, wenn man sie öfter durchgehört und sich ihre bittersüße Betonpoesie in das Unterbewusstsein eingehämmert hat. Dann kann es passieren, dass man der niedlichen Barbekanntschaft nachts um halb vier mit Schnapsstimme „Über die Kante“ ins Ohr grölt. Oder dass man mit 160 über die Autobahn rast und dabei „JaJaJa“ singt.
Live steht die Band zu fünft auf der Bühne, für Konzept und Ästhetik sind aber vor allem Sänger Ben Hartmann (31) und Pianist Johannes Aue (29) verantwortlich. Wir treffen die beidem im brandneuen Kreuzberger Kaffeehaus „Lilie“. Atalay Aktaş, dem auch die „Schwarze Traube“ gehört, versucht seinem Heimatbezirk damit einen Ort zu geben, der an die Tradition von Berliner Institutionen wie der „Mokkabar“ oder dem „Café“ M anschließt: Tagsüber gibt es Kaffee und Kuchen, abends wird getrunken und gefeiert – am Freitag sogar mit DJ.
Inmitten von herrschaftlichen Chesterfield-Sesseln und goldenem Stuck platzieren wir also die Punkrockband Milliarden. Als Ben später vom Rechtsstreit mit den Vermietern seiner Wohnung in Friedrichshain erzählt, fällt der Satz: „Es gibt ekelhafte und es gibt geile Menschen.“ Die beiden „Schnuckel mit dem Super-Schnurri“, wie sich die beiden Musiker bei unserem Treffen scherzhaft selbst bezeichneten, gehören zur zweiten Sorte: Selbst wenn die Unangepasstheit nur Attitüde wäre, ist sie so unterhaltsam, dass man ihnen stundenlang dabei zuhören könnte, wie sie politische Haltung mit Schöngeistigkeit und ein klein wenig Fantasterei verflechten. Während Motz-Verkäufer und Rentner mit flamboyantem Fashionstil an uns vorbeiziehen, malen Milliarden für MYP eine „Mental Map“ auf Papier – ein kleines Symbolbild ihres Berlins.
»Wir wollen nicht in Sicherheit sein. Man muss den Absturz spüren können – oder eben den Erfolg.«
Katharina:
Wenn man im Song „Berlin“ den Namen der Hauptstadt durch einen Namen wie „Marie“ ersetzen würde, könnte es auch ein Liebeslied sein. Was ist einfacher: Liebeslieder für eine Frau oder für die Heimatstadt zu schreiben?
Ben:
Die Liebe zwischen zwei Menschen beschreibt einen Dialog. Innerhalb der Stadt befinden wir uns aber in einem Makrodialog zwischen vier Millionen Menschen. Da muss das Konzept ganz anders verhandelt werden, das ist viel komplizierter. Bei „Berlin“ bin ich mir gar nicht so sicher, ob es ein Liebeslied ist. Es beschreibt auf jeden Fall die Sehnsucht danach, die DNA der Stadt zu fassen. Ich bin hier in Hellersdorf geboren und konnte beobachten, wie sich die äußere Architektur Berlins in den letzten Jahren verändert hat – und wie sich auch die innere Architektur der Menschen daran anpasst. Diese Veränderungen sind gespenstisch.
Katharina:
Was hat sich verändert?
Ben:
Berlin ist nicht mehr der Sehnsuchtsort, der es mal war – könnte es aber wieder sein. Deshalb spazieren wir auf den Trümmern und treten die Tür immer wieder ein. Wir sind auch der Suche nach Rissen, Spalten und Persönlichkeiten – nach den Geschichten, die in diesem Pfuhl schlummern. Als ich Ende der 90er angefangen habe, alleine Bahn zu fahren und die Stadt zu erkunden, war Berlin noch nicht profitabel bebaut, sondern voller Freiräume, die bespielt und genutzt wurden. Kunst und Biografien fanden innerhalb dieser ausgelebten Gedankenspiele anders statt. Ich kam aus dem Plattenbau, bin in dieses neue Berlin-Mitte hineingestürzt und habe an Orten wie dem „Tacheles“ (Anmerkung der Redaktion: Das Kunsthaus Tacheles war von 1990 bis 2012 ein Veranstaltungszentrum in der Oranienburger Straße) ganz neue Formen von Kunst, Sex, Sprache kennengelernt. Heute ist Berlin häufig nicht mehr als ein Werbe-Jingle.
Johannes:
Unsere Sehnsucht ist es, wieder kommunenmäßiger zu leben und frei zu sein. Lass mal das Scheißgeld vergessen und die Gebäude, die an der Spree gebaut werden, abreißen. Früher waren diese Freiräume einfach da, heute muss man um sie kämpfen.
Ben:
Es ist ja vor allem auch ein politischer Kampf. Es gibt immer mehr Luxuswohnungen in Kreuzberg, während auf der Straße immer mehr Menschen verschimmeln. Diesem Prozess haben wir uns einfach hingegeben. Er kann aber auch wieder politisch dekonstruiert werden. Genau das will ich. Und ein Mittel dafür ist die Kunst. Die ist kein Beruf, sondern unser Leben. Und das, was wir zum Klingen bringen, ist unser Risiko. Wir wollen nicht in Sicherheit sein. Man muss den Absturz spüren können – oder eben den Erfolg. Wenn die Inspiration, die in einem selbst keimte, bei anderen landet, dann spiegelt das für mich auch eine gewisse Form von Humanismus wieder. Und der ist uns, im neo-liberalen und rechtskonservativen Strom, komplett abhandengekommen.
Katharina:
Da entgleitet uns gerade vieles. Man denke auch an Gestalten wie Oskar Roehler: 2015 habt ihr euren Song „Freiheit ist ‘ne Hure“ zu seinem Film “Tod den Hippies, es lebe der Punk!” beigesteuert. Statt Punk ist bei ihm jetzt eher AfD angesagt.
Ben:
Das geschieht einigen älteren Leuten – ein seltsames Phänomen. Schon mit meinem Vater ecke ich tagespolitisch oft an. weil die Ängste anders stattfinden. Vielleicht hat das mit verschiedenen politischen Kräften zu tun, unter denen man gelebt hat. Mein Vater beispielsweise ist 1946 geboren. Dann ist er in die DDR hineingewachsen, hat die Wende mitgemacht und ist auf einmal im Turbokapitalismus wieder aufgewacht. Irgendwo zwischendrin war noch der Traum von einem reformierten Sozialismus dabei. In dieser Generation gibt es eine maximale Verwirrung. Vielleicht können wir mit unserem Jungsein wieder die Konstante des Humanismus einbringen und wieder mehr Kunst und Schöngeistigkeit in die Leben hineintragen. Lasst den Wertekatalog mal nicht mehr über unseren Markt und unsere Macht definiert werden!
»Vorleben klappt immer besser als Aufdrängen.«
Katharina:
Johannes, welche biografischen Eckdaten haben dich geprägt?
Johannes:
Ich bin auf einem Dorf bei Bielefeld aufgewachsen und sehr froh, durch Zufall oder Schicksal dort herausgekommen zu sein. In den Mustern, in denen ich großgeworden bin, wird einem ein einfacher Weg aufgezeigt: einfach so weiterleben, die Regeln befolgen. Der Ausbruch aus diesen Strukturen hat mich neue Lebensrealitäten erkennen lassen. Ich kann die Frage, worum es im Leben geht, deshalb anders stellen.
Katharina:
Wie würdest du sie beantworten?
Johannes:
Ich bin da gerade eher pessimistisch eingestellt: Für mich hat das alles keinen Sinn. Man stirbt irgendwann und die einzige Aufgabe ist es, davor seine Kinder oder die Nachwelt zu etwas Anderem oder Besserem zu erziehen. Unsere Zeitgenossen kann man nur schwer mit einem Fingerzeig zum Umdenken bewegen. Vorleben klappt immer besser als Aufdrängen. Meine Sehnsucht nach einer besseren Welt kann jedenfalls erst einmal nur im Mikrokosmos gelebt werden… Erst gestern hatten Ben und ich eine Diskussion im Park: Was würde passieren, wenn Menschen 300 Jahre lang leben könnten statt 90?
Ben:
Dann hätte man einen anderen Generationenvertrag. Du müsstest noch deinen Ur-Ur-Ur-Enkeln in die Augen gucken und dich dafür rechtfertigen, warum du vor einem Jahrhundert Entscheidungen getroffen hast, die deren Leben nun dominieren. Jeder Mensch auf diesem Planeten, wirklich jeder, findet es krass ekelhaft, dass unsere Meere mit Plastik verseucht sind. Aber wir kriegen es trotzdem nicht hin, da was zu ändern, weil unsere ganze beschissene Ökonomie auf billige Produktion ausgerichtet ist. Das sind wir, wie wir hier sitzen. Wir sind der Plastikmüll.
»Auf Status und Sicherheit will ich scheißen, davon ist doch am Ende nichts wichtig.«
Katharina:
Das zu ändern wäre ja schon mal etwas Sinnhaftes.
Ben:
Hoffnung und Lust bleibt als Antrieb. Wenn das weg wäre, bliebe nur die Depression.
Johannes:
Ich erwische mich auch dabei, Dingen hinterherzulaufen, bei denen ich mich den Sehnsüchten eines Großteils der Bevölkerung anschließe: Status und Sicherheit zum Beispiel. Aber darauf will ich scheißen, davon ist doch am Ende nichts wichtig. Die Musterbeispiele für das, was erstrebenswert ist, sind falsch.
Katharina:
Ich hatte den Eindruck, dass einige dieser Fragen auch in eurem Musikfilm „Morgen“ verhandelt werden. Darin fällt zum Beispiel der Satz: „Wer hat sich nicht schon mal verknallt und Scheiße gebaut? Du hast ein Gesamtguthaben an Scheiße, dass du verprassen kannst – und dann ist halt irgendwann Ende.“ Wie oft hast du das Konto schon überzogen?
Johannes:
Zu oft… Das Projekt entstand in Zusammenarbeit mit Regisseur Mario Clement. Zusammen haben wir das Drehbuch entwickelt und die Worte so nahe an unsere natürliche Sprache herangeholt wie möglich.
Katharina:
In „Morgen“ wird ganz zentral auch eine ungewollte Schwangerschaft thematisiert. Dazu gibt es auch einen Song auf eurem Album namens „Ultraschall“. Wer das Album kennt, wartet im Film die ganze Zeit darauf, dass dieser Song kommt. Warum ist er nicht dabei?
Ben:
Der Film bebildert die Singles aus unserem Album mit Videos. Diese einzelnen Sequenzen werden im Film verbunden. Das Thema Abtreibung, auch sich selbst abzutreiben und sein Abenteuer, wird in „Morgen“ nochmal anders verarbeitet als in „Ultraschall“. Dieses Lied würden wir nicht verkaufen wollen.
Katharina:
Verständlich, dann müsste man „Kauft das!“ auf Facebook posten und Promo dafür machen.
Ben:
Genau, das wäre mir zu viel Senkblei.
Katharina:
Was haben die Frauen in eurem Freundeskreis, die schon mal abgetrieben haben, zu dem Song gesagt?
Ben:
Auf mich kamen mehr Männer zu. Wir können uns nicht davon frei machen, in dem Lied eine männliche Perspektive wiederzugeben. Und die Männer, die auf mich zukamen, sagten: Ich fühlte das auch so. Viele hatten keine Worte dafür, meinten aber, es sei die größte Tiefe gewesen, durch die sie je mussten.
»Ob es um die Liebe, ums Feiern oder die Kunst geht: Ich will nicht einschlafen.«
Katharina:
In „Morgen“ wird eine ungestüme Paarbeziehung skizziert, die beim Betrachter durchaus Sehnsüchte hervorrufen kann. Ben, hast du so eine bodenlose Liebe schon mal erlebt?
Ben:
Bei mir ist das gerade so – ich habe eine Frau, mit der ich so lebe. Die Dame ist auf jeden Fall Muse für so einige Songs. Für mich drehen sich die Lieder deshalb nicht um klassische Sehnsüchte. „Rosemarie“ oder „Oh chérie“ sind zudem Lieder, die nicht nur positiv sind.
Katharina:
Also schrecklich-schön.
Ben:
Genau. Es ist so schrecklich, es ist irgendwie schön…
Katharina:
Ist das auch deine Art zu lieben, Johannes?
Johannes:
Das ist auf jeden Fall der Versuch. Ich will der anderen Person in die Augen schauen und immer wissen, dass es um etwas geht. Egal, ob es um die Liebe, ums Feiern oder die Kunst geht: Ich will nicht einschlafen. Es macht viel mehr Spaß, die Dinge anders anzugehen. Klar, mir geht auch mal der Auspuff am Opel Corsa kaputt und ich muss überlegen, wie ich das bezahlen kann. Aber unser genereller Wunsch ist es, im Extrem zu leben.
Wir haben die Künstler gebeten, eine „Mental map“ (eine kognitive und symbolisch aufgeladen Karte eines geographischen Raums) ihres Berlins für uns zu skizzieren:
Lust, Milliarden live zu sehen? Die „Welt im Blech Tour“ startet im September!
26.09.2018 – Bremen, Schlachthof
27.09.2018 – Hamburg, Grünspan
28.09.2018 – Köln, Gebäude 9
29.09.2018 – Münster, Sputnikhalle
03.10.2018 – Frankfurt am Main, Batschkapp
04.10.2018 – Stuttgart, Wizemann
05.10.2018 – Zürich, Bogen F
06.10.2018 – Leipzig, Werk 2
11.10.2018 – München, Backstage Halle
12.10.2018 – Wien, Flex Café
13.10.2018 – Nürnberg, Nürnberg Pop Festival
18.10.2018 – Berlin, Astra
19.10.2018 – Dresden, Scheune
20.10.2018 – Magdeburg, Factory
Mehr von und über Milliarden:
milliardenmusik.de
facebook.com/milliardenband
instagram.com/milliardenmusik
#milliarden #mypmagazine
Interview: Katharina Weiß
Fotografie: Steven Lüdtke
Wir haben Milliarden in der „Lilie“ getroffen, der „congenialen Kombination von Café & Bar“:
Muskauer Str. 15, D-10997 Berlin
Café: Montag bis Samstag von 8 bis 19 Uhr
Bar: Donnerstag bis Samstag ab 18 Uhr
Jugend gegen AIDS
Interview — Jugend gegen AIDS
Mit Liebe, Respekt und Kondomen
Jugend gegen AIDS engagiert sich nicht nur im Kampf gegen eine immer noch unheilbare Krankheit, sondern auch für einen offeneren Umgang mit Sexualität in der Gesellschaft. Roman Malessa ist einer der vielen Ehrenamtlichen, die sich bei JGA für eine bessere Welt einsetzen.
10. August 2018 — MYP N° 23 »Instinkt« — Interview: Jonas Meyer, Fotos: Franz Grünewald
Als das britische News-Portal Metro Ende Mai einige Motive aus Gideon Mendels Fotoserie „The Ward“ veröffentlichte, wirkten diese wie von einem anderen Stern: Der südafrikanische Fotograf verbrachte 1993 mehrere Wochen auf der „Charles Bell Krankenstation“ im Londoner Middlesex Hospital, wo er vier AIDS-Patienten und deren Besucher fotografieren durfte. Alle vier Patienten starben kurz nach Aufnahme der Bilder – mit dem Wissen, dass es keine Heilung oder wirksame Therapie für die tödliche Krankheit gab. Sogenannte antiretrovirale Medikamente, die die Vermehrung des HI-Virus im Körper verhindern, waren im Jahr 1993 noch nicht entwickelt.
Die Fotos von Gideon Mendel erscheinen deshalb so ungewohnt, weil solche Bilder heute einfach nicht mehr vorkommen – zumindest nicht in unseren Breitengraden. Knapp 40 Jahre HIV- und AIDS-Forschung haben es ermöglicht, dass Infizierte mittlerweile ein fast normales Leben mit einer fast normalen Lebenserwartung führen können. Jedenfalls wenn sie in den modernen und reichen Teilen dieser Erde leben, in denen es einen bezahlbaren Zugang zu den entsprechenden Medikamenten gibt.
Eine Institution, die sich seit Jahrzehnten in der HIV- und AIDS-Forschung engagiert, ist die Berliner Charité. Mit über 3.000 Betten ist sie nicht nur eine der größten Universitätskliniken Europas, sondern auch das ältestes Krankenhaus der Stadt. 1710 als Pesthaus gegründet, wurde die Einrichtung ein Jahrhundert später – mit Aufnahme des Lehrbetriebs der Berliner Universität – zu einer bedeutenden Lehr- und Forschungsstätte, deren Geist man auch heute noch an vielen Ecken sehen und spüren kann.
Im Kampf gegen HIV und AIDS geht es aber nicht nur um medizinischen Fortschritt. Es geht auch um Aufklärung – um sexuelle wie gesellschaftliche. Und es geht um Entstigmatisierung. Gideon Mendel sagt, dass die Patienten damals auf der Krankenstation unglaubliche Tapferkeit zeigten, indem sie ihm erlaubten, sie zu fotografieren – vor allem in Anbetracht der hohen Stigmatisierung und Angst vor AIDS, die zu jener Zeit existierten.
Jugend gegen AIDS ist dabei eine der vielen Organisationen, die sich mit aller Kraft um sexuelle wie gesellschaftliche Aufklärung bemühen. Im Jahr 2009 aus einer Schüleraktion in Hamburg entstanden, zählt sie heute zu den erfolgreichsten Aufklärungsinitiativen der Welt. Rund um den Globus engagieren sich für JGA über 500 ehrenamtliche Mitglieder und Tausende Unterstützer im Kampf gegen HIV und AIDS. Außerdem ist es das erklärte Ziel der Initiative, für einen offeneren Umgang mit Sexualität einzutreten, insbesondere bei jungen Menschen. Die knackige Botschaft dabei lautet: „#dowhatyouwant – aber mach es mit Liebe, Respekt und Kondomen!“
In ihrem Engagement versteht sich Jugend gegen AIDS immer als Gemeinschaft – und so werden die Mitglieder nicht müde zu betonen, dass es hier um nichts anderes geht als das gemeinsame Ziel. Und nicht um die einzelne Person, die sich für dieses Ziel engagiert.
Dass aber jede Organisation, jede Bewegung nur lebensfähig ist, wenn es Individuen gibt, die sich mit ihren ganz persönlichen Lebensgeschichten und Motiven einbringen, um dann mit anderen Individuen für ein gemeinsames Ziel zu kämpfen, dafür steht Roman Malessa, Kommunikationsvorstand von Jugend gegen AIDS. Wir haben den 24-Jährigen zu einem Gespräch im historischen und denkmalgeschützten Oskar-Hertwig-Hörsaal der Berliner Charité getroffen – als Stellvertreter einer jungen Generation, die die Welt zu einem besseren Ort machen will.
Jonas:
Ende April hast du auf Instagram ein Foto aus Brasilien gepostet, das du mit folgender Textzeile kommentiert hast: „After four years I am coming back to the place where my worldview changed and my social engagement started.” Was genau ist dort passiert, das die Kraft hatte, deine Sicht auf die Welt zu verändern?
Roman:
Im Sommer 2014 bin ich für drei Monate nach Brasilien gegangen, um dort ein Auslandspraktikum zu absolvieren. In dieser Zeit habe ich vor allem in einem Kinder- und Jugendzentrum in einem Dorf in Alagoas gearbeitet, einem ziemlich armen Bundesstaat im Nordosten des Landes. Diese drei Monate waren eine äußerst prägende Phase für mich. Ich war gerade erst 20 geworden und hatte die klassische Weltsicht eines jungen Menschen aus Zentraleuropa, der – weltweit gesehen – unter sehr privilegierten Umständen aufwächst. Wenn man als ein solcher privilegierter Zentraleuropäer nicht nur für eine Woche Urlaub, sondern für ganze drei Monate in ein Land geht, in dem Elektrizität oder Trinkwasser Luxusgüter sind, in dem unzählige Kinder auf der Straße leben und in dem Suchtprobleme, Kriminalität und Korruption an der Tagesordnung sind, ist das ein fundamentaler Einschnitt – so etwas kannte ich aus Europa einfach nicht.
»Was ist ein Problem für die Leute in Deutschland? Und was ist ein Problem für die Menschen auf der anderen Seite der Welt?«
Jonas:
Wie genau hat sich dein Weltbild in Brasilien verändert?
Roman:
Ich würde sagen, dass sich meine Sicht auf Probleme kolossal verändert hat. Nach drei Monaten Alagoas fragt man sich: Was ist überhaupt ein Problem? Was ist ein Problem für mich selbst beziehungsweise für die Leute in Deutschland? Und was ist ein Problem für die Menschen auf der anderen Seite der Welt? Was ist eine Herausforderung bei uns? Und was ist eine Herausforderung in Alagoas? Diese Fragen stellt man sich in Bezug auf die unterschiedlichsten Bereiche des Lebens. Das fängt an mit der Herausforderung, den Alltag zu meistern, wenn man einfach mal keinen Strom hat, und das für drei, vier oder fünf Tage. Und es geht weiter mit der Herausforderung, nicht genügend Geld zu haben, um sich etwas zu essen zu kaufen – in einem Land, in dem es diese sozialen Sicherungssysteme, wie wir sie aus Deutschland kennen, einfach nicht gibt. Durch all diese Erfahrungen hat sich meine Sicht auf die Welt wirklich grundsätzlich verändert.
Jonas:
Und diese Veränderung des Weltbilds war auch der Grund, warum du dich entschieden hast, dich für Jugend gegen AIDS zu engagieren?
Roman:
Nicht unmittelbar. Als ich aus Brasilien zurückkam, war ich unglaublich froh, wieder in Deutschland zu sein – weil ich die krassen Privilegien hier zum ersten Mal wirklich zu schätzen wusste. Vor meiner Zeit in Alagoas hätte ich wahrscheinlich auch behauptet, dass ich meine Privilegien in Deutschland zu schätzen weiß. So etwas sagt sich ja wirklich unglaublich leicht. Aber erst durch meine Zeit in Brasilien wusste ich plötzlich tatsächlich, was es bedeutet, privilegiert zu sein. Nach meiner Rückkehr habe ich angefangen, mich in verschiedenen Bereichen zu engagieren, hauptsächlich in der internationalen Jugendpolitik. So bin ich letztendlich auch zu Jugend gegen AIDS gekommen – denn ein guter Freund, der ein wenig verfolgte, was ich so tat, sagte eines Tages zu mir: „Roman, du machst so viel neben deinem Studium – ich glaube, ich hätte da noch eine andere Organisation für dich, die dir gefallen könnte: Jugend gegen AIDS. Hättest du nicht Lust, dir das mal anzuschauen?“ Und da ich schon immer sehr neugierig war und alles Mögliche wissen wollte, habe ich mich mit Jugend gegen AIDS befasst und mal vorbeigeschaut – und es hat gleich für mich gepasst. Die Organisation war damals schon in Deutschland sehr erfolgreich und die vielen kreativen Projekte haben mich total begeistert – aber ich habe mir gleichzeitig auch die Frage gestellt, warum die Organisation trotz der zahlreichen Anfragen aus dem Ausland nur hier in Deutschland aktiv war. So wurde es zu meiner ersten Aufgabe, gemeinsam mit unserem Vorsitzenden Daniel Nagel eine Strategie zu entwickeln, wie wir auch Jugendliche in anderen Ländern mit unseren verschiedenen Aufklärungsangeboten erreichen können.
Jonas:
Was wäre passiert, wenn dir dein guter Freund damals nicht empfohlen hätte, bei Jugend gegen AIDS vorbeizuschauen? Wärst du bei einer anderen NGO gelandet, zum Beispiel Amnesty International?
Roman:
Ich glaube ehrlicherweise nicht, dass ich damals auf der dringenden Suche nach einer neuen Erfüllung war. Allerdings habe ich mit Jugend gegen AIDS eine Organisation gefunden, die zu mir passt und bei der ich mich zuhause fühle. Und bei der ich – und das ist etwas sehr Besonderes – alle Dinge, die wir tun, zu einhundert Prozent unterschreiben und dahinterstehen kann. Bei anderen Organisationen gab es immer die Herausforderung, dass ich nicht mit jeder Position konform gegangen bin. Aber bei Jugend gegen AIDS stoße ich selten auf Aussagen oder Bewertungen, bei denen ich das Gefühl hätte, dass sie nicht mit meiner Weltsicht übereinstimmen würden oder damit unvereinbar wären. Das liegt aber auch daran, dass wir generell sehr liberal sind und unsere Leute selber denken lassen – und dass wir ihnen konkret sagen: „Mach was du willst, aber mach es mit Liebe, Respekt und Kondomen!“
»Menschen sind verschieden, aber nicht verschieden viel wert.«
Jonas:
Sich irgendwo zuhause fühlen ist ein großer, starker Begriff. Warum genau fühlst du dich bei Jugend gegen AIDS so gut aufgehoben?
Roman:
Ich habe durch mein Elternhaus bereits sehr früh gelernt, dass es wichtig ist, alle Menschen so zu respektieren, wie sie sind: Menschen sind verschieden, aber nicht verschieden viel wert. Mit Jugend gegen AIDS habe ich eine Organisation kennengelernt, die unglaublich weltoffen und vielfältig ist und die versucht, die Welt mit vielen konkreten Projekten besser zu machen – und das an einer ganz bestimmten Stelle: beim Kampf gegen HIV und AIDS. Jugend gegen AIDS tut dies zum Beispiel über Aufklärungsprojekte, sprich über Bildung. Und diese Kombination aus Bildung und Vermittlung von Werten, mit denen ich mich absolut identifizieren kann, macht Jugend gegen AIDS für mich zu etwas ganz Besonderem.
Jonas:
Glaubst du, du wärst ohne deine Brasilien-Erfahrung auch bei Jugend gegen AIDS gelandet?
Roman (lächelt):
Das ist eine schwierige Frage. Ich möchte nicht sagen: Nein, auf keinen Fall! Denn ich weiß nicht, wie ich mich ohne meine Zeit in Brasilien entwickelt hätte. Vielleicht hätte ich in meinem Leben andere wichtige Erfahrungen gemacht, die mich letztendlich auch zu Jugend gegen AIDS gebracht hätten, wer weiß?
»Ich finde, an einem Badesee oder auf einem Festival Kondome zu verteilen, ist ein sehr authentischer Beitrag.«
Jonas:
An welchem Punkt stand Jugend gegen AIDS, als du dort 2016 angefangen hast?
Roman:
Jugend gegen AIDS ist 2009 aus einer Schülerinitiative entstanden, im Jahr 2010 wurde daraus ein eingetragener Verein – das war sozusagen die offizielle Grundsteinlegung. 2016 war die Organisation also bereits gute sechs Jahre alt und recht erfolgreich. Als ich dazugekommen bin, waren wir gerade auf unserer alljährlichen Sommertour. Sommertour heißt, wir fahren immer genau dorthin, wo sich junge Leute im Sommer so aufhalten: auf Festivals, an Badeseen und so weiter. Dort verteilen wir Kondome und versuchen, für eine aufgeklärte, vielfältige Gesellschaft zu werben – daher sind wir immer auch auf Prides oder CSDs vertreten. Ich finde, an einem Badesee oder auf einem Festival Kondome zu verteilen, ist ein sehr authentischer Beitrag. Denn es wird mir auf einem Festival zwar kaum gelingen, jemanden bis ins Detail aufzuklären, aber wenn ich ihm oder ihr sage: „Pass auf: Egal, was du heute machst, mach es mit Liebe und Respekt, und hier hast du auch noch ein Kondom dazu!“, da macht man alles richtig. Oder zumindest nichts falsch. Ich finde, das ist eine gute Message. So habe ich im Sommer 2016 ganz konkret bei Jugend gegen AIDS angefangen, das war die Situation. Und wie ich bereits erzählt habe, waren wir damals nur in Deutschland tätig. Allerdings haben wir immer wieder Nachrichten aus Österreich erhalten, in denen wir gefragt wurden, warum wir nicht auch dort aktiv seien. Nachdem wir immer wieder gefragt wurden, ob wir nicht mal einige Postkarten und Plakate rüberschicken könnten, haben wir entschieden, unsere Initiative auch in anderen Ländern zu starten. Mehr als scheitern konnten wir ja nicht. So ist unsere Kampagne im Laufe der letzten Jahre immer weitergewachsen – und damit auch unsere Organisation.
Jonas:
Mittlerweile werdet ihr weltweit von zahlreichen Prominenten, Politikern und Unternehmen unterstützt. Was braucht es, um eine Idee wie Jugend gegen AIDS in weniger als zehn Jahren so erfolgreich zu machen?
Roman:
Ich glaube nicht, dass es eine Universalerklärung dafür gibt, warum gerade unsere Initiative so erfolgreich geworden ist. Da kamen im Laufe der Jahre viele verschiedene Faktoren zusammen. Grundsätzlich haben wir aber immer das Ziel, gemeinsam mit unseren Partnern zu wachsen. Die Lochis sind dafür ein gutes Beispiel – Roman und Heiko haben uns bereits vor vier Jahren unterstützt, da waren sie zwar schon bekannt, aber standen noch nicht so im Rampenlicht wie heute. Darüber hinaus ist es wichtig, gerade in der Anfangszeit den Leuten zu erklären, was man machen möchte und wohin man damit will. Dazu muss die Idee, die man hat, in sich wirklich rund sein – und man muss sie authentisch kommunizieren: Wir sind junge Leute, die andere junge Leute auf Augenhöhe aufklären und die sich dabei nicht verkaufen.
Jonas:
Welche Beweggründe hat ein Unternehmen wie Levi’s, euch so medienwirksam zu unterstützen?
Roman:
Levi’s engagiert sich bereits seit vielen Jahren gegen HIV und AIDS, auch über eine eigene Stiftung. Die Levi Strauss Foundation fördert dazu Projekte auf der ganzen Welt, außerdem hat das Unternehmen seinen Hauptsitz in San Francisco und hat sich alleine deshalb schon sehr früh mit der Thematik auseinandersetzt. Für die Marke ist es etwas ganz Natürliches, mit einer Organisation wie uns zusammenzuarbeiten. Und davon abgesehen ist Levi’s eine Firma, die schon immer für Vielfalt stand und als eine der ersten überhaupt auf Prides vertreten war.
»Sehr viele Jugendliche hier in Europa behaupten, dass sie sehr gut aufgeklärt seien – dabei sind sie es gar nicht.«
Jonas:
Wenn ihr selbst die zahlreichen Prides auf der ganzen Welt besucht, seid ihr nicht nur dort, um die gesellschaftliche Vielfalt zu feiern, sondern vor allem, um aufzuklären. Wie groß war dein eigenes Wissen oder Unwissen in Bezug auf HIV und AIDS, als du angefangen hast, dich bei Jugend gegen AIDS zu engagieren?
Roman:
Ich glaube, ich war recht gut aufgeklärt. Witzigerweise behaupten auch sehr viele Jugendliche hier in Europa, dass sie sehr gut aufgeklärt seien – dabei sind sie es gar nicht. Das hat unsere letzte Umfrage ergeben, die wir mit Unterstützung der WHO durchgeführt haben.
Jonas:
Was genau wissen Jugendliche in Europa nicht oder nur unzureichend? Worin sind sie am wenigsten aufgeklärt in Bezug auf HIV und AIDS?
Roman:
Das ist sehr vielschichtig und lässt sich nicht pauschal beantworten. Punkt eins: Jugendliche wissen relativ wenig über sexuell übertragbare Krankheiten. Viele wissen nichts über die Symptome. Sie wissen nicht, wie sie sich schützen können. Sie wissen nicht, welche Konsequenzen es haben kann, wenn man beispielsweise Chlamydien nicht behandeln lässt. Und was HIV und AIDS angeht, haben wir es ebenfalls mit einem unglaublich großen Unwissen zu tun. Gerade hier gibt es riesengroße Fragen, auf die viele junge Menschen keine Antwort haben: Wie überträgt sich das eigentlich? Kann ich mich beim Küssen anstecken? Ist AIDS heilbar? Wenn wir diese Fragen einer Schulklasse stellen, gibt es immer wieder Leute, die sich melden und sagen: „Ja, AIDS ist heilbar. Ich habe mal gelesen, dass es da irgendeine Pille gibt. Die nimmt man und dann ist es weg.“ Aber das ist eben nicht so. Es ist nicht heilbar, es geht nicht weg. Es ist etwas, das einen zumindest das ganze Leben begleiten wird.
»Ist es ok, dass ich so bin, wie ich bin? Kann es mir auch gutgehen, wenn ich nicht so einen Körper habe wie die Leute in meinem Instagram Feed?«
Punkt zwei: Wir erleben immer wieder – und das darf man nicht unterschätzen –, dass sich Jugendliche sehr gut aufgeklärt fühlen, nur weil heutzutage jede Toastbrotpackung mit einer halbnackten Frau bedruckt ist und Sex in der Werbung allgegenwärtig ist. Dadurch hat man das Gefühl, dass die Jugend gut informiert ist, weil sie sich im Alltag ja permanent mit Sexualität auseinandersetzt. Aber das heißt noch lange nicht, dass sie wirklich aufgeklärt ist. Wir haben bei unserer letzten Umfrage herausgefunden, dass viele junge Menschen angegeben, dass ihre Hauptquelle, wie sie sich aufklären oder welches Bild sie sich von Sexualität machen, Pornos sind. Für mein Empfinden ist das aber eher der falsche Weg, vor allem wenn es um Verhütung geht. In den meisten Fällen bleiben die Jugendlichen mit großen Unsicherheiten zurück, etwa bei der Frage: Wie rede ich mit meinem Partner über Kondome? Wann ist dafür der richtige Zeitpunkt? Pornos geben darauf einfach keine Antwort, genauso wenig wie auf die Frage: Wann oute ich mich? Oder: Ist es ok, dass ich so bin, wie ich bin? Alleine das ist ein riesiges Thema. Wenn ich mir die Frauen und Männer in den Social Channels anschaue, sind diese immer extrem gut gebaut, denen geht es immer gut, die haben immer gute Laune und befinden sind immer in einem super Setting. Aber kann es mir selbst auch gutgehen, wenn ich nicht so einen Körper habe wie die Leute in meinem Instagram Feed? Ist es nicht vielleicht auch völlig in Ordnung, wie ich bin? Ist das nicht genauso schön?
»Wir versuchen nie, den Leuten Angst zu machen. Sie sollen selbstbestimmt genau das machen, was sie wollen – gemäß unserer drei Werte Liebe, Respekt und Kondome.«
Jonas:
Ende Mai hat das News-Portal Metro die berührende Fotoserie “The Ward” des Fotografen Gideon Mendel aus den 1990er Jahren veröffentlicht. Diese zeigt verschiedene Menschen, die jeweils an den Krankenhausbetten ihrer an AIDS erkrankten Liebsten sitzen – mit der traurigen Gewissheit, dass diese die Krankheit nicht überleben werden. Die Fotoserie trägt den Titel „Memories from the heart of the AIDS crisis shows true love in a time of terrible tragedy” und wirkt fast befremdlich, weil diese Bilder in unserer heutigen Zeit – nach all den Fortschritten in Forschung und Medizin – so nicht mehr stattfinden…
Roman:
…weil sie hier bei uns so nicht mehr stattfinden.
Jonas:
Exakt, weil etwa in der Werbung HIV-Positive als kerngesunde, vor Kraft strotzende Menschen dargestellt werden. So hat man das Gefühl, es gäbe eigentlich kein Problem mehr. Laufen wir als Gesellschaft Gefahr, den Schrecken zu vergessen, den die Krankheit AIDS mit sich bringt?
Roman:
Ich glaube, dass es an dieser Stelle äußerst wichtig ist zu betonen, welche wahnsinnigen Fortschritte wir bei der Behandlung von HIV und AIDS gemacht haben. Das ist wirklich unglaublich. Wir wissen aber auch, und das sage ich ganz ehrlich, dass es nur einen sehr schmalen Grat gibt zwischen der Entstigmatisierung des Themas – im Sinne von „Ein Leben mit HIV ist kein Problem!“ – und der Verharmlosung von HIV und AIDS in der breiten Masse der Gesellschaft. Da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Allerdings ist unsere eigene Kampagne eine Präventionskampagne, bei uns steht Aufklärung im Mittelpunkt. Wir versuchen nie, den Leuten Angst zu machen, sondern vermitteln ein positives Lebensbild. Die Leute sollen selbstbestimmt genau das machen, was sie wollen – gemäß unserer drei Werte Liebe, Respekt und Kondome.
Was deine Beobachtung angeht, dass Bilder wie die aus der Fotoserie bei uns immer weniger stattfinden, hängt vielleicht auch damit zusammen, dass wir in Deutschland keine explodierenden Zahlen an HIV-Infizierungen haben. Das ist in anderen Ländern anders, auch in europäischen. Dort haben wir es leider mit steigenden bis stark steigenden Zahlen zu tun. Und wenn ich nach Brasilien oder Südafrika schaue, könnte man solche Bilder auch heute noch in den Krankenhäusern machen.
Jonas:
1987 startete die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung ihre Präventionskampagne „Gib AIDS keine Chance“, die sie fast 30 Jahre lang ausspielte. Im Gegensatz zu dieser Kampagne, die sich fast ausschließlich auf den Schutz gegen HIV und AIDS konzentrierte, verfolgt ihr einen differenzierteren Ansatz: In euren Kampagnen geht es nicht nur um sexuell übertragbare Krankheiten im Allgemeinen, es geht auch um Themen wie sexuelle Selbstbestimmtheit, sexuelle Orientierung oder Masturbation. Warum ist es im Jahr 2018 so wichtig, aus dieser Perspektive über HIV und AIDS zu sprechen?
Roman:
Um die Frage zu beantworten, muss ich ein paar Jahre zurückspringen. Unsere Organisation ist 2009 aus einer Hamburger Schülerinitiative heraus entstanden. Damals haben sich Schüler von etwa 30 Schulen zusammengeschlossen, um im Rahmen einer Charity-Aktion zum Welt-AIDS-Tag eine Woche lang rote AIDS-Schleifen zu verkaufen. Dadurch kamen 20.000 Euro zusammen – was für eine Schülerinitiative richtig viel Geld ist. Ursprünglich sollten die Erlöse der Michael-Stich-Stiftung zugutekommen, die sich für HIV-Infizierte und Betroffene sowie für an AIDS erkrankte Kinder engagiert. Aber Michael sagte: „Ihr habt so viel für das Geld getan, ihr sollt auch entscheiden, was damit passiert.“
»Max Müller denkt sich: ›HIV und AIDS sind eigentlich nur relevant für genau drei Personengruppen: Schwule, Afrikaner, Drogenabhängige. Also nicht für mich.‹«
Nun hatten die Schüler also einen Scheck von 20.000 Euro auf dem Tisch – und sie haben sich dafür entschieden, das Geld dafür zu nutzen, um an ihren Schulen Workshops zum Thema HIV und AIDS zu veranstalten. Daraufhin haben sie sich etwas Wissen auf Wikipedia angelesen und ihren Mitschülern erklärt, was überhaupt der Unterschied ist zwischen HIV und AIDS, wie man sich infizieren kann, welche Symptome die Krankheit hat und welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt. Dadurch haben sie ihre Mitschüler erstmal grundsätzlich aufgeklärt. Aber was ist dabei passiert? Max Müller, der irgendwo in der zweiten Reihe sitzt, denkt sich: „HIV und AIDS sind eigentlich nur relevant für genau drei Personengruppen: Schwule, Afrikaner, Drogenabhängige. Also nicht für mich.“ Deswegen haben wir uns in der Folge überlegt – und das tun wir bis heute –, wie wir das ganze Thema für junge Menschen überhaupt relevant machen können, da eine Relevanz scheinbar immer noch nicht gegeben ist. Wir kamen zu dem Schluss, dass es nicht nur wichtig ist, über HIV und AIDS zu sprechen, sondern auch über andere sexuell übertragbare Krankheiten sowie über Well-being, Body Images oder Pornographiekonsum – und das niemals verurteilend. In unserer letzten Kampagne haben wir beispielsweise gefragt: „Kennt die ganze Schule deinen Schwanz?“ Subline: „Nacktbilder sind etwas Persönliches, überleg dir, mit wem du sie teilst.“ Wir würden niemals sagen: „Bitte versende keine Nacktbilder, denn so etwas tut man nicht.“ Beim Thema Sexualität werden viele Leute ganz schnell moralisch. Aber wenn jemand genau weiß, welche Konsequenzen es haben kann, Nacktfotos zu verschicken, und wenn jemand außerdem weiß, mit wem er oder sie diese teilt und genau das auch tun möchte, steht es mir oder uns nicht zu zu sagen: „Mach’s nicht!“ Deswegen versuchen wir, die Jugendlichen mit einem sehr offenen Ansatz für bestimmte Bereiche zu sensibilisieren – auch weil wir merken, dass wir sie über verschiedene andere Themen letztendlich auch zum Thema HIV und AIDS hinführen können.
Jonas:
Seit einigen Jahren gibt es eine Prophylaxe-Therapie namens PrEP: Dabei nehmen gesunde Menschen ein Medikament ein, das die Vermehrung von HIV im Körper verhindert. Diese Prophylaxe soll eine HIV-Infektion beim Sex so zuverlässig verhindern wie Kondome. Wie geht ihr mit diesem Thema um? Macht das Wissen um die Existenz einer solchen „Pille davor“ die Jugendlichen sorgloser?
Roman:
Unsere Hauptzielgruppe ist eine sehr, sehr junge: Wir veranstalten unsere Workshops hauptsächlich in achten und neunten Klassen, das heißt, die Schüler, mit denen wir arbeiten, sind zwischen 13 und 15 Jahre alt. Für diese Altersgruppe ist PrEP normalerweise noch kein Thema, das Kondom ist hier das Verhütungsmittel Nummer eins als klassischer Schutz vor sexuell übertragbaren Krankheiten – und genau das legen wir ihnen auch nahe, vor allen anderen Verhütungsmöglichkeiten. Aber wenn jemand gezielt Fragen zu PrEP stellt, beantworten wir die natürlich auch. Aber ehrlicherweise wird dazu in dieser Altersgruppe recht wenig gefragt.
Jonas:
Vielleicht ändert sich das, wenn ihr mit eurer Initiative in die USA expandiert, wo PrEP viel stärker verbreitet ist als in Deutschland.
Roman:
Mag sein, aber in den USA gibt es für uns ganz andere Herausforderungen – wie etwa das Thema Glaube. Wenn man in einem System lebt, in dem Sex vor der Ehe als ein riesiges Tabu angesehen wird, dann ist PrEP etwas, was wirklich sehr weit unten steht auf der Liste. Da sind wir mit ganz anderen Dingen konfrontiert. Davon abgesehen ist ja mit PrEP auch nicht alles gut, denn es schützt nicht vor den vielen anderen sexuell übertragbaren Krankheiten, die es so gibt. Jetzt könnte man natürlich argumentieren, dass sich diese Krankheiten recht gut mit Antibiotika behandeln lassen. Aber auch das ist nicht so unproblematisch, da es immer mehr Antibiotika-Resistenzen gibt. Daher sind wir nicht der Überzeugung, dass PrEP das Allheilmittel ist. Wir glauben eher, dass das Kondom für die breite Masse und gerade für junge Menschen der beste Schutz vor sexuell übertragbaren Krankheiten und insbesondere HIV und AIDS ist.
»Wenn man zuhause ankommt und zusammen im Bett liegt, gibt es häufig die Situation, dass niemand den Satz aussprechen möchte: ›Ich würde jetzt aber gerne ein Kondom benutzen.‹«
Jonas:
Auf eurer Website schreibt ihr, dass es euch darum geht, dass junge Menschen einen offeneren Umgang mit Sexualität lernen sollen. Gehst du selbst offener oder anders mit dem Thema Sex um, seit du dich bei Jugend gegen AIDS engagierst?
Roman:
Ich glaube, dass wir bei Jugend gegen AIDS eine sehr, sehr offene Art haben, über Sex und Prävention zu sprechen. Das liegt daran, dass wir in unseren Aussagen recht explizit sind – und das wiederum spiegelt sich in der Tonalität unserer Kampagnen wider. Wir versuchen darin immer, die Sprache der Jugend zu treffen, ohne dabei aber zu verrohen oder obszön zu werden. Ich glaube, dass diese offene Sprache wichtig ist, weil sie einen offenen Austausch ermöglicht.
Ein Beispiel: Nehmen wir eine typische 15-Jährige oder einen typischen 15-Jährigen. Der Grund, warum sie oder er kein Kondom benutzt, ist selten der, dass sie oder er noch nie etwas davon gehört haben. Es ist auch nicht so, dass sie oder er absolut kein Kondom benutzen will. Es geht viel eher darum, dass sie oder er einfach nicht darüber sprechen will. Angenommen, man lernt am Wochenende im Club jemanden kennen und geht mit der Person nachhause. Da fragt man unterwegs nicht einfach so: „Ach übrigens, wie verhüten wir eigentlich gleich?“ Und wenn man dann zuhause ankommt und zusammen im Bett liegt, gibt es häufig die Situation, dass niemand den Satz aussprechen möchte: „Ich würde jetzt aber gerne ein Kondom benutzen.“ Denn welche Reaktion könnte das hervorrufen? Vielleicht sagt das Gegenüber: „Findest du, ich sehe krank aus?“ Oder es sagt: „Ich möchte Dir aber ganz nahe sein, daher will ich nicht, dass wir ein Kondom benutzen.“ Gerade dieser Punkt ist in Beziehungen häufig ein Thema. Aber wenn wir es schaffen, einen offenen Austausch sowohl über Sexualität als auch über Prävention herzustellen, dann trägt das ganz konkret zu einer höheren Präventionsquote bei jungen Menschen bei.
»Natürlich würde ich mich manchmal auch lieber abends auf die Couch werfen, um mir ›Let’s dance!‹ mit den Lochis anzuschauen.«
Jonas:
Aber Hand aufs Herz: Warst du selbst immer safe in deinem Leben? Hast du immer ein Kondom benutzt?
Roman:
Ja. Ich war da schon immer so eingestellt und habe darauf sehr geachtet, weil ich es superwichtig finde. Ich schütze damit ja nicht nur mich, sondern auch mein Gegenüber.
Jonas:
A propos Gegenüber: Du bist sehr viel unterwegs und scheinst jede freie Minute in Jugend gegen AIDS zu stecken. Wenn man permanent arbeitet und um die Welt reist, ist es sehr schwer, Zeit für sich selbst oder für eine Beziehung zu haben. Bei unserem Shooting eben hast du erwähnt, dass das Engagement für Jugend gegen AIDS einen gewissen persönlichen Preis hat. Glaubst du, du kannst und willst diesen Preis immer bezahlen?
Roman:
Ich würde niemals sagen, dass ich für mein ganzes Leben und für immer das machen werde, was ich gerade tue. Ich glaube aber, dass diese Zeit gerade eine ganz besondere Phase in meinem Leben ist, und zwar aufgrund von vielen verschiedenen Aspekten. Erstens sind die Dinge, die ich erlebe, viel positiver, als dass sie negativ sind. Zweitens habe ich permanent die Möglichkeit, meinen Horizont zu erweitern. Und drittens treffe ich viele junge, interessante Menschen, mit denen wir immer neue Projekte umsetzen. Ich glaube, solange das Verhältnis für mich und die Organisation positiv ist, werde ich es auch weiter tun. Natürlich – und da bin ich ganz ehrlich – würde ich manchmal auch lieber am Wochenende mit meinen Freunden auf dem Fußballplatz stehen oder mich abends auf die Couch werfen, um mir „Let’s dance!“ mit den Lochis anzuschauen. (Roman grinst)
Aber am Ende des Tages ist es immer ein unglaublich befriedigendes Gefühl, wenn ich die direkte Wertschöpfung von dem erkenne, wofür wir als Team lange und mühevoll gearbeitet haben – beispielsweise, wenn ich am Alexanderplatz vorbeifahre und ein riesiges Plakat unserer neuen Kampagne sehe. Klar gibt es auch bei meiner Arbeit für Jugend gegen AIDS immer wieder Durststrecken, keine Frage. Aber solange ich dieses Gefühl verspüre, möchte ich mit niemandem in der Welt tauschen.
Mehr über und von Jugend gegen AIDS:
jugend-gegen-aids.de
facebook.com/jugendgegenaids
twitter.com/jugendgegenaids
instagram.com/jugendgegenaids
youtube.com/user/theJGAchannel
snapchat.com/add/jugendgegenaids
Fotografie: Franz Grünewald
#dowhatyouwant #jugendgegenaids #youthagainstaids #mypmagazine
Anna-Maria Nemetz
Submission — Anna Maria Nemetz
Nächstenliebe in der Wüste Israels
Midburn 2018: Mitten in der israelischen Wüste feiern Festivalfans aus aller Welt den Trend der „Radical Self-Expression“. Wie es sich anfühlt, in einer Krisenregion Party zu machen, erzählt Anna-Maria Nemetz.
8. August 2018 — MYP N° 23 »Instinkt« — Text: Anna-Maria Nemetz, Fotografie: Meir Cohen
Sanfte Landung auf israelischem Boden am 15. Mai 2018 um 16:20 Uhr. I‘m back home – so zumindest fühlt es sich an, wenn ich nach Tel Aviv reise. Es ist mittlerweile das vierte Mal. Das erste Mal hat es mich dorthin verschlagen aufgrund eines Musikvideodrehs unter der Thematik „Die Suche und Umsetzung der persönlichen Freiheit in einer zunehmend unverständlich-grausamen Welt wie der unseren“. Die Realisierung erfordert vorab eine intensive Auseinandersetzung mit dem Land Israel und der Komplexität der vorherrschenden Konflikte. Mein Interesse wächst. Zudem bin ich von Minute eins magisch angezogen von dieser Stadt.
Es ist der 15. Mai 2018. Nur einen Tag zuvor, am 14. Mai, wurde die Botschaft unter Trump in Jerusalem eröffnet. Gleichzeitig war es der 70. Jahrestag der israelischen Staatsgründung. An Israels Grenze zum Gaza-Streifen kam es zu gewaltsamen Ausschreitungen. Über 60 Menschen kamen ums Leben, unzählige Menschen wurden verletzt. Mir fehlten die Worte. Der Friedensprozess des Nahost-Konflikts grenzt immer mehr an Utopie. Und ich bin auf dem Weg zu einem Festival… Es scheint mir, das Leben in Tel Aviv wird von dieser Absurdität bestimmt: Kämpfe, Waffenruhe, Kämpfe, Waffenruhe, Kämpfe, Waffenruhe… und dazwischen Leben – als gäbe es keinen Morgen. Hoch fliegen, jeden Tag, unter einem Raketenschutzschild!
Ich lande. Ich hetze zum Gepäckband und schnalle mir den scheißschweren Rucksack auf meinen schwachen Rücken. „Ordentlich festziehen, sodass sich das ganze Gewicht hauptsächlich auf meine Beine verlagert“, wie mir der Outdoor-Fachmann bei dem Rucksack-Kauf einen Tag zuvor mit auf den Weg gab. Die Vorbereitung auf den vermeintlichen Survival-Trip „Midburn“ in der Negev Wüste geschah in der allerletzten Minute. Zelt, Schlafsack, einen gut sitzenden Backpacker, Sonnencreme, ein schickes deutsch-authentisches Hawaii-Hemd, das nun nach jahrelangem Kelleraufenthalt endlich Einsatz findet, dazu Wasser, Müsliriegel en masse, die sich in der Wüste hoffentlich gut halten werden, und einen unentbehrlichen Sonnenhut in der angesagten Farbe Beige mit der dicken, nicht übersehbaren Aufschrift meines Rufnamens „Annama“ sowie der Telefonnummer meines Notfallkontaktes, genau wie mir meine liebe Mutter es verordnet hat.
Wenn Gaffa Tape doch nur tatsächlich die Welt zusammenhalten würde!
Der Funktionshut soll im Worst Case-Szenario zur Identifizierung meiner Person beitragen, sollte ich mich unter den Folgen der brennenden Sonneneinstrahlung in der Wüste in einen anderen, gegebenenfalls flüssigen Aggregatzustand umgewandelt haben. Zu guter Letzt ein XL-Gaffa Tape. Ich bin der festen Überzeugung, dass Gaffa Tape alle erdenklichen Probleme lösen kann. Slogan: „Das klebrige Wundermittel, das die Welt zusammenhält.“ Wenn es doch nur tatsächlich die Welt zusammenhalten würde! Ich glaube vollständig vorbereitet zu sein, um das Wüstenabenteuer unversehrt zu überstehen, wenn nicht gar zu überleben.
Durch mein zweites Zuhause schleppe ich mich mit Sack und Pack auf dem schnellsten Weg zum Spaceshuttle, das mich zum Festivalgelände bringen wird. Die Straßenoberflächen glühen vor Hitze und ich spüre, wie sich so langsam ein Feuchtbiotop in meiner Rückenregion unter dem Rucksack bildet. Herrlich! Die Truppe, die ich auf Facebook ausfindig gemacht habe und der ich mich im endlosen Abenteuerfieber anschließe („Midburn ride“), wartet bereits auf mich. Nach etwa zwei Stunden Autofahrt, neuen Bekanntschaften, tollen wertvoll-platonischen Gesprächswechseln, gekühltem „Goldstar“ Bier in den Adern, kleinen Köstlichkeiten mit Hummus im Magen und jeder Menge blauer Farbe in Form von kleinen Kunstwerken auf meinem Körper, bin ich nun legitimiert und bereit, das Festival mit bester Laune zu betreten.
»Welcome Burners, welcome home!«
„Welcome Burners, welcome home!“, heißt es an den Gates. Da ich mich zeitlich keinem Camp mehr anschließen konnte und somit „free camper“ bin, suche ich mir zuallererst ein lauschiges Plätzchen neben all den anderen Zelten auf 2 Uhr, um in erster Linie meine ganze Last loszuwerden. Ähnliches würde ich wohl auch in den Folgetagen tun, nur dass es – ganz dem Midburn-Selbstverständnis entsprechend – um die Befreiung von den psychischen Lasten des Alltags gehen wird. „Release your mind!“ heißt es hier. Mit einem blauen Edding tagge ich noch schnell – ebenso wie später auch alle anderen Freigeister, die mir auf dem Weg der Selbsterfahrung begegnen werden – mein zerschnittenes Shirt mit der Aufschrift „Free Mind“, um die Philosophie des Midburn in voller Gänze zu leben. Ein weiteres Shirt bekommt die pragmatische Aufschrift „Please help!“
Bei der Errichtung meiner Behausung für die nächsten sechs Tage kommt mir das sehr zugute. Ich überlege, ob ich jemals in meinem Leben ein Zelt aufgebaut habe. Die Antwortet lautet zweifellos: noch nie! Ungünstig, denke ich. Die Verzweiflung ist mir ins Gesicht geschrieben und so kommen schnell ein paar Helferlein beziehungsweise meine neuen Nachbarn zur Hilfe geeilt. Gott sei Dank! Bei solch körperlichen Anstrengungen wäre ich in der Hitze wohl eingegangen – und unter Teameinsatz wird das Ganze doch direkt zu einem schönen Erlebnis. Ich erhalte zudem noch einen köstlichen Granatapfelsaft mit Schuss. Fantastisch – ich bin angekommen! Fast schon heimisch.
Die folgenden Tage tanze ich, wie die meisten meiner Weggefährten, überwiegend durch das sandige Wüstenparadies. Schwebende Körper in beeindruckenden Outfits („radical self expression“) unter einem atemberaubenden Sternenhimmel, bunten Lichtern und hypnotisierender Musik – bei Nacht wie bei Tag, als wäre dieser noch ganz unberührt und bereit erweckt zu werden von friedlichen „Burners“, die langsam aus ihrem ganz persönlichen Utopia höchster Gefühle wieder in der Realität landen.
Das Einzige, was käuflich ist, sind kiloweise Eiswürfel.
Regelmäßiger Schlaf kommt nur selten vor. Also eigentlich nie. Zeit ist hier relativ. Entschleunigung, ein wunderbares Gefühl! Bin ich erschöpft, so lege ich mich zwischendurch mal auf gemütlich drapierte bunte Kissen im „Free Love Camp“ oder mache Rast auf dem riesengroßen pinkfarbenen Plüschteddy im „Crystal Grey Camp“. Oder ich finde einen ruhigen Moment in all den anderen tollen Camps. Nach einer kurzen Ruhephase wache ich um 4 Uhr morgens auf. Ein „Kumpel“ beziehungsweise ein „Seelenverwandter“ beziehungsweise ein „Bruder im Geiste“ beziehungsweise ein „Vertrauter“ und „Gleichgesinnter“ in goldenen Leggings weckt mich freundlich auf und überrascht mich mit einer Flasche Rotwein und Müsli mit Milch. Ohne auch nur einen einzigen Cent oder Shekel in den Taschen bekomme ich hier und da einen Snack, eine Erfrischung, ein tolles Gespräch, einen Tanz; Hilfe, wenn Not am Mann ist; eine ehrliche, viel zu lange Umarmung; ein strahlendes Lächeln, einen guten oder gut gemeinten Rat fürs Leben… Man bringt mit, was man glaubt zu brauchen, und beschenkt einander. Das Einzige, was käuflich ist, sind kiloweise Eiswürfel.
Einmal heile Welt spielen. Es kann so einfach sein. Wie gut das tut!
Nach dieser nahrhaften und liebevollen Stärkung finde ich mich tanzend bei magisch glühendem Sonnenaufgang inmitten der Wüste wieder. Laute Musik fliegt 24/7 durch die Lüfte. Mit Sand von oben bis unten bedeckt, Sandkörnern zwischen den Zähnen, alles egal. Körperlicher und mentaler Zustand: fantastisch. Zur anfangs befürchteten Umwandlung meiner Erscheinungsform – von fest zu flüssig, aber stets mit Hut – ist es nicht gekommen. Das Abenteuer Wüste ist ein einzigartiges, inspirierendes Herumtollen auf einem gewaltigen Spielplatz voller Attraktionen und großartiger Begegnungen mit unterschiedlichsten Menschen. Jeder kann tun und lassen, was er will, ohne den Kant`schen Imperativ zu verletzen. Unverfälschte Authentizität, Loyalität und Menschlichkeit werden in vollen Zügen zelebriert und toleriert. Eine Community unabhängig von Religion und Politik. Ein Symposium ganz im Sinne Lessings. Einmal heile Welt spielen. Es kann so einfach sein. Wie gut das tut!
Fotografie: Meir Cohen
Years & Years
Interview — Years & Years
Remaining Silent Isn’t Good Enough
Following their instincts, British electropop trio Years & Years return bolder than ever before.
Lead vocalist and one third of the band, Olly Alexander, discusses the state of pop music,
artificial intelligence and the importance of speaking up.
28. Juli 2018 — MYP N° 23 »Instinct« — Interview: Alexander Salem, Photography: Steven Lüdtke
Three years since their debut record “Communion”, British electropop trio Years & Years have been busy writing and producing their follow-up record, “Palo Santo”. With an air of newfound confidence, lead vocalist Olly Alexander seems eager to share with the world the band’s latest electropop mastery. Backstage at Berlin’s Kulturbrauerei, we sat down with Olly to discuss the state of LGBTQ+ representation in contemporary pop music, artificial intelligence and most importantly why today—more than ever—remaining silent isn’t good enough.
»In terms of LGBTQ+ representation in the public eye, it’s so slim, and if you are someone who has a platform, then you should be doing your damn best to fight for our rights.«
Alexander:
Since 2015 it seems that the world is in a very different place than where it was three years ago. How’ve you personally experienced the last three years in terms of your rise to fame and your own context within this world?
Olly:
As the world has descended into dumpster chaos, I think that we’re seeing some really interesting art come out of it. Trying to chart my own personal journey within the context of what’s happening in the world is obviously quite hard. But I think the last three years has really gotten me to think about my own position within the world. Once the dust had settled after the first album and we had finished touring, it was so overwhelming… I thought to myself, “wow, I’m in such a privileged position as an artist, to be able to create music”. If anything, I feel more and more inspired to do that; to create something that I’m passionate about. I’m very lucky to able to this and I feel more driven to keep going now.
Alexander:
One monumental thing that comes to mind, albeit a depressing subject, are the events that happened in Orlando in 2016 at Pulse club. Did these events in some ways invigorate you to keep going?
Olly:
When those events happened, it was obviously such a huge shock. Given the state of our world today, it got me thinking that it really isn’t good enough to be silent or to not say anything at all. In terms of LGBTQ+ representation in the public eye, it’s so slim, and if you are someone who has a platform, then you should be doing your damn best to fight for our rights…
Alexander:
…especially given the platform you’ve been given…
Olly:
…exactly, a platform is a privilege. Most of us don’t get our voices listened to and I’m lucky to have mine, so, I’m trying to do my best.
»As a white, cisgender, gay guy, it is your duty to really listen to others.«
Alexander:
You have been very vocal in the public eye on how being gay intersects with mental health and spoken candidly on many different issues affecting different LGBTQ+ communities. Have you felt a pressure to fulfil a certain expectation of what it means to a popstar, but also a certain expectation of what it means to be gay in the public eye? How do you navigate and reconcile these two factors?
Olly:
I think that I’ve got a lot to learn. I can do that best by listening to people. In terms of being someone who speaks about their own experience, but also listening to different people across different LGBTQ+ communities. I try my best to listen to other people the best I can, especially on, like you say, how their lived experience intersects with mental health. I’ve lived with my own mental health for so long, so I understand and acknowledge that within myself. I try to listen to other people’s conversations and other people’s experiences. I think as a white, cisgender, gay guy, it is your duty to really listen to others—especially to people of colour and to listen to marginalised communities that exist within our queer community… Be respectful. That’s the attitude I try to adopt across the board with everything. In terms of my career, what’s so intense about having a successful album is that your label wants you to create that kind of success again. Especially with the campaign for “Palo Santo”, it’s quite out there. I wanted to be in a leotard and twirl around on stage—which I’ve been doing for years now. The label sees that and thinks that’ll potentially harm sales or that it will turn an audience off.
»Any resistance that I witness to the work I do where people say, ›that’s too gay‹, or ›that’s too weird‹, makes me want to do it even more.«
Alexander:
A few years ago, you were advised to “hide your sexuality” in the public eye in terms of harming your career. Between “Communion” and “Palo Santo”, have you felt compelled to be more unapologetic about your identity in the public eye?
Olly:
In that specific circumstance, there was a woman who worked in media training. She was someone that the label brought in and was not really connected to the label itself. She thought it was in my best interest to hide my sexuality, in terms of inviting personal questions or having my private life compromised. She had the best intentions of doing that; but it still holds onto an attitude that being gay isn’t acceptable… and that’s not okay. Any resistance that I witness to the work I do where people say, “that’s too gay”, or “that’s too weird”, makes me want to do it even more.
»There are a lot of different ways to love somebody. We need to challenge these dominant narratives in pop music.«
Alexander:
Given the specific context of your music and as someone who openly identifies as gay, what is the significance of using masculine pronouns in your songs about relationships in today’s predominantly heterosexual pop music landscape?
Olly:
We’re so used to hearing one narrative in a pop song. I mean, it’s there for a reason too, a lot of people can relate to that. But the reality is, relationships are more complex than that, there are a lot of different ways to love somebody… we need to challenge these dominant narratives in pop music.
Alexander:
Is this a conscious decision to use the pronouns you use during your lyrical writing process? Or is this just you being you in some ways; someone who happens to be gay, who also happens to be writing pop music?
Olly:
I think both things must be taken into consideration because I remember the first time I slipped a masculine pronoun in my lyrics was in “Real” and I remember feeling quite scared at the time… It felt quite scary.
Alexander:
What element was scary? Was this something you had to overcome with inside yourself, or a certain external pressure?
Olly:
No… It was mostly personal factors. I thought to myself: “Am I really ready to put myself out like that”? It felt quite exposing and made me feel quite vulnerable. That in itself made me feel annoyed because I thought, “why should I be scared of this”? This pushed me to go ahead anyway and do it. Once you’ve done it, you think to yourself, “I’ll just do it again”. I sort of just didn’t tell anyone at the time and just went and slipped it in anyway.
»I’m obsessed with technology, artificial intelligence and interested in how it makes us reassess our own humanity.«
Alexander:
Moving onto “Palo Santo” and speaking about the short film that accompanies the album. Visually speaking, what was the source of inspiration behind the futuristic android society you created in the world of “Palo Santo”?
Olly:
Cinematically, it was really inspired by movies such as “Blade Runner”, “Fifth Element”; even “Twin Peaks” and “Mulholland Drive”. When I was coming up with the whole concept, I got really interested in Victorian spirituality and this weird attitude towards the occult that was so popular during that age. I imagined for “Palo Santo” that what if that was the case, but thousands of years into the future in an android society. I’m obsessed with technology, artificial intelligence and interested in how it makes us reassess our own humanity.
Alexander:
On the topic of artificial intelligence and our obsession with technology; the narrative of the short film says that this futuristic android society “desire nothing more than to experience real human emotion” and a need “satisfy this thirst for entertainment”. To what extent can you draw a comparison between today’s youth and our obsession with entertainment through our mobile devices on apps such as Instagram? Is it a commentary on today’s trends?
Olly:
At the heart of our obsession with social media, for instance, is really a desire to connect with each other. There’s a reason why selfies are so popular because we connect to faces and instantly drawn towards someone’s face. I just imagined that the androids in “Palo Santo” just want to connect to somebody because their machinery is wired a certain way—the question I wanted to pose in the film is, “are androids more human than we think”? I guess that would be the parallel.
Alexander:
What struck me the most about the short film is the diversity of the cast, but also the film noticeably attempts to challenge some rigid expectations of gender and sexuality; it feels noticeably more queer than a large majority of depictions of future societies we’ve seen before…
Olly:
…Thank you!
Alexander:
I just wanted to know, is this how you imagine the future will be in the coming years. Is it going that way? Or it’s 2018 and it’s all just downhill from here?
Olly:
I honestly don’t know. I’ve spent a lot of time imagining future worlds. I mean, who the fuck knows? I know there is one version which is a bit more gender fluid; a bit more fluid across the scale. I would be down for that society, however way that future society may form…
More about Years & Years:
yearsandyears.com
facebook.com/yearsandyears
instagram.com/yearsandyears
instagram.com/ollyyears
Photography by Steven Lüdtke:
Interview by Alexander Salem:
#yearsandyears #ollyalexander #mypmagazine
Hedoné-Seminar
Reportage — Hedoné Seminar
Orgie der Liebe
Das Künstlerkollektiv Hedoné feierte vor kurzem ein illustres Seminar in Polen – mit opulenten Kostümen und vielen Streicheileinheiten: Das haben goldene Göttergewänder und Bondage-Workshops mit ethischem Hedonismus zu tun.
28. Juli 2018 — MYP No. 23 »Instinkt« — Text: Katharina Weiß, Fotos: Ansgar Schwarz
Ein schöner junger Mann, mit feinen Gesichtszügen und hellen Augen, bindet sich eine blaue Blumenkrone um das dunkel gelockte Haupt: Damit strahlt er wie ein schwuler Hermes, von dem man nur allzu gerne gnädige Botschaften der Götter empfangen würde. Er erzählt von der Orgie in der Nacht zuvor: Über 65 Menschen hätten versucht, sich in die „Sagrada Feminina“ zu drängen – diese wurde für die Tage des Hedoné-Seminars erbaut und ist Kunstausstellung und Matratzenlager in einem.
In diesem Tempel der Lust also, der von manchen deutschsprachigen Besuchern als Kathedrale der Weiblichkeit bezeichnet wurde, hätten sich am ersten Abend die Leiber gestapelt. Unter einer schwingenden Plastik aus Fiberglas, die eine Klitoris verkörpert, sei er mit drei Männern im Liebesrausch versunken, erzählt der Jüngling. Für diese Herren sei es die erste schwule Erfahrung ihres erotischen Lebens gewesen. Anerkennend stellt er fest: „Die waren total entspannt damit.“ Eine andere Festivalbesucherin, deren blonde Zöpfe von einem halben Fruchtkorb bekränzt werden, hat die Orgie den anderen überlassen: „Ich war noch viel zu high von der ‚Vocal Therapy‘.“ Die Klänge hätten einen ganz verborgenen Ort in ihrem Inneren geöffnet.
Schwarz ist profan, Gold ist heilig.
Die Sehnsucht nach Schönheit schimmert durch fast jeden Satz, mit dem die etwa 280 meist aus Berlin angereisten Menschen die Sinnhaftigkeit des Seminars umschreiben. Und diese Schönheit erscheint hier im sakralen Gewand: Sphärische Chöre, gemixt mit Technobeats, sollen nach überirdischer Verheißung klingen. Der Dresscode bedient sich vorrangig an Motiven aus der Natur und rangiert zwischen Jugendstil-Symbolik und der Darstellung römischer Götter, erotisch und erhaben. Schwarz ist profan, Gold ist heilig. Gebetet wird nicht zu personifizierten Ikonen, sondern zur Energie, den Sinnen, der Natur. Neo-Hedonisten, so scheint es, empfinden eine gewisse Romantik in der Adaption pantheistischer Traditionen. Die ideologischen Grenzen sind jedoch fließend: „Wir geben nur die grundlegenden Werte vor, wie Liebe und Vertrauen“, erklärt Morta, eine der Organisatorinnen des Festivals. Ansonsten erklären sie sich zu keinem politischen Programm oder einer Partei zugehörig. Im Zentrum stünde die Mission, „Vorurteile gegen das Vergnügen“ zu bekämpfen und einen Raum zu schaffen, in dem emanzipierte Lust nicht nur geduldet, sondern zelebriert werden könne. Neben erotischen Beziehungen will das Seminar auch die Qualität aller anderen zwischenmenschlichen Verbindungen verbessern. Um der ganzen Spaßveranstaltung auch tiefere Töne zu verleihen, kollaboriert Hedoné zudem mit der senegalesischen Rapperin Sister Fa. Diese kämpft in ihrem Heimatland, geprägt durch das eigene Trauma, gegen Genitalverstümmelung von Mädchen.
Einst war der polnische Palast aristokratische Residenz, nun buchbare Örtlichkeit für Hochzeiten oder Festivals.
Zum zweiten Mal veranstaltet das Team – bestehend aus Künstlerinnen und Künstlern aus der ganzen Welt, die in Berlin eine Heimat gefunden haben – ihr Seminar im polnischen Dorf Debrznica. Zwei Stunden von Berlin steht der Pałac. Er ist im perfekten Zustand für das Seminar: Verfallen genug, um Luft und Licht durch viele Ritzen zu lassen, aber gleichzeitig noch ausreichend erhalten, um die Schönheit der einst herrschaftlichen Architektur erkennen zu lassen. Einst war der polnische Palast aristokratische Residenz, dann Klosterschule für Mädchen – und nun buchbare Örtlichkeit für Hochzeiten oder Festivals. Neben dem Hedoné-Seminar veranstaltet hier auch die Crew des „Garbicz Festival“ gelegentliche Sausen. Was die Dorfbewohner davon halten, wenn mal wieder die deutschen Hippies für ein Wochenende voller Bassbeats und Glitzerstaub anreisen, lässt sich nur erahnen. Debrznica hat gefühlt genauso viele Hunde wie Einwohner. Es gibt keine Läden, nur einen kleinen Kiosk, der selten offen ist. Obwohl das Dörfchen nur einen gefühlten Katzensprung von der deutschen Grenze entfernt ist, scheint die Gegenwart hier noch in den 1950er Jahren zu stecken.
Es geht um Lust und vielfältige erotische Praktiken, aber auch ums Liebemachen.
Die Welt hinter den Mauern des Palastes eröffnet hingegen den Blick in die Zukunft. Ein bärtiger Mann mit blau lackierten Zehennägeln meint dazu: „Zu all diesen Genderdebatten, die momentan in den Medien diskutiert werden, kann ich nur sagen: Ich habe das Gefühl, hier wurden diese Fragen schon beantwortet.“ Was er damit meint, ist vermutlich die Betonung, die die Hedoné-Veranstalter auf sexuelle Freizügigkeit und „Sexual Consent“ legen, sprich die Zustimmung zum gemeinsamen Sex. Es geht um Lust und vielfältige erotische Praktiken, aber auch ums Liebemachen: „Liebe dich selbst und liebe jeden, mit dem du deine sexuelle Befriedigung erlangst. Im Zweifelsfall wähle den sanften statt den harten Weg.“ Workshops, die genau das trainieren sollen, nennen sich beispielsweise „Tantric Sensations“ oder „Radiate Sensuality and Sexuality“.
Nach jedem Abschnitt wird der Partner gewechselt.
Letzterer Workshop wird von einer Dozentin aus dem Vereinigten Königreich angeleitet, deren Referenzen auf eine vage heilpraktische Ausbildung zurückgehen. Jeder darf kurz über seinen gegenwärtigen Gemütszustand philosophieren – die Empfindungen reichen von entspannt bis verwirrt –, dann geht es los: Die Teilnehmer finden sich in Pärchen zusammen. Viele Männer sind oberkörperfrei, aber nur eine Frau verzichtet auf Shirt und BH. In den Übungen geht es darum, Berührungen zurückzuweisen oder zu empfangen. Nach jedem Abschnitt wird der Partner gewechselt. Aufregung macht sich im Körper breit, wenn einem ein Fremder über die Lippen streicht, sanft den Kopf massiert oder dir Tee einflößt und dabei ins Ohr haucht. Die Festivalbesucher sind zum großen Teil offen für queere Praktiken und Prozesse, in ihrer erotischen Präferenz merkt man aber einen heterosexuellen Schwerpunkt. Deshalb verwundert es nicht, dass sich im Berührungs-Workshop häufig bewusste Mann-Frau-Konstellationen ergeben. Eifersucht spielt dabei jedoch keine Rolle. Man genießt es, sich für ein paar Minuten tief in die Augen zu sehen und die Haut des anderen zu spüren. Dann lässt man sich nach einer dankenden Umarmung wieder los und sucht sich einen neuen Spielgefährten.
Es wird gestöhnt und geschrien – und George Michaels »Freedom« ist bis ins Dorf zu hören.
Während sich die Workshop-Teilnehmer drinnen ein hormonelles High durch gegenseitiges Anfassen holen, geht es draußen etwas abstrakter zu. Beim „Sensual Shibari“-Kurs kann man sich zu einem Bondage-Paket verschnüren lassen. Eine Frau, die dabei war, zeigt später ein Foto von sich, das ihr Fesselpartner von ihr aufgenommen hat. Darauf liegt sie in angewinkelter Körperstellung gemütlich auf dem Rasen, die Seile umspannen stützend ihren schlanken Körper. Es habe sich friedlich angefühlt. Ein paar Meter daneben leitet ein Workshop namens „Moving the Sacred Masculine“ seine ausschließlich männlichen Teilnehmer mit lauten Übungen dazu an, die guten Qualitäten des Mann-Seins heraufzubeschwören. Und auch der klassische Ausdruckstanz darf nicht fehlen: Auf der Outdoor-Tanzfläche vor dem riesigen künstlichen See des Geländes winden sich Körper in musikalischer Ekstase, es wird gestöhnt und geschrien, alle Glieder werden vom Körper geworfen und George Michaels „Freedom“ fliegt über die Ländereien und ist bis ins Dorf zu hören.
Neben dem Pałac ist das höchste Gebäude Debrznicas die Kirche. Gegen 17 Uhr kommen dort eine Handvoll Dorfbewohner zusammen, chorale Gesänge dringen aus der offenen Türe, in den hinteren Reihen schiebt eine Mutter den Kinderwagen auf dem Gang neben sich hin- und her. Debrznica am frühen Abend fühlt sich so an, wie sich wahrscheinlich der ultrakonservative Ministerpräsident Duda am liebsten seine polnischen Dörfer vorstellt. Dass es bei den Vermietern des Palastes jedoch noch nie Beschwerden der Bewohner über die Seminarbesucher gab, zeichnet ein anderes Bild. Vielleicht hätten einige liebend gerne in der „Sagrada Feminina“ gefeiert, anstatt den Gottesdienst zu begehen.
Beim Nacktyoga frühmorgens hatte er Pech gehabt: Seine Eichel wurde von einer dicken Mücke attackiert und gestochen.
Zu diesem Zeitpunkt hat der durchschnittliche Hedoné-Seminarbesucher schon eine überdurchschnittliche Menge an Streicheleinheiten und Glitzerkuren empfangen. Die Workshops in den Mittagsstunden haben ganze Arbeit geleistet. Man kennt sich nun, wirft sich freundliche und flirtende Blicke zu und alle bereiten sich auf die große Hedo-Gala vor: Mit einer Eröffnungszeremonie am Samstagabend soll die bis Montag andauernde Party eingeläutet werden. Alle schmeißen sich nun in Schale. Ein Mitglied des Hedoné-Teams träufelt duftende Aphrodisiaka auf Handgelenke. Wer seine Blumenkrone schon auf dem Kopf und genug Farbe im Gesicht hat, der entspannt vorfreudig auf der Veranda. Der bärtige Mann mit den blau lackierten Zehennägeln ist nun wie ein persischer Prinz gewandet und ist in Höchstlaune: „Die letzten 24 Stunden Erkenntnisgewinn waren krasser als die letzten zwei Jahre meines Lebens.“ Alles sei spitze, nur beim Nacktyoga frühmorgens hatte er Pech gehabt: Seine Eichel wurde von einer dicken Mücke attackiert und gestochen. Auch Neo-Hedonisten haben es nicht immer leicht.
Über das Miteinander muss sich beim Hedoné-Seminar keiner beschweren – über das Essen scheiden sich jedoch die Geister.
Die allermeisten Besucher sind tiefenentspannt und nachsichtig mit ihren neuen Bekanntschaften. Einer aber, Marke Techno-Wikinger, nimmt sich und die hedonistische Mission der Selbstbefreiung etwas zu ernst. Nackt sonnt er sich auf der Veranda und lauert auf neue Opfer, denen er den Vorwurf der Kleingeistigkeit entgegenschleudern kann. Der blonde Thor im Adamskostüm sagt dann Dinge wie: „Einfach mal das Maul halten, in sich gehen, alleine losziehen.“
– Woraus schließt du, dass ich das noch nie getan habe?
„Das sehe ich in deinen Augen!“, behauptet er und schüttelt leicht aggressiv das lange Haar. Sein Verhalten bleibt die Ausnahme. Über das Miteinander muss sich beim Hedoné-Seminar keiner beschweren – über das Essen scheiden sich jedoch die Geister: Ganz im Sinne der Nachhaltigkeit schätzt der Neo-Hedonismus achtsame Ernährung, weshalb jeweils eine vegane Hauptmahlzeit angeboten wird. Zumindest was die lukullischen Vergnügungen betrifft, kann der ethische Hedonismus nicht mit dem ausschweifenden Original mithalten. Aber wer braucht schon kulinarische Freuden, wenn er noch die fleischlichen hat!
»Wir betrachten das Hedoné-Seminar nicht als Sex-Party, sondern als Zusammenkunft von Liebenden.«
Es ist ein Festmahl für die Augen, alle nun im Gala-Outfit bewundern zu dürfen: Rosen und Ranunkeln, Amaryllen und Anemonen ranken sich um Haare und Hüften, Brüste schieben sich unbedeckt und voller Glitzerstaub aus weißen, wallenden Gewändern, Goldschmuck umrahmt Hände und Fußgelenke. Ein hochgewachsener Jupiter schwingt seinen goldenen Mantel, zwei Frauen kuscheln sich für ein Foto an seine schimmernde Brust, dieses Abziehbild prächtigster Männlichkeit. Und schließlich ruft Lola Toscano, die Gründerin und große Gaja der Gruppe, ihre Anhänger zur großen Eröffnungszeremonie. „Hedonés Ziel ist es, einen sicheren Raum für Einsteiger zu erschaffen, die neugierig darauf sind, den sozio-sexuellen Raum zum ersten Mal erkunden. Daher betrachten wir das Hedoné-Seminar nicht als Sex-Party, sondern als Zusammenkunft von Liebenden, in welchem alles möglich ist, aber nichts ist erzwungen wird.“, erzählt sie, während sich die herrlich kostümierten Seminar-Teilnehmer am künstlichen See einfinden. Sie halten sich mit geschlossenen Augen an den Händen, während eine sanfte Frauenstimme „De rerum natura“ von Lukrez vorließt:
„Mutter Roms, o Wonne der Menschen und Götter,
Holde Venus! die unter den gleitenden Lichtern des Himmels
Du das beschiffete Meer und die Früchte gebärende Erde
Froh mit Lehen erfüllst; denn alle lebendigen Wesen
Werden erzeuget durch dich und schauen die Strahlen der Sonne.“
So lasset die Spiele beginnen! Wer noch nüchtern war, erhebt nun sein Glas oder schmeißt sich eine Pille ein. Abseits der Tanzfläche tollen muskulöse Faune umher, deren Blumengepränge kaum den Schambereich bedecken, während die Abendsonne auf ihre blanken Hintern scheint. Zwei Schwestern, die eine 19, die andere 28, verteilen kleine Autogrammkarten, auf denen sie zusammen als versaute Nonnen oder Krankenschwestern posen. Geschwisterliebe mal anders. Die Eltern der beiden feiern dieses Jahr ihr 40. Ehejubiläum – monogam und glücklich. Ihre Töchter freuen sich schon auf die Orgie, mit der die Nacht in der „Sagrada Feminina“ gekrönt wird. Auch im zweiten Stock stimmt man sich auf den sinnlichen Teil des Abends ein. Zwei Frauen fahren mit ihren Fingernägeln sanft am Unterarm eines Mannes entlang, der seine Augen nicht von der Schönheit wenden kann, die ihm die Götter da vor die Füße gelegt haben.
Die Dunkelheit bricht an. Schnaps gleitet die Kehlen hinunter, parfümierter Rauch steigt empor, überall greifen Finger ineinander und ein goldglänzender Jupiter verschwindet kichernd mit einer blonden Venus in die Nacht.
Mehr über das Künstlerkollektiv Hedoné:
Fotografie: Ansagr Schwarz
ansgarschwarz.de
facebook.com/AnsgarSchwarzFotografie
instagram.com/ansgarschwarz