Luke Evans
Interview — Luke Evans
Soundtrack Of My Life
With his pop album, »At Last,« Hollywood actor Luke Evans emerges from the tough-guy cocoon. He explains why music is his first love, why men should go to therapy more often and why we should not try to change our lovers.
3. Dezember 2019 — MYP N° 27 »Heimat« — Interview & Text: Katharina Weiß, Photography: Frederike van der Straeten

On screen, Luke Evans often takes on the part of the tough guy—in “The Hobbit,” “Beauty and the Beast,” or recently in “Midway,” the new blockbuster by Roland Emmerich. All these movies are designed to show him in very assertive and commanding characters.
Beyond the film business, Evans enjoys exploring the facets of human emotions through big ballads. Twelve of them can be heard on his debut album “At Last” now.
We met the artist in the speakeasy lounge of The Marqués, a bar and restaurant in Berlin. This elegant souterrain is a secret escape for lovers of vintage flair and strong cocktails—and the ideal place for a quiet chat with one of Hollywood’s hottest exports.


»I like to take people on a journey.«
Katharina:
At the age of 16, you left school to move to Cardiff and study singing. So, you are not an actor turned into a singer, but a singer turned into an actor. Which of these disciplines brings you more recognition? And which is it that brings you more self-fulfillment?
Luke:
Recognition would definitely come from my acting. Movies have a huge audience in general and I’ve done some very big films in the last 11 years—and these movies have been internationally recognized. When it comes to satisfaction: I like telling a story, I like to perform and entertain, I like to take people on a journey. I can do that through acting, but there is something very special about singing for me—because music is my first love. I sang my whole life. I found my passion for performing and telling stories through singing.


»I was a mystery shopper for Harrods and Harvey Nichols.«
Katharina:
In your early career, you starred in the musicals Taboo, Miss Saigon and Piaf. What memories do you cherish most about these probably pretty wild times being a starving artist?
Luke:
I was never really starving. When I was not on stage, I always did other jobs: I worked in a PR agency, I was a bouncer, I was a mystery shopper for Harrods and Harvey Nichols, I sang in a band. Doing musical theater was a wonderful time because you always used to be with a group of people for 12 months—you become a traveling circus. Everybody in that company will be your friends and family.


»It’s interesting turning a song on its head and stripping back everything that we know about it.«
Katharina:
Your choice of song titles and especially your choice of arrangements have a melancholic touch to it and the instrumentals are quite epic. What kind of esthetic pleasure did you find in creating the album that way?
Luke:
It’s interesting taking a song that people know extremely well, turning it on its head and stripping back everything that we know about that track. Maybe it’s the dynamic production of a song: “Love Is A Battlefield,” for example—a huge track! When you slow down the tempo, you listen to the lyrics in a different way. Or having a man who sings a song like “If I Could Turn Back Time”: You are immediately taken away from the Cher version, and because of that, and because you can’t compare it to anything else, it gets a whole different life.
»People need to be connected to what you’re telling them. Your job is to move them.«
Katharina:
Most of the songs on your new album are powerful tales of love and lost passion. What are the most important artistic skills to sing such songs in a credible way?
Luke:
It‘s about telling a story, in movies and in music: You are trying to relay an emotion on the people listening or watching. Your job is to move that person, they need to be connected to what you’re telling them. I think this was my incentive with that song: to connect with the listeners and to make them relate to the songs because I relate to them very well. They are part of the soundtrack of my life: songs that you hear and you immediately know where you’ve been when you heard them first. Or which lover you were with or what job was going on.

»You can only change somewhat when you meet someone.«
Katharina:
How intense was the journey back to your own experiences while recording the album?
Luke:
There are certain songs on the album that mean an awful lot to me: I remember when I heard “The First Time Ever I Saw Your Face” by Roberta Flack. I was twelve and became an instant fan. I listened to everything she did on her album First Take: her breathing, her technique, her phrasing, her emotional expression. It became extremely powerful to me and showed me what singing can do to somebody—if you really connect with the words and the melody. That song has been with me ever since.
Katharina:
You mentioned in a radio interview that you interpret the song “Changing” as “a powerful song about the challenges people face when in relationships that are perhaps not meant to be.” Then you continued: “Sometimes we find ourselves willing to do anything to make a relationship work, and in the end, you find yourself very unhappy and broken down from all the energy you’ve put in to making it work.” Are these experiences always just devastating? Or have you also found a source of creativity in some of that pain?
Luke:
I think life is full of experiences. Some are easy and some are hard. But if you can, you should learn from these good and bad lessons and become a better person. One thing the song explains very clearly: You can only change somewhat when you meet someone. But they should accept you for who you are—not for who you want to be. “Don’t Go Changing Just For Me,” the song repeats this line twice. Be who you are. And if it’s meant to be, then it will work.
If we are lucky enough to find that person we are falling in love with, we have to accept that there will be a lot of things about that person we are not going to understand. We will look at things differently. And the song tries to tell us: “That’s fine. You don’t have to change to fit into my world and the other way around. Our worlds can work together. We can travel through life and be different people—and can still be one.”
Katharina:
You have the charm of an all-around entertainer. Tastewise, I found some parallels to the work of Hugh Jackman. He is also starring in blockbuster productions, but he uses his spare time to travel the world with his The Man, The Music, The Show production. You met Jackman on The Jonathan Ross Show—could you see yourself doing a world tour like Jackman? Have you maybe even exchanged experiences with him at some point?
Luke:
Hugh Jackman is an incredible performer. He has an amazing ability to adapt to many forms of artistic expression. And he has built up an incredible fanbase. He has done The Showman and Les Misérables, so he has done his work. And now he is reaping the benefits of taking it to a world tour and filling The O2 in London. I admire and respect this a lot. So, when it comes to my aspirations: Who knows.


»I have chosen that the wardrobe to go with is much more about my personality.«
Katharina:
On screen, you often portray classic models of manhood. Will your stage performances also be influenced by patriotic Hollywood glamor and gentleman stereotypes like Frank Sinatra?
Luke:
I just want to be myself. Often as an actor, when you go on the red carpet, they dress you up in a suit or a tuxedo. But on At Last, it’s just me singing the songs that I love: my voice, my face, and my energy. So I have chosen that the wardrobe to go with is much more about my personality. Maybe I spare the classic attire for when I do a jazz album.


»My generation is still caught in old role models.«
Katharina:
Speaking of gender: In an interview last year you talked about psychotherapy and mental wellbeing. You were quoted: “We all carry baggage around with us, men carry it way deeper than women most of the time. We’re not good at talking about it and opening up.” Did you—after the interview—experience a lot of colleagues opening up to you about their own struggles?
Luke:
I wouldn’t say that people came to me after the interview to open up. But I definitely had friends that have lived through difficult moments, just like I have. And I have often recommended therapy to them. It helps me to keep me in a healthy mind space. Sometimes it’s just good to offload it to somebody you don’t know. Because friends or family members will always take a side, they will have an opinion, whereas a professional stranger can help you to see which thing you have to process. And sometimes you discover things you never thought were the reason you went into that room to talk about.
And even though times are changing and men can become more fluid with their emotions, I think my generation is still caught in old role models: In the South of Wales where I came from, men were told to have a stiff upper lip, be the men of the house, play rugby, don’t cry. It’s rubbish and ridiculous. We are all born with the same set of emotions, we are all born with the ability to love and to get hurt. And we will carry these emotions around with us till the day we die. So, there is no point in hiding, there should be no shame in it. And when you have problems with your mental health or you’re dealing with a lot of stress: There is help. Me and lots of people I know have immensely benefitted from seeing a therapist.


»Friends are the family you choose.«
Katharina:
You recently premiered the last song on your album, “Bring Him Home,” from the musical Les Misérables on British TV. Why is this title so special to you?
Luke:
I missed that song very much. It was the song that I sang when I was 16—and it gave me the scholarship to go to musical school.
Katharina:
Our current issue is dealing with the German word Heimat and feeling home somewhere. Which pictures come to your mind when you feel homesick?
Luke:
Some memories go back to our family house in Wales where my mum and dad live. But home is also London. I built a lovely home there and I have friends all over the town who are like my extended family. I’ve known them since I was 17, and what do they say: Friends are the family you choose. They are very supportive and care for staying in contact. That’s home to me: Being around the people I love.

»Everybody should choose their religion when they are old enough to understand what it is about.«
Katharina:
At the same time that you moved to London, you left the religion you were raised in. How did growing up as a Jehovah’s Witness influence your view on the world?
Luke:
It was a good upbringing. I was very loved, and I was brought up with a good set of standards. And weirdly, the way Jehovah’s Witnesses are obligated to knock on doors or to read the Bible in church—it was a great sort of formal training. I learned how to deal with rejection, I got doors slammed in my face. I learned how to speak in public. Weird but interesting: We did not celebrate Christmas or birthdays. Leaving home meant a completely new start. And I was a very ambitious young man, even at 16. But I was ready to go and spread my wings and discover new worlds. My opinion on religion now is: Everybody should choose their religion when they are old enough to understand what it is about. Religion can be very good and very bad, so it should be everyone’s individual choice and not part of the upbringing.

»I celebrated my first Christmas when I was 18.«
Katharina:
Even though you didn’t celebrate Christmas as a child, the album has been released at the beginning of the Christmas season. I assume it isn’t a coincidence that you’ve chosen such festive evergreens. Are you a big Christmas fan?
Luke:
Yes, I adore and love it. I celebrated my first Christmas when I was 18. And the holidays got bigger and bigger ever since. We travel for Christmas because people don’t make movies over the season. We’ve been to Colombia, Panama, Mexico. Sometimes with 16 people. This year it will just be me and my partner in Hawaii.

Many thanks to The Bar Marqués for providing their elegant souterrain.
#lukeevans #atlast #mypmagazine #katharinaweiss #frederikevanderstraeten
More about Luke Evans:
instagram.com/thereallukeevans
facebook.com/thereallukeevans
Photography by Frederike van der Straeten:
Interview & text by Katharina Weiß:
Editing by Benjamin Overton:
Hair & makeup:
Sophia Heins & Gero Gogler
Noah Levi
Interview — Noah Levi
Jung und naiv
Mit seiner ersten EP »Jung & Naiv« hat Noah Levi vor kurzem sieben Songs in die Welt gesetzt, die überaus reflektiert und persönlich wirken. Wir haben den 18-jährigen Musiker in einen Klassiker aus den Swinging Sixties gesetzt und mit ihm über eine junge Generation gesprochen, die alles andere als naiv scheint.
19. November 2019 — MYP N° 27 »Heimat« — Interview & Text: Jonas Meyer, Fotos: Danny Jungslund

Als die Ford Motor Company am 17. April 1964 auf der Weltausstellung in Flushing Meadows in neues Fahrzeugmodell namens „Mustang“ präsentierte, war das in den USA nicht weniger als eine Revolution. Das amerikanische Straßenbild war seinerzeit fast gänzlich durch chromblitzende Straßenkreuzer geprägt, deren Karosserien über die Jahre immer länger wurden – und die Heckflossen immer futuristischer. Der Mustang sollte eine neue Ära einläuten. Mit seinem sportlichen Look sprach er eine jüngere, modernere Käuferschicht an und unterschied sich deutlich von allem, was bisher so auf amerikanischen Straßen zu sehen war. Eine Reaktion auf den Zeitgeist, würde man heute sagen.
55 Jahre später. Ein himmelblauer Mustang der ersten Serie hat es über die Zeit und bis nach Berlin geschafft. Der Zeitgeist der Sechziger ist lange passé, dennoch wirkt der Mustang nicht wie ein Oldtimer, ganz im Gegenteil. So, wie er dasteht, umgibt ihn immer noch diese seltsam-erhabene Aura von Freiheit, Rebellion und Stil, die ihm auf ewig einen Platz in der Geschichte der Popkultur sichert. Der Mustang altert nicht. So wie James Dean nicht altert. Oder die Beatles.
Einer, der das erst noch beweisen muss, ist Noah Levi. Doch die Chancen stehen gar nicht schlecht, denn der 18-Jährige, der vor kurzem sein Debutalbum mit dem Titel „Jung & Naiv“ veröffentlicht hat, will so gar nicht in das Muster passen, das gerade auf dem deutschen Musikmarkt en vogue ist. Klar, auch Noah Levi ist jung, männlich, Instagram-tauglich und singt auf Deutsch. Doch er ist kein Interpret, sondern Vollblutmusiker, der seine Songs selbst schreibt und seine Musik so macht, wie er sie machen möchte.
Und es gibt noch einen Unterschied: Noahs Texte sind wesentlich reflektierter und der musikalische Stil deutlich experimentierfreudiger, als man das von einem so jungen Musiker erwarten würde. Dabei gelingt ihm der Spagat, auf der einen Seite eingängige Melodien zu schaffen, die einem wie bei „Drei Straßen“ einfach nicht mehr aus dem Kopf gehen wollen. Und auf der anderen Seite wirft er – wie etwa im Song „Jung & Naiv“ – einen nachdenklichen Blick in eine Zukunft, die für viele Menschen seines Alters noch ganz weit weg erscheint.
Führen wir also Noah Levi mit dem Mustang zusammen – zwei Vertreter ihrer Zeit, mit einem eigenen Stil und einer eigenen Haltung. Nur dass der eine schon ein Klassiker ist. Und der andere alles dafür tut, mal einer zu werden.


»Ich wollte den Menschen, die meine Musik hören, auch etwas zum Anschauen geben.«
Jonas:
Du hast vor einigen Monaten eine kleine YouTube-Serie mit dem Titel „Straßen von mir“ gestartet, in der du deine Fans mit auf eine kleine Retro-Tour durch Berlin nimmst und ihnen Orte zeigst, die eine besondere Bedeutung in deinem Leben haben. Was war deine Motivation, fremden Menschen einen so tiefen Einblick in dein Privatleben zu geben?
Noah:
Ich wollte den Menschen, die meine Musik hören, auch etwas zum Anschauen geben: So, wie meine Songs einen Einblick in mein Leben ermöglichen, so sollte das auch die Cam tun – natürlich ohne dabei meine intimste Privatsphäre preiszugeben. Ich glaube dennoch, dass ich mit „Straßen von mir“ etwas sehr Persönliches von mir offenbare, wenn ich genau die Orte näher vorstelle, die in meiner Vergangenheit eine besondere Rolle gespielt haben. So kann ich den Leuten zu zeigen, wer ich bin, was ich gemacht habe und wie ich aufgewachsen bin.
Jonas:
Was hast du empfunden, als du diese besonderen Orte für deine Webserie wieder besucht hast?
Noah:
Das war ganz schön verrückt, vor allem, als wir an meiner alten Schule gedreht haben. Da kamen direkt die Erinnerungen hoch. Ich habe das Gefühl, dass ich in der Schule irgendwie ein ganz anderer Mensch war. Ich hatte viel weniger Erfahrungen in allem und einen ganz anderen Blick auf die Welt. In dieser Hinsicht hat sich in nur wenigen Jahren sehr, sehr viel verändert.

»Die Musik war etwas, bei dem ich zum ersten Mal positiv hervorgestochen bin – ganz im Gegensatz zur Schule.«
Jonas:
In einem der Videos sagst du, dass dir die Musik die Bestätigung gibt, die du in der Schule nicht gefunden hast. Was genau meinst du damit?
Noah:
Die Musik war etwas, bei dem ich zum ersten Mal positiv hervorgestochen bin – ganz im Gegensatz zur Schule: Ich habe nie zu den besten Schülern gehört, hatte oft Probleme mit den Lehrern und manchmal auch mit den Mitschülern. Es fiel mir immer schwer, mich im Unterricht zu konzentrieren und dem zu folgen, was die Lehrer gesagt haben. Und ganz davon abgesehen hatte ich auch nie eine besonders große Motivation. Insgesamt bin ich mit dem Konzept Schule ziemlich kollidiert. Und wie das so ist: Wenn man nichts tut, kommt natürlich auch nichts zurück. Meine Noten waren meistens schlecht, worüber sich meine Mutter auch nicht wirklich gefreut hat. Dementsprechend gab es zuhause oft Stress. Mittlerweile streiten wir uns gar nicht mehr – ich gehe ja auch nicht mehr zur Schule (Noah grinst).

»Ich bin immer noch der hitzköpfige, naive Typ, der immer alles aus dem Affekt entscheidet und nicht über die Konsequenzen nachdenkt.«
Jonas:
Auf YouTube finden sich Clips, die zeigen, wie du als 14-Jähriger auf der Bühne stehst. Wie geht’s dir, wenn du heute diesen Menschen von vor vier Jahren siehst? Was habt ihr beide gemeinsam? Worin unterscheidet ihr euch?
Noah:
Charakterlich habe ich mich in den letzten vier Jahren wahrscheinlich kaum verändert. Ich bin immer noch der hitzköpfige, naive Typ, der immer alles aus dem Affekt entscheidet und nicht über die Konsequenzen nachdenkt. Ich bin nach wie vor total verplant, schusselig und schlecht mit Zahlen – all das ist bis heute geblieben. Eigentlich hat sich im Laufe der Jahre nur geändert, mit welchen Leuten ich arbeite und in welchem Umfeld ich mich bewege. Heute gibt es in meinem Leben Menschen, die gezielt meine Stärken fördern. Das war vor vier Jahren noch nicht so.

Jonas:
Wir haben eben über besondere Orte deines Lebens gesprochen. Wenn du auf die letzten 18 Jahre deines Lebens schaust: Welche Menschen gibt es, die eine ebenso besondere Bedeutung in Bezug auf den Weg, den du gegangen bist?
Noah:
Ich hatte verschiedene musikalische Mentoren, die mich geleitet haben. Am meisten haben mich aber immer meine Eltern und meine Freunde unterstützt. Vor allem in der Zeit, als ich noch zur Schule gegangen bin und die Arbeit an der Musik ziemlich hart war. Da war es immer das beste Gefühl, zu meinen Freunden oder Eltern zu kommen, die mich total verstanden haben. Sie waren ja nicht verpflichtet, mich da durchzuboxen.

»Nicht schlimm, wenn es scheiße klingt. Hauptsache, du kannst fühlen, was du da spielst.«
Jonas:
In deinen „Straßen von mir“-Videos erzählst du auch von deinem Gitarrenlehrer sowie deinem Klassenlehrer. Welche Bedeutung haben diese beiden Personen für dich?
Noah:
Mein Klassenlehrer hat mich sehr unterstützt und war darüber hinaus immer auf dem neuesten Stand in Bezug auf das, was bei mir außerhalb der Schule so abgeht. Ihm gegenüber konnte ich immer alles ganz offen ansprechen, was mich bewegt. Und wenn ich mal wieder nicht für eine Klassenarbeit lernen konnte und genau wusste, dass ich eine Fünf oder Sechs schreiben werde, weil ich am Wochenende davor drei Tage lang durchgearbeitet hatte, konnte ich ihm ehrlich sagen, was los war. Das hat viel ausgemacht.
Was meinen Gitarrenlehrer angeht, hatte ich mit ihm ebenfalls riesiges Glück. Ich hatte da jemanden erwischt, der mich so gepuscht hat, wie ich’s gebraucht habe. Nicht dadurch, einfach nur Noten abzulesen und zu spielen. Ihm war es wesentlich wichtiger, dass ich so spiele, wie ich es fühle, und wollte, dass ich nur meiner Emotion folge. Er sagte immer: „Nicht schlimm, wenn es scheiße klingt. Hauptsache, du kannst fühlen, was du da spielst.“
Übrigens: Dadurch, dass ich angefangen habe, Gitarre zu spielen, bin ich überhaupt erst aktiv an die Musik geraten: Mein Gitarrenlehrer hatte zufällig auch ein kleines Studio zuhause, wo ich meine ersten Aufnahmen machen durfte. Das hat mir sehr viel gebracht, weil ich mich plötzlich viel mehr mit Musik befasst habe – und weil es in einer Zeit passiert ist, in der ich ohnehin auf der Suche war nach etwas, was mich begeistert.


»Die wenigsten Menschen – mich eingeschlossen – hinterfragen ihr eigenes Leben.«
Jonas:
Springen wir in die Gegenwart. Du hast vor kurzem deine erste EP „Jung & Naiv“ herausgebracht, die dich – wie deine YouTube-Serie – von einer sehr nahbaren und persönlichen Seite zeigt. Der gleichnamige Song „Jung & Naiv“ wirkt dabei besonders intim. Wie schaust du selbst auf dieses Lied?
Noah:
Eigentlich wollte ich den Song über ein sehr hübsches Mädchen schreiben, das ich gerade kennengelernt hatte. Mir fiel an ihr auf, dass sie sich überhaupt nicht festlegen wollte. Immer wieder wechselte sie ihre Freundeskreise und hing mit den unterschiedlichsten Leuten ab. Das empfand ich irgendwie als Stärke: immer neue Menschen zu finden und sich an neue Situationen anpassen zu können – wie ein Chamäleon. Diese Beobachtung hat mich ziemlich beschäftigt, denn mir ist aufgefallen, dass es in unseren Persönlichkeiten gewisse Überschneidungspunkte gibt. So ist aus dem Song über sie am Ende ein Song über mich geworden, in den ich all die persönlichen Gedanken über mich selbst hineingeschrieben habe, die mir beim Nachdenken über mich selbst zugeflogen sind.
Jonas:
In dem Song gibt es die Zeile „Was uns fehlt, ist Reflexion“. Was bringt dich zu der Feststellung?
Noah:
Ich glaube, dass die Menschen einfach so sind, wie sie sind, und tun, was sie tun. Da ist etwas ganz Natürliches. Aber die wenigsten – mich eingeschlossen – hinterfragen ihr eigenes Leben. Die wenigsten denken wirklich darüber nach, welche Konsequenzen ihr eigenes Handeln haben kann, genauso wenig wie sie ihre Wirkung auf andere Menschen infrage stellen. Deshalb ist diese Zeile nicht nur eine allgemeine Aussage, sondern vor allem auch eine Frage an mich selbst.

»Was mich bewegt, ist das Gleiche wie bei vielen anderen Jugendlichen auch – nur dass ich nebenbei noch Musik mache.«
Jonas:
Dein Song „Jung & Naiv“ beginnt mit folgenden Worten: „Vielleicht sehen wir uns in zehn Jahren / Und sagen, dass am Ende alles richtig und gut war / Haben gefunden, was wir in uns gesucht haben / Blicken drauf zurück, als wir noch jung und naiv waren“. Wonach genau suchst du gerade in dir?
Noah (lächelt):
Jetzt gerade? Momentan suche ich die goldene Mitte, in der ich mich gut zwischen Arbeit und Privatleben positionieren kann. Ich suche nach einer gewissen Sicherheit in meiner aktuellen Lebenssituation und hoffe, dass ich in zehn Jahren ein bisschen Stabilität in mein Leben gebracht habe. Momentan passiert einfach wahnsinnig viel – und genauso viel steht noch in den Sternen. Die meiste Zeit denke ich über all die Dinge des Alltags nach, die auch alle anderen Menschen beschäftigen. Was mich bewegt, ist das Gleiche wie bei vielen anderen Jugendlichen auch – nur dass ich nebenbei noch Musik mache.


»Es gibt so viel zu sehen auf dieser Welt, doch alles hängt davon ab, wie abgesichert man in der Heimat ist.«
Jonas:
Wenn du einen Blick in die Zukunft wirfst: Was genau wünschst du dir für dein Leben?
Noah:
Ein Haus mit Garten vielleicht nicht unbedingt, aber eine eigene Wohnung, in der ich eine Familie gründen kann – das wäre schon schön! Ich will das alles sehr früh haben, ich will mir sehr früh Sicherheiten schaffen. Daher ist es auch mein Ziel, das Maximum aus meinem Leben herauszuholen. Je früher ich mich wirtschaftlich abgesichert habe, desto früher kann ich mich damit beschäftigen, was ich noch von der Welt erfahren kann. Es gibt so viel zu sehen auf dieser Welt, doch alles hängt davon ab, wie abgesichert man in der Heimat ist.
Davon abgesehen versuche immer, im Hier und Jetzt zu leben und das in vollem Maße zu genießen. Wir alle haben ja keine andere Chance, als das Beste aus diesem einen Leben herauszuholen. Ich bin aber auch ständig mit dem Kopf in der Zukunft, um mir selbst den Huzzle zu stellen, dass bestimmte Dinge laufen und passieren müssen. Gleichzeitig frage ich mich aber auch permanent: Braucht es das wirklich? Muss es das eigentlich? Ist es das, worum es wirklich geht? Ich habe immer mehr das Gefühl, dass die Kleinigkeiten, die so überaus wichtig sind, im Jetzt stattfinden – und die materiellen Dinge in der Zukunft. Bin ich jetzt glücklich, weil ich mit mir selbst zufrieden bin, bin ich vielleicht in der Zukunft glücklich, weil ich eine Wohnung habe, die mir meine Unterkunft sichert. Beides ist wichtig.

»Es gibt heute viel mehr junge Menschen, die darüber nachdenken, wie ihre Zukunft aussehen wird – oder ob es überhaupt eine Zukunft für sie gibt.«
Jonas:
Hast du das Gefühl, dass du in deiner Generation eher alleine stehst mit dieser Form des Reflektiertseins?
Noah:
Ganz im Gegenteil! Ich glaube, dass das Bewusstsein für das, was um einen herum geschieht, enorm zugenommen hat bei den Leuten, die so alt sind wie ich. Es gibt heute viel mehr junge Menschen, die darüber nachdenken, wie ihre Zukunft aussehen wird – oder ob es überhaupt eine Zukunft für sie gibt. Ich erlebe, wie viele meiner Freunde konkret darüber nachdenken, wie sie ihre jetzige Situation verändern können, um ihre Zukunft positiv zu beeinflussen. Und für mich sieht es so aus, als würde das immer früher einsetzen. Was übrigens alles andere als cool ist! Wenn sich 14- oder 15-Jährige darüber Gedanken machen müssen, wie man den Planeten retten kann oder wie es ihnen gelingen soll, später mal die Miete zu bezahlen, läuft etwas gewaltig schief. Solch abgefuckte Gedanken sollte man sich als junger Mensch nicht machen müssen, nirgendwo auf der Welt. Trotzdem finde ich gut, dass das passiert. Bewusstsein ist nichts Schlechtes.


»Es gibt nichts Geileres, als etwas zu entscheiden oder zu tun, nur weil man es gerade fühlt.«
Jonas:
Kommen wir nochmal „Jung & Naiv“ zu sprechen. Gerade der Begriff naiv ist in unserer Gesellschaft eher negativ besetzt. Welchen positiven Aspekt kann es haben, naiv zu sein?
Noah:
Ich liebe es, naiv zu sein! Es gibt nichts Geileres, als etwas zu entscheiden oder zu tun, nur weil man es gerade fühlt. Und nicht, weil die Umstände mit Blick in die Zukunft und in Verknüpfung mit der Vergangenheit das erfordern. Das ist alles Bullshit. Sobald du glücklich bist mit dem, was du tust, und sich das richtig anfühlt, sobald du emotionalen Mehrwert daraus ziehen kannst, ist scheißegal, was dabei herauskommt. Dieses überlegte Handeln kann einen weit bringen, macht einen aber nicht immer glücklich. Zumindest nicht mich. Ich brauche es, freigeistig zu sein.

»Oft ist es eine Verdichtung unterschiedlichster Gedanken und Gefühle, die in diesem einen Moment im Studio alle zueinander finden.«
Jonas:
Du hast für dieses Album mit einer Reihe erfahrener Writer und Producer zusammengearbeitet. Gleichzeitig schreibst du an deinen Texten auch selbst. Wie entsteht letztendlich ein echter Noah-Levi-Song?
Noah:
Ich muss gerade daran denken, wie meine Mutter immer wieder gesagt hat: „Noah, du hast am Wochenende eine Writing Session. Bereite dich doch endlich mal darauf vor!“ Aber sich auf eine Session vorzubereiten heißt nicht, sich irgendwelche Notizen zu machen. Sondern rauszugehen und irgendetwas zu erleben. Am Ende kann man eh nicht beeinflussen, welchen Vibe so eine Session hat, wie die Emotionen gerade stehen und worüber man wirklich schreiben will. Das Einzige, was funktioniert, ist, sich so viele Gedanken wie möglich zu machen, bis dann beim tatsächlichen Schreiben alles aus einem herausbricht. Ob man will oder nicht. Sobald man das Papier vor sich liegen hat und die Töne hört, ist es eine organische Sache. Jedenfalls bei mir. Das kommt ganz automatisch aus mir heraus – daher kann ich einfach nicht sagen, wie so ein Song typischerweise bei mir entsteht. Oft ist es eine Verdichtung unterschiedlichster Gedanken und Gefühle, die in diesem einen Moment im Studio alle zueinander finden und zu einem großen Ganzen werden.
Wenn ich mit anderen Songwritern zusammenarbeite, ist das oft wie eine Stunde beim Psychologen: Man setzt sich hin, ich sage, was ich mir textlich und musikalisch vorgestellt habe, und dann spricht man einfach ganz viel darüber. Gerade komme ich aus Hamburg, wo ich für eine dreitägige Writing Session war. Am ersten Tag haben wir uns erst mal für ein paar Stunden in den Garten gesetzt und über alles geredet, was uns gerade in dem Moment beschäftigt oder bedrückt hat. Nach so einem Gespräch fühlt man sich absolut frei und muss einfach nur noch machen, machen, machen. Das ist eine rein emotionale Sache, dafür gibt es kein Konzept.


»Sich bei der Arbeit so nahe zu kommen, ohne sich dabei physisch zu berühren, ist wirklich ein Phänomen.«
Jonas:
Die Leute, mit denen du zusammenarbeitest, sind oft ein ganzes Stückchen älter als du. Gibt es etwas, was du von den „alten Hasen“ gelernt hast?
Noah:
Absolut! Sobald ich mit wesentlich Älteren zusammenarbeite, kann ich sekündlich lernen und mich weiterentwickeln. Diese Leute sagen und tun Dinge, die mich sehr inspirieren. Und ich habe gemerkt, wie ich Vieles von ihnen ganz automatisch angenommen habe, ohne dass es mir in dem Moment bewusst gewesen wäre. In der Zeit, in der die Platte entstanden ist, habe ich so unendlich viel dazugelernt – nicht nur musikalisch, sondern auch menschlich. Musik verbindet auf einer ganz besonderen, intimen Ebene, ohne dass es körperlich wird. Das ist wirklich ein Phänomen: sich bei der Arbeit so nahe zu kommen, ohne sich dabei physisch zu berühren. Am Ende sind sowieso alle Musiker gleich, wir haben alle dieselben Ticks und Probleme. Daher kommt es auch nicht immer aufs Alter an. Ich habe vor kurzem beispielsweise mit einem 19-jährigen Producer zusammengearbeitet, das war eine absolut geile Zeit und gleichzeitig total entspannt. Und wir haben ein paar Tage lang wirklich coole Tracks gebaut.

»Es gehört zu mir, dass ich darüber spreche, wie es mir geht, auch in meiner Musik.«
Jonas:
Es gibt drei Arten von Musikern: die einen, die wirklich meinen, was sie in und mit ihren Songs sagen. Die anderen, die nicht meinen, was sie mit ihren Songs sagen, und die dritten, die mit ihren Songs gar nichts sagen. Erinnerst du dich, wann dir in deinem Leben zum ersten Mal eine Musikerin oder ein Musiker begegnet ist, bei der oder dem du das Gefühl hattest: Der oder die eine meint im Moment wirklich, was er oder sie gerade singt?
Noah:
Das weiß ich gar nicht genau. Auf jeden Fall ist aber die Musik von Ed Sheeran eine riesige Inspiration für mich. Vor einigen Jahren war ich zusammen mit meiner Mutter auf einem seiner Konzerte in der Berliner Max-Schmeling-Halle. Ed Sheeran stand ganz alleine mit seiner Gitarre auf der Bühne vor diesem riesigen Publikum, das hat mich sehr beeindruckt – und ich wusste, dass die Musik, die ich selbst machen wollte, auch für konkrete Inhalte stehen sollte.
Davon abgesehen erinnere mich immer daran, dass mir meine Eltern mal gesagt haben: „Bleib bei dir und verändere dich nicht, nur weil du das vielleicht bei jemand anderem siehst.“ Das habe ich mir immer zu Herzen genommen und trage es nach wie vor in mir. Es gehört zu mir, dass ich darüber spreche, wie es mir geht, auch in meiner Musik.

»In den Sozialen Netzwerken kann man nie das Richtige tun – egal, wie man sich entscheidet.«
Jonas:
Du hast dir in den letzten Jahren eine veritable Reichweite in den Social Networks aufgebaut. Welchen Stellenwert hat diese große Online-Bühne für dich?
Noah:
Social Media macht auf jeden Fall den Kopf kaputt. Das ist eine Welt, die mich nie wirklich weitergebracht hat. Noch vor wenigen Jahren habe ich mir wahnsinnig viele Gedanken darüber gemacht, was ich dort posten soll und wie ich dadurch wirke. Aber das bringt einem nichts. Social Media ist, was es ist. Man kann dort weder die Reaktionen noch die Auswirkungen beeinflussen, das sind alles Personen hinter Zahlen – egal, um welche App oder welches Netzwerk es sich handelt.
Für mich erwächst aus dieser Reichweite eine riesige Verantwortung. Und die nehme ich ernst. Trotzdem fühle ich mich immer in einem Zwiespalt gefangen. Auf der einen Seite will ich den Leuten zeigen, wie ich wirklich bin und was ich tue. Aber gleichzeitig frage ich mich auch, ob sich dadurch nicht irgendwer gestört fühlt. In den Sozialen Netzwerken kann man nie das Richtige tun – egal, wie man sich entscheidet. Ich wünschte, das alles würde nicht existieren. Aber es ist nun mal da. Und man findet dort ja auch Inspiration – aber das ganze Konzept dahinter basiert letztendlich nur auf Werbung. Alles, was man auf Social Media sieht, ist nicht einfach da, um zu sein – es ist da, um dich zu verändern: um dich zum Lachen bringen, zum Weinen, zum Nachdenken, zum Neiden. Das finde ich irgendwie nicht so geil.
Jonas:
Und trotz Hunderttausenden von Followern kann es trotzdem passieren, dass man sich einsam fühlt…
Noah:
Ja, total!

»Auch wenn dich andere Menschen vielleicht nicht verstehen können, können sie dir immer noch beistehen.«
Jonas:
In welchen Situationen begegnet dir selbst diese Einsamkeit?
Noah:
Wenn ich das Gefühl habe, dass ich in meiner Situation alleine bin und dass es keine Person gibt, die das gerade nachvollziehen kann. Jeder Mensch ist einzigartig. Er fühlt einzigartig und denkt einzigartig. Das alleine impliziert, dass jeder mit sich und seiner Situation alleine ist. Damit will ich nicht sagen, dass man dabei auch zwangsläufig alleine dasteht. Auch wenn dich andere Menschen vielleicht nicht verstehen können, können sie dir immer noch beistehen. Und dir weiterhin Kraft und Hoffnung schenken. Genau das ist es doch, was menschliche Beziehungen so wichtig macht.
Jonas:
Was ist deiner Meinung nach das beste Rezept gegen Einsamkeit?
Noah:
Für mich war es immer Musik. Aber ich kann anderen kein Rezept dafür geben, auch wenn ich es wünschte. Man muss sich das suchen, was einen glücklich macht. Etwas, bei dem man im Hier und Jetzt ist. Und was einen erfüllt. Nur das kann einen Menschen aus der Einsamkeit ziehen.
Dieses Editorial wurde auf dem Gelände der FAHRBEREITSCHAFT fotografiert, einer Film- und Foto-Location in Berlin-Lichtenberg.
#noahlevi #interview #jungundnaiv #dannyjungslund #jonasmeyer #mypmagazine #fahrbereitschaft
Mehr von & über Noah Levi:
noah-levi.de
instagram.com/noahlevi
facebook.com/noahleviofficial
Interview & Text: Jonas Meyer
Fotografie: Danny Jungslund
Milky Chance
Interview — Milky Chance
Wellenreise
Auf ihrem neuen Album vereinen Milky Chance das Beste aus verschiedenen Welten. Auch im wahren Leben sind Clemens Rehbein und Philipp Dausch vom Zwiespalt getrieben. Wir trafen das Dream-Team auf einen Whisky in Kreuzberg.
12. November 2019 — MYP N° 27 »Heimat« — Interview & Text: Niklas Cordes, Fotos: Steven Lüdtke

Es muss Liebe sein: Selbst bei der Auswahl des Drinks sind sich die Frontmänner der Folktronica-Band Milky Chance einig. Whisky, bitte nicht zu rauchig, soll beim vereinbarten Gespräch in der Bar „Trödler“ die Stimmung lockern – und die Zungen. Es ist der erste Promotion-Tag seit anderthalb Jahren, den Clemens Rehbein und Philipp Dausch absolvieren. Der Grund: ihr mittlerweile drittes Album mit dem Titel „Mind The Moon“, das am 15. November erscheint.
Vorher war es etwas ruhiger geworden um die 26-Jährigen, die 2013 mit „Stolen Dance“ einen weltweiten Megahit veröffentlichten. Es folgten Auftritte in US-Talkshows, ein Echogewinn, ein zweites Album und Touren durch ganz Europa, Nordamerika, Australien, Neuseeland und Südafrika. Viel Erfolg in kürzester Zeit für die Jungs aus Kassel, die seit der Oberstufe gemeinsame Sache machen.
Zeit für eine Verschnaufpause, Pflege der Gesundheit und des Privatlebens. Doch mit der Musik ist es wie mit jeder anderen Droge: Wer ihr einmal verfallen ist, der kommt nicht mehr von ihr los. Also stürzen sich Rehbein und Dausch wieder kopfüber in die Fluten aus Fans, Studioarbeit und Tourleben – denn wie sie auf der Erfolgswelle reiten können, ohne von ihr verschluckt zu werden, haben sie in den vergangenen Jahren gelernt, wie sie uns im Interview verraten.

»Wir feiern Release und Geburtstag gleichzeitig.«
Niklas:
Am 15. November erscheint das neue Album. Wie feiert ihr euer mittlerweile drittes Baby?
Philipp:
An diesem Tag werden wir für Promo-Zwecke in Stuttgart sein, meiner Heimatstadt. Und ich habe an dem Tag Geburtstag!
Clemens:
Wir feiern also Release und Geburtstag gleichzeitig.
Niklas:
Das Album trägt den Titel „Mind The Moon“. Was hat es damit auf sich?
Clemens:
Die Titelfindung war nicht so leicht. Letzen Endes fiel die Entscheidung in Norwegen.
Philipp:
In der letzten Phase der Fertigstellung waren wir dort in einem Studio, das direkt am Wasser lag. Das hat uns beim Schreiben beeinflusst und inspiriert. Dieser Bezug zum Meer, zum Licht. In Norwegen wurde es zu der Zeit erst um Mitternacht dunkel. Eigentlich wollten wir es „Blue Mind“ nennen, bezogen auf diese mystische Kraft, die wir gespürt haben.
Clemens:
In unserem Song „Daydreaming“ gibt es die Line „might be the moon“, das fanden wir letztendlich treffender. Daraus wurde dann „Mind The Moon“, das hat als Aufforderung mehr Aussagekraft.


»Der Mond ist ein wiederkehrendes Symbol, das sich in vielen unserer Lieder finden lässt.«
Niklas:
Seid ihr denn mondsüchtig? Hattet ihr beim letzten Vollmond Schlafschwierigkeiten?
Clemens: Nein, zum Glück nicht. Aber der Mond ist ein wiederkehrendes Symbol, das sich bei in vielen unserer Lieder finden lässt, auch schon auf dem letzten Album.
Niklas:
Wenn es nicht der Vollmond ist, was raubt euch sonst den Schlaf? Der Erfolgsdruck?
Philipp:
Nicht wirklich. Das war eher beim zweiten Album so, als wir sehr viel getourt sind und wir gerade Anfang zwanzig und im Gefühlschaos waren.
Clemens:
Wir haben damals eben versucht, die Erfolgswelle des ersten Albums nicht abebben zu lassen, da war schon sehr viel los.
Philipp:
Es fühlt sich gerade alles viel freier an, wir haben die letzten anderthalb Jahre keine Tour gemacht.


»Ideen zu sammeln und sie dann mit Abstand zu betrachten, das hat schon seine Vorteile.«
Niklas:
Manche Musiker sind produktiver in Stresssituationen, andere können unter Druck nicht kreativ sein. Wie ist das bei euch?
Clemens:
Es hält sich die Waage. Viele Songideen kamen uns auch schon auf Tour im Bus. Aber generell ist es geiler, sich Zeit nehmen zu können, wenn man neue Musik aufnimmt. Ideen zu sammeln und sie dann mit Abstand zu betrachten, das hat schon seine Vorteile.
Philipp:
Kreativität in Form von Ideen kann aus beidem herauskommen, aber letztendlich geht es um die Kraft, diese auch umzusetzen. Und die hat man klar, wenn man nicht unter Druck steht.
»Wir sind entspannter und gelassener geworden.«
Niklas:
Ihr habt zu Anfang eurer Karriere gesagt, dass ihr lieber eure Musik anstelle eurer Personen in den Vordergrund stellt. Fühlt ihr euch jetzt, sieben Jahre später, mehr als Rockstars?
Philipp und Clemens:
Nee!
Clemens:
Eher im Gegenteil. Damals, als diese erste große Attention-Welle über uns kam, waren wir noch in dem Strudel, alles war ganz crazy. Jetzt ist es eher alles gesetzter, wir sind entspannter und gelassener geworden.
Philipp:
Als ich mal in Australien das Surfen ausprobiert habe, waren da auch diese großen Drei-Meter-Wellen. Ich habe mich nur überschlagen, Salzwasser geschluckt und mich übergeben. Beim zweiten Mal habe ich die Ein-Meter-Wellen getestet, da hat es dann angefangen, Spaß zu machen. Damit lässt sich das ganz gut vergleichen. Wir sind sicherer geworden.

»Wir beide haben Kinder, was einen großen Einfluss auf unser Denken und Handeln hat.«
Niklas:
Würdet ihr sagen, dass diese Gelassenheit vielleicht auch dem Älterwerden geschuldet ist?
Clemens:
Eher der Erfahrung.
Philipp:
Wir beide haben auch Kinder, was natürlich ebenfalls einen großen Einfluss auf unser Denken und Handeln hat.
Clemens:
Wir sind richtig spießig geworden (lacht)!
Niklas:
Zumindest hat einer von euch dem Spießigwerden mit einem Umzug nach Berlin entgegengewirkt…
Philipp:
Ich bin immer noch stark mit Kassel verbunden, aber meine Freundin hat hier einen Job gefunden. Das hat also pragmatische Gründe. Ich mag es hier, aber ich bin eigentlich kein Großstadt-Typ.

»Wir haben keine Kuscheldecken oder so etwas. Aber wir haben ja uns!«
Niklas:
Aber ihr habt schon einige Metropolen bereisen dürfen. Habt ihr auf Tour ein Stück Heimat dabei?
Clemens:
Nein, keine Kuscheldecken oder so etwas. Aber wir haben ja uns!
Philipp:
Und unser Bandmitglied Toni und den Rest der Crew natürlich.
Niklas:
Auf „Mind The Moon” vereint ihr unterschiedliche Welten: smoothen Minimalismus und Panorama-Pop. Man kann den Eindruck gewinnen, dass ihr auch sonst immer einen kleinen Spagat lebt.
Clemens:
Ja, wir sind Gradwanderer. Ich habe in den vergangenen Jahren immer in zwei Modi gelebt, im Tour-Modus und im Zuhause-Modus. Das sind zwei Welten, zwischen denen man hin- und herswitcht.
Philipp:
Zuhause sind die Verantwortungen und das Umfeld ja ganz andere. Man nimmt verschiedene Rollen ein. Aber auch musikalisch waren wir schon immer gerne in den Zwischenräumen, zwischen den Stilen.

»Mein Opa sagt immer, er sei zufrieden. Das finde ich ganz zutreffend.«
Niklas:
Eure Lieder haben meistens einen fröhlichen Beat, die Texte stehen dazu im Kontrast, wirken melancholisch. Würdet ihr euch als glückliche Menschen bezeichnen?
Clemens:
Puh, das ist schwierig. Die Musik ist jedenfalls ein Ventil für uns, da können wir viel kanalisieren.
Philipp:
Wir sind beide melancholische Typen. Das Leben besteht ja aus vielen Baustellen – wenn du dir manche anschaust, bist du glücklich, bei anderen ist es nicht so. Mein Opa sagt immer, er sei zufrieden. Das finde ich ganz zutreffend. Glücklich ist für mich ein extremes Wort.
Clemens:
Zufrieden, das können wir unterschreiben. Aber auch da kommt es auf die Bereiche an (lacht). Wir fühlen das Prinzip der Dualität jedenfalls auf allen Ebenen, in der Musik und im Gefühlsleben.
Niklas:
Wenn ihr jedem eurer drei Alben ein Gefühl oder Begriff zuordnen müsstet, welche wären das?
Philipp:
Puh, naja beim ersten wäre das dann wohl Aufbruch, aber auch Naivität.
Clemens:
Das zweite steht für Sturm und Drang, aber auch für Widerstände, würde ich sagen.
Philipp:
Und das dritte für Freiheit, Reife.


»Wir verstehen teilweise erst jetzt den Erfolg, der uns damals zuteilwurde.«
Niklas:
Gab es eigentlich den einen Punkt, an dem ihr für euch gemerkt habt, „wir haben es echt geschafft“?
Philipp:
Ich muss sagen, dass wir teilweise erst jetzt den Erfolg verstehen, der uns damals besonders zu Anfang zuteilwurde. Welches Glück einem da auch als Musiker widerfahren ist! Andere haben in den Endzwanzigern andere Probleme, besonders was die Jobfindung angeht.
Clemens:
Wir waren teilweise auch überfordert vom Erfolg. Als im Raum stand, das erste Mal nach Amerika zu gehen, waren wir uns beide gar nicht sicher, ob wir das wollen und schaffen können. Wir hatten echt Schiss.


»Als im Raum stand, das erste Mal nach Amerika zu gehen, waren wir uns beide gar nicht sicher, ob wir das wollen und schaffen können.«
Niklas:
Gab es denn einen Plan B?
Philipp:
Nicht wirklich. Ich war auch nirgendwo eingeschrieben für einen Studiengang. Wir waren echt planlos.
Clemens:
Obwohl, wir wollten eigentlich lange reisen. Aber das hat sich damit ja dann auch erübrigt.
Niklas:
Habt ihr auf euren Touren einen Sehnsuchtsort für euch entdecken können?
Clemens:
Neuseeland war für mich wundervoll. Da haben wir auch zwei Wochen privat verbracht.
Philipp:
Ich war von Afrika sehr beeindruckt und will unbedingt wieder mal zurück.


»Wir sind ein richtiges Vorzeige-Ehepaar!«
Niklas:
Das Tourleben kann ganz schön kräftezehrend sein. Wie haltet ihr euch gesund?
Philipp:
Ich muss ab jetzt jeden Morgen meine Übungen machen, weil ich dieses Jahr einen Bandscheibenvorfall hatte. Und man muss sich gesund ernähren, sonst wird man müde und schlaff.
Clemens:
Wir wollen bei der nächsten Tour mal Yoga ausprobieren, mal sehen, wie das klappt.
Niklas:
So auf engstem Raum im Tourbus lernt man sich ja nochmal anders kennen. Liebt ihr auch die Macken aneinander?
Clemens:
Viel Zeit auf engem Raum miteinander zu verbringen, war nie ein Problem für uns.
Philipp:
Verrückt eigentlich, oder?
Clemens:
Wir sind ein richtiges Vorzeige-Ehepaar!

#milkychance #mindthemoon #interview #niklascordes #stevenluedtke #mypmagazine
Mehr von & über Milky Chance:
milkychance.net
instagram.com/milkychance_official
facebook.com/milkychancemusic
Interview & Text: Niklas Cordes
instagram.com/niklascordes
twitter.com/niklascordes
niklas@myp-magazine.com
Fotografie: Steven Lüdtke
Ludwig Simon
Interview — Ludwig Simon
Zeit der Veränderung
Im Kino ist Ludwig Simon gerade im Wendedrama »Im Niemandsland« zu sehen – und auf Netflix in der Serie »Wir sind die Welle«. Wir haben den 21-jährigen Schauspieler in New York City getroffen, wo er sich zur Zeit an einer Schauspielschule weiterbildet.
7. November 2019 — MYP N° 27 »Heimat« — Interview & Text: Jonas Meyer, Fotos: Danny Jungslund

Wie fühlt sich eine Zeit an, die in unzähligen Familien erzählt, in unzähligen Geschichtsbüchern abgehandelt und in unzähligen Filmen aufbereitet wird? Und die am Ende doch nicht wirklich greifbar wird, wenn man sie selbst nicht erlebt hat?
Die Zeit um die Wende ist so eine. Als am Abend des 9. November 1989 die Mauer fiel, hatten sich Millionen von DDR-Bürgern nicht nur friedlich ihre Freiheit erkämpft. Sie waren auch damit konfrontiert, dass das Land, in dem sie geboren und aufgewachsen waren, in dem sie ihren Schulabschluss gemacht hatten, in dem sie einen Arbeitsplatz fanden, in dem sie geheiratet hatten, in dem sie Eltern und Großeltern wurden, in dem sie in Rente gingen, dass dieses Land ein knappes Jahr später nicht mehr existieren sollte. Was das mit 16 Millionen Menschen macht, diese Frage wurde im vereinten Deutschland viel zu spät gestellt – und ist heute, 30 Jahre nach dem Mauerfall, brennender als je zuvor.
Dass mit dem Fall der Mauer nicht plötzlich alles gut wurde, vor allem nicht im Privaten, damit beschäftigt sich Regisseur Florian Aigner in seinem neuen Film „Im Niemandsland“. Der Streifen, der ab dem 7. November in den Kinos laufen wird, spielt im Berlin des Sommers 1990 und erzählt eine klassische Liebesgeschichte à la „Romeo und Julia“, in deren Zentrum die Teenager Thorben und Katja stehen. Thorben, gespielt von Ludwig Simon, ist im Ostteil der Stadt aufgewachsen und lebt mit seiner Familie seit Jahren in einem Haus, auf das Katjas Vater Anspruch erhebt. Dieser wuchs selbst in diesem Haus auf, musste es aber im Kindesalter verlassen, als seine Familie vor dem SED-Regime in den Westen floh. Nach der Flucht wurde die Familie enteignet, das Haus ging in sogenanntes Volkseigentum über und wurde Thorbens Eltern zugesprochen.
Wie also umgehen mit so einer ungeklärten Situation? Die „Gemeinsame Erklärung der Regierungen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik zur Regelung offener Vermögensfragen vom 15. Juni 1990“ fand eine Antwort – und etablierte den Grundsatz „Rückgabe vor Entschädigung“. Eine gesetzliche Chance für Katjas Vater, sein Elternhaus zurückzugewinnen. Und eine Katastrophe für Thorben und seine Familie, das langjährige Zuhause zu verlieren. So bricht der Film einen bürokratischen Sachverhalt auf die individuelle Ebene herunter, auf der – neben dem Übergang in einen neuen Staat und eine neue Gesellschaftsform – die alltäglichen Probleme selbstverständlich nicht aufhören zu existieren.
Springen wir vom Ostberliner Juni des Jahres 1990 in den November 2019 – und zwar den in New York City. Ludwig Simon verbringt hier gerade einige Monate, um seine Fähigkeiten an einer renommierten Schauspielschule weiterzuentwickeln. Der 21-Jährige, der neben seiner Rolle im Film „Im Niemandsland“ auch seit dem 1. November in der Netflix-Serie „Wir sind die Welle“ zu sehen ist, führt unseren Fotografen Danny Jungslund am frühen Morgen auf ein Flachdach im Stadtteil Brooklyn und präsentiert ihm den Blick auf die Skyline von Manhattan. Eine Aussicht, an die Millionen DDR-Bürger nicht zu träumen gewagt hätten. Und die mit der Nacht des 9. November 1989 zumindest in den Bereich des Möglichen gerückt ist.

»Mit diesem Projekt habe ich für mich nochmal ein ganz eigenes Gefühl für die Thematik entwickelt.«
Jonas:
Du bist 1997 geboren, acht Jahre nach dem Mauerfall. Hast du durch die Arbeit an dem Film etwas über die Zeit nach der Wende gelernt, was du vorher noch nicht wusstest?
Ludwig:
Das Meiste, was ich von dieser Zeit weiß, habe ich durch Erzählungen meiner Eltern, Großeltern oder Lehrer aufgeschnappt. Oder aus Filmen, die sich mit der Zeit befassen, zum Beispiel „Als wir träumten“, „Wir sind jung. Wir sind stark.“ oder „Good bye, Lenin!“. All diese Geschichten waren immer schon sehr spannend, aber ich hatte nie echte Bilder vor Augen oder konnte das Erzählte wirklich nachempfinden – einfach, weil ich die Wendezeit nicht selbst miterlebt hatte.
Daher bin ich sehr dankbar, dass ich mich durch diesen Film zum ersten Mal selbst in diese Thematik hineinfallen lassen durfte – alleine schon wegen der Klamotten, die meine Figur Thorben getragen hat. (grinst) Und ich bin dankbar, dass ich mit einem Regisseur wie Florian Aigner zusammenarbeiten durfte, der diese Wendezeit selbst erlebt hat. Mit diesem ganzen Projekt habe ich für mich nochmal ein ganz eigenes, nicht nur filmisches Gefühl für die Thematik entwickelt. Und ich habe viel gelernt, zum Beispiel über die Enteignungspraxis der DDR. Oder darüber, was nach der Wende mit den Leuten passiert ist, die als „Inoffizielle Mitarbeiter“ für die Stasi tätig waren und aufgeflogen sind. Diese vielen großen und kleinen Konflikte liefern unendliches Futter für Erzählungen und machen diese auch so spannend.

»Es geht darum, welche Familie letztendlich das Haus bekommt und darin wohnen darf – die ostdeutsche oder die westdeutsche.«
Jonas:
Euer Film macht gleich mehrere Konfliktfelder auf, vieles ist ungeklärt: die Eigentumsverhältnisse rund um das Wohnhaus, die persönlichen Beziehungen in den Familien, die Vergangenheiten einzelner Protagonisten. An welchen Stellen ist deiner Meinung nach der Film in der Lage, in all dem Schlamassel am meisten Orientierung zu geben?
Ludwig:
In diesem Schlamassel, wie du es nennst, gibt es einen Hauptkonflikt: den Streit um das Haus. Dieser Konflikt erzeugt diverse Nebenkonflikte, die erst dann aufgelöst werden können, wenn auch die Frage geklärt ist, welche der beiden Familie letztendlich das Haus bekommt und darin wohnen darf – die ostdeutsche oder die westdeutsche. Ein gutes Beispiel für einen solchen Nebenkonflikt ist die Affäre, die Katjas Mutter mit ihrem Nachbarn eingeht. Dadurch, dass sich ihr Mann so sehr in dem Ziel verbeißt, für sich und seine Familie das Haus zu erkämpfen, verliert er seine eigene Frau immer mehr aus den Augen – die sich dann Trost bei jemand anderem sucht.

»Als Kind musste er erleben, wie seine Familie nach der Flucht in den Westen vom SED-Regime enteignet wurde.«
Jonas:
Katjas Eltern wirken ohnehin wie zwei Schlüsselfiguren in dem Film. Während der Vater nach Gerechtigkeit und Wiedergutmachung sucht, wünscht sich die Mutter endlich Ruhe. Damit stehen sie für zwei grundlegend verschiedene Muster, mit der Vergangenheit umzugehen: Aufarbeitung oder Schlussstrich. Welche der beiden Charaktere verstehst du besser? Auf welche Seite würdest du dich persönlich schlagen?
Ludwig:
Beide Figuren haben ganz bestimmte Motivationen für ihr jeweiliges Verhalten. Den Vater treibt seine eigene Geschichte an, da er in diesem Haus aufgewachsen ist und als Kind erleben musste, wie seine Familie nach der Flucht in den Westen vom SED-Regime enteignet wurde. Das kann Katjas Mutter wahrscheinlich emotional gar nicht nachvollziehen, da sie dieses Trauma nicht selbst erlebt hat. Sie sieht nur ihre Ehe in Gefahr, da ihr Mann immer mehr den Blick für sie verliert. Und das ist für sie persönlich ein ebenso großes Drama wie die Hausangelegenheit für ihren Mann. Daher würde ich da gar nicht urteilen wollen, ich kann beide Figuren total gut verstehen – auch weil sie von Andreas Döhler und Lisa Hagmeister so gut gespielt werden.
Wenn ich allerdings in meinem eigenen, realen Leben mit so einer Situation konfrontiert wäre, würde ich versuchen, so wenig Reibung wie möglich zu erzeugen.

»Dieses ganze Ossi-Wessi-Ding ist mir nicht ganz verborgen geblieben.«
Jonas:
Neben all den Konflikten macht der Film auch diverse Ossi- und Wessi-Klischees sichtbar, die sich über all die Jahrzehnte in den Köpfen der gesamtdeutschen Gesellschaft festgesetzt haben. Nimmst du solche Klischees in deinem persönlichen Alltag überhaupt noch wahr – im Jahr 30 nach dem Mauerfall?
Ludwig:
Gott sei Dank bin ich mit diesen Klischees nicht mehr aufgewachsen. Und im Jahr 2019 bin ich einfach nur ein junger Mensch in einer anderen Zeit, in der mir das kaum noch begegnet. Aber wenn ich die Zeit damals selbst erlebt hätte, hätte ich vielleicht ähnliche Denkmuster entwickelt, wer weiß.
Trotzdem ist mir dieses ganze Ossi-Wessi-Ding nicht ganz verborgen geblieben. Beim Fußball zum Beispiel ist mir das immer besonders stark aufgefallen. Ich habe lange Zeit in einer Mannschaft aus Pankow gespielt, sprich aus dem ehemaligen Ostberlin. Wenn wir dann mal für ein Spiel in den tieferen Westen gefahren sind, gab’s dort permanent irgendwelche Ossi- und Wessi-Sprüche, vor allem von den jeweiligen Trainern.
Ich habe eben ja bereits erklärt, dass ich das Meiste über die Wendezeit von Erzählungen meiner Eltern, Großeltern und Lehrer weiß. Da wurden natürlich auch Unterschiede zwischen Ost und West thematisiert, allerdings immer mit einer sachlichen Erklärung und nie auf klischeehafte Art und Weise.

»Entweder du machst hier richtig Kohle – oder halt nicht. Und dann liegst du ganz schnell nachts auf der Straße.«
Jonas:
Der Begriff Niemandsland hat im Film gleich mehrere Bedeutungsebenen. Er bezieht sich einerseits auf den ehemaligen Grenzstreifen zwischen Ost- und Westberlin, der Thorben und Katja als Treffpunkt gilt. Er kann aber auch als Begriff für die vielen Schwebezustände verstanden werden, die der Film erzählt. Wo in deinem Leben, in unserer Gesellschaft oder vielleicht sogar auf dieser Welt siehst du heute solche Niemandsländer?
Ludwig:
Ich habe das Gefühl, dass die Schere zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen immer größer wird – zwischen rechts und links zum Beispiel. Gerade dass sich in unserem Land die extremen politischen Ränder wieder so sehr festigen können, finde ich bei der deutschen Historie erschreckend. Es werden plötzlich wieder Themen besprochen, die für mich aus moralischer Sicht überhaupt nicht mehr diskutiert werden dürften.
Aber auch zwischen arm und reich wird die Kluft immer größer, die Mittelschicht verschwindet, und das überall auf der Welt.
Darüber hinaus gibt es nach wie vor Rassentrennung. Das ist mir zum ersten Mal so richtig bewusst geworden, als ich 2018 nach Südafrika gereist bin. Obwohl die Apartheid dort eigentlich offiziell abgeschafft wurde, gibt es in Südafrika nach wie vor Gegenden, in denen fast nur Weiße leben – oft in reichen Gated Communities. Dagegen lebt ein großer Teil der Schwarzen Bevölkerung in Townships am Stadtrand – in ärmlichsten Verhältnissen. Die Rassentrennung existiert damit de facto weiter.
Übrigens kann man auch in Berlin immer mehr beobachten, wie der ärmere Teil der Bevölkerung, der sich die steigenden Mieten nicht leisten kann, an den Stadtrand gedrängt wird. Und das ist in New York nochmal eine ganz andere Liga. Entweder du machst hier richtig Kohle – oder halt nicht. Und dann liegst du ganz schnell nachts auf der Straße. Da ist doch irgendwo ein riesiger Fehler im System!

»Am Set konnten wir erleben, wie sich der fiktionale Stoff der Serie und die Realität immer nähergekommen sind.«
Jonas:
Kritik am Kapitalismus ist auch ein zentrales Thema der Netflix-Serie „Wir sind die Welle“, in der du seit dem 1. November zu sehen bist. Haben die Arbeiten an der Serie sowie am Film „Im Niemandsland“ deinen Blick auf die Gesellschaft verändert?
Ludwig:
Die Idee für die Serie wurde vor etwa zwei Jahren ins Leben gerufen, gedreht haben wir Anfang 2019. Für mich war es krass zu sehen, wie sich – parallel zu den Dreaharbeiten – in der realen Welt ähnliche Protestbewegungen entwickelt haben, etwa „Fridays for Future“ oder „Extinction Rebellion“. Alleine das Engagement für den Klimaschutz ist in wenigen Monaten so groß geworden, dass wir quasi am Set erleben konnten, wie sich der fiktionale Stoff der Serie und die Realität immer nähergekommen sind. Das liegt unter anderem aber auch daran, dass die Entwickler von „Wir sind die Welle“ im Vorfeld an Schulen gegangen sind, um persönlich von den Schülerinnen und Schülern zu erfahren, welche konkreten Themen sie antreiben.

Was ich aus diesen beiden Projekten für mich persönlich mitnehme, ist eine tiefe Dankbarkeit – dafür, dass ich überhaupt die Möglichkeit habe, so etwas in meinem Leben zu machen. Und gerade mit dem Wissen, dass es viele Menschen auf der Welt gibt, die diese Möglichkeiten nicht haben oder die gar nicht wissen, dass es solche Möglichkeiten überhaupt gibt, habe ich für mich erkannt, dass ich mein Leben umso mehr schätzen sollte. Und dass ich die Möglichkeiten, die sich mir bieten, umso mehr nutzen muss – weil sie ein Privileg sind. Don’t take it for granted!

»Ich bin jemand, der sehr viel Musik teilt.«
Jonas:
Michelle Barthel, die in „Wir sind die Welle“ an deiner Seite steht, hat mir verraten, dass du neben der Schauspielerei eine weitere große Leidenschaft hast: die Musik. Im Film „Im Niemandsland“ gibt es eine Szene, in der du Katja ein eigens für sie erstelltes Mixtape schenkst, das sie auf ihrem Walkman abspielt. Diese Mixtape-Kultur ist heute in Zeiten von Spotify und Co. mehr oder weniger ausgestorben. Dabei gibt es nichts Schöneres, als einem Menschen Musik zu schenken…
Ludwig:
Absolut! Aber dafür kann man heute für jemanden eine Spotify-Liste zusammenstellen, das mache ich total gerne. Und wenn ich auf einen geilen Song stoße und mit diesem Lied einen bestimmten Menschen in Verbindung bringe, schicke ich der Person den Song als Link. Ich bin jemand, der sehr viel Musik teilt. Und ich mache auch selbst ein bisschen Musik und schreibe Texte dazu. Manchmal richten sich diese Songs sogar an ganz bestimmte Menschen. Und wenn ich genug Mut zusammen habe, spiele ich ihnen die auch vor. (grinst)

»Wenn man selbst so angenommen werden möchte, wie man ist, sollte man das auch mit anderen tun.«
Jonas:
Im Film gibt es eine Person, zu der deine Figur Thorben eine besondere Beziehung hat: sein Handballtrainer Maik, der ihm immer wieder gut gemeinte Ratschläge und Lebensweisheiten mitgibt, wie etwa: „Wer sich nicht anpasst, geht unter.“ Kannst du persönlich diesem Satz etwas abgewinnen?
Ludwig:
Die Fähigkeit zur Anpassung ist etwas, was zumindest mir in meinem bisherigen Leben total geholfen hat. Die braucht man ja schon in der Schule. Wenn man dort in jungen Jahren Schwierigkeiten hat sich anzupassen, fällt einem alles viel schwerer. Ich bin sehr froh, dass mir meine Eltern da einiges an Rüstzeug mitgegeben haben – etwa die Überzeugung, dass jeder Mensch Respekt verdient. Wenn man selbst so angenommen werden möchte, wie man ist, sollte man das auch mit anderen tun. Daher habe ich immer versucht, auch auf andere zu achten und mich an ihre Bedürfnisse anzupassen. Wenn ich allerdings gemerkt habe, dass jemand in einer Gruppe gemobbt wurde, konnte ich mich überhaupt nicht anpassen – so etwas ging mir total gegen den Strich.
Anpassungsfähigkeit hat für mich übrigens auch etwas damit zu tun, offen zu sein und sich nicht hinter seinen festgefahrenen Mustern zu verstecken. Wir sehen in unserer Welt, dass alles immer in Bewegung ist und sich permanent ändern kann. Ich habe für mich gelernt, dass man einen besseren Zugang zu allem finden kann, wenn man dieser Bewegung einen gewissen Raum lässt und sich nicht zu sehr versteift.

»Ich habe gemerkt, dass es nicht so viel bringt, wenn man den Leuten erzählt, was sie zu tun haben.«
Jonas:
Als Thorben und Katja in Trainer Maiks Auto sitzen, lässt er sie wissen: „Ihr beide seid die Zukunft, ihr bestimmt, wo’s langgeht.“ Wenn du diesen Satz auf dein eigenes Leben überträgst: Hast du persönlich das Gefühl, dass du und deine Generation die Zukunft maßgeblich beeinflussen könnt? Oder fühlst du dich eher machtlos?
Ludwig:
Dieser Satz erinnert mich extrem an ein Zitat aus dem Film „School of Rock“: „I believe that the children are the future. Now, you can teach them well, but you have gotta let them lead the way.” Ich finde es allerdings immer etwas schwierig, von mir und meiner Generation zu sprechen. Wie soll ich persönlich einen Überblick darüber haben, was bei Millionen anderer junger Menschen auf dieser Welt so abgeht? Dementsprechend fühle ich mich auch nicht dazu in der Lage, ein Sprachrohr für die gesamte Generation zu sein.
Das Einzige, was ich sicher weiß, ist, dass ich selbst meine eigene Zukunft bestimmen kann – und zwar indem ich versuche, aus mir das bestmögliche Ich zu machen und für andere ein gutes Beispiel zu sein. Ich glaube, nur so kann ich selbst den bestmöglichen Beitrag leisten, damit unsere Zukunft gut wird. Ich habe gemerkt, dass es nicht so viel bringt, wenn man den Leuten erzählt, was sie zu tun haben. Viel einfacher ist es, wenn man versucht, selbst ein gutes Vorbild zu sein.

»Ob ich nach Berlin zurückkomme, steht noch in den Sternen.«
Jonas:
Du wirst noch bis Ende Dezember in New York bleiben und kommst dann zurück nach Berlin…
Ludwig:
Ob ich dann nach Berlin zurückkomme, steht noch in den Sternen. Gerade reise ich wahnsinnig gerne – vielleicht geht’s daher zuerst noch irgendwo anders hin. Vor knapp zwei Jahren bin ich in meine erste eigene Wohnung gezogen, allerdings war ich da nie so wirklich oft. Mein Wohnzimmer war eher mein Rucksack. Aus diesem Grund habe ich die Wohnung bald wieder gekündigt und reise jetzt nur noch mit diesem riesigen Rucksack durch die Welt, in dem alles drin ist, was ich brauche. Damit komme ich gerade ziemlich gut zurecht. Mal schauen, wohin mich mein Rucksack noch so trägt.
Jonas:
Was nimmst du aus New York City für dich persönlich mit – und was lässt du gerne dort?
Ludwig:
New York ist eine wahnsinnig inspirierende Stadt, alles fließt hier extrem schnell, und wenn man einmal hier ist, taucht man in diesen Flow sehr schnell ein. Zumindest für mich fühlt sich das überaus positiv an und macht sehr viel Spaß. Wenn ich an einem so inspirierenden Ort bin, gibt es so viele Dinge, die mich in meiner Kreativität des Schauspielens erweitern. Ich merke hier immer wieder, dass das, was ich vielleicht bisher über das Spielen gedacht habe, für mich gar nicht so funktioniert. Und ich erkenne, woran es gelegen hat, wenn ich mich früher für etwas kritisiert habe.
Was ich also mitnehme aus New York, sind wirklich existenzielle Fragen, denn ich will dieses Schauspiel-Ding einhundertprozentig durchziehen. Ich habe so viel dazugelernt und versuche, das alles mitzubringen. Genauso würde ich aber auch unzählige Dinge hierlassen – etwa die Muster, wie ich vorher etwas umgesetzt habe.
Man kann es aber auch philosophischer und spiritueller sehen (lacht): Es ist alles in Bewegung, und manchmal hat man Phasen, in denen man denkt: Ey, es bewegt sich gerade nicht so viel. Aber auch in diesen Momenten bewegt sich zumindest irgendetwas. Und selbst wenn es sich nicht gut anfühlt, gehört es dazu und wird sich, wenn man da rauskommen will, irgendwann auch zu etwas Gutem und Neuem verändern. Man muss nur dafür offen sein. Diese Zeit der Veränderung erleben zu können und sich in Geduld zu üben, bis etwas Neues kommt, ist eine gute Lektion.

#ludwigsimon #interview #imniemandsland #wirsinddiewelle #netflix #dannyjungslund #jonasmeyer #mypmagazine
Interview & Text: Jonas Meyer
Fotografie: Danny Jungslund
Martina Geng
Reportage — Martina Geng
Geteiltes Land, geteiltes Herz
1971 verliebt sich Martina Geng in der DDR in einen Westdeutschen – und bekommt die Härte des SED-Staats zu spüren. Nach über zwei Jahrzehnten erlebt sie eine Wiedervereinigung der besonderen Art. Chronologie einer deutsch-deutschen Liebesgeschichte.
4. November 2019 — MYP N° 27 »Heimat« — Text: Katharina Weiß & Jonas Meyer, Fotos: Steven Lüdtke

Die Mauer. 30 Jahre ist es jetzt her, dass sie in sich zusammenfiel. Seit 1961 stand sie da, als wäre sie für die Ewigkeit gemacht. Oder zumindest für hundert Jahre, wie Erich Honecker mal fabulierte. Doch dann kam der Abend des 9. November 1989 und es dauerte nur wenige Stunden, bis ihr Beton unter dem Freiheitsdrang von Millionen Menschen einfach so zerbröselte. Und mit ihm der Beton in den alten Köpfen des SED-Regimes.
Die Mauer teilte nicht nur Ost und West, nicht nur Kapitalismus und Kommunismus, sie separierte auch Menschen voneinander. Freunde. Familien. Liebende. Wie Martina und Jens, deren Geschichte im Juli 1971 auf der Ostseewoche in Rostock begann und deren persönliches Schicksal von diesem Bauwerk bestimmt werden sollte.

Martina war damals 19 Jahre alt und arbeitete als Volontärin für die National-Zeitung, ein Ostberliner Parteiblatt. Kurz bevor die junge Frau zum Journalismus-Studium nach Leipzig gehen sollte, hatte ihre Redaktion sie zur Berichterstattung in die Hansestadt geschickt. In der DDR war die Ostseewoche ein Ereignis: eine politische Großveranstaltung, bei der man jedes Jahr alle anderen Anrainerstaaten des Baltikums zu sich einlud. Das erklärte Ziel war die Verbesserung der politischen und wirtschaftlichen Beziehungen zu den skandinavischen Ländern. Und in der Tat: Während dieser Woche sollten schicksalshafte Beziehungen geknüpft werden – wenn auch auf einer Ebene, die der ostdeutschen Führungsspitze kaum am Herzen gelegen haben dürfte.
Das Motto im Jahr 1971 lautete: „Die Ostsee muss ein Meer des Friedens sein.“ Frieden – ein groteskes Wort, wenn man an all jene denkt, die beim Versuch, die aufs Schärfste bewachte Grenze der Deutschen Demokratischen Republik zu überqueren, ihre Freiheit, ihre Gesundheit oder sogar ihr Leben gelassen haben.
Daher ist die Geschichte der Mauer auch immer eine, die nicht nur auf der großen politischen Bühne erzählt werden darf. Sondern genauso auf der individuellen, persönlichen, da sie das Leben unzähliger Menschen fundamental verändert hat und noch bis heute beeinflusst.

Das Kennenlernen
»Ich war gerade mit meiner Suppe fertig, da setzte sich so ein Kerl an meinen Tisch.«
Wann und wo man sich auf dieser Erde in einen anderen Menschen verknallt, und dann noch über beide Ohren, wird wohl eines der letzten großen Geheimnisse des Lebens bleiben. Zumindest darin herrscht schon immer Einigkeit, egal ob Ost oder West.
Martina Geng sollte der berühmte Blitz treffen, als sie an einem Tag im Juli 1971 beim Mittagessen in der improvisierten Kantine des Rostocker Pressezentrums saß. „Ich war gerade mit meiner Suppe fertig, da setzte sich so ein Kerl an meinen Tisch und fing an, mich auszufragen. Er wollte wissen, wo ich herkomme und so weiter“, erinnert sich Martina Geng, die heute 68 Jahre ist und selber kaum fassen kann, dass sich diese Geschichte vor mehr als vier Dekaden zugetragen hat.
Damals, so zeigen alte Fotos, war sie blond, hatte sanfte blaue Augen und sinnliche Lippen. An jenem Tag, das weiß Martina noch, als sei es gestern gewesen, trug sie ein blau-weißes, kurzen Sommerkleid. Selbstgenäht, betont sie. Der Unbekannte mit dem spitzbübischen Lächeln, der sich ihr als Jens Jahnke vorstellte, war ganz in Cord gekleidet – inklusive der Schuhe, das war damals sehr in Mode. Martina erkannte sofort, dass der Mann aus dem Westen kommen musste.

»Abhängen! Sofort abhängen!«
Jens erzählte ihr, dass er in Frankfurt am Main arbeitete und von der Zeitung Konkret zur Berichterstattung nach Rostock geschickt wurde. Die Unterhaltung wurde immer netter und netter und mündete schließlich in einer Einladung: Jens bot Martina an, sie auf eine abendliche Schiffsfahrt mitzunehmen, die von Rostock aus aufs offene Meer führte. „Ich fand ihn sehr witzig und originell. Natürlich sagte ich sofort zu.“, erinnert sich Marina mit einem Lächeln auf dem Gesicht.
Doch kaum hatte sich der junge Journalist aus dem Westen verabschiedet, stellte ein Kollege der National-Zeitung seinen Schnitzelteller genau an dem Platz ab, auf dem zuvor Jens gesessen hatte. Der Mann, den Martina kaum kannte, fragte mit seltsam unterdrückter Stimme, die Lippen kaum bewegend: „Wer ist denn das?“
„Journalist aus Westdeutschland“, antwortete sie, woraufhin er hervorpresste: „Abhängen! Sofort abhängen!“

»Meine Zweifel hätte ich vor einem Wessi nie zugegeben.«
Martina, damals noch überzeugte Sozialistin, war gar nicht begeistert von dieser Aufforderung. Zuvor, im Gespräch mit Jens, hatte sie mächtig damit angegeben, wie toll doch ihrer Meinung nach in der DDR die Gesundheitsversorgung und die niedrigen Mietpreise seien und wie freiheitlich das Mehrparteiensystem sei. Auch wenn sie schon erste Skepsis gegenüber dem System hatte, gesteht sie ein: „Meine Zweifel hätte ich vor einem Wessi nie zugegeben. Ich wollte nicht ihm auch nicht verraten, dass mir ein Kollege verboten hatte, mit ihm einen Ausflug zu machen. Das wäre mir viel zu peinlich gewesen.“
Also ging sie mit ihm aufs Schiff. Und während die anderen Passagiere gemächlich Stehblues tanzten und zur Melodie von „Wie ein Stern“ schunkelten, einem Lied, mit dem sich in jenem Jahr DDR-Schlagerstar Frank Schöbel durch die ostdeutsche Hitparade schmachtete, diskutierten Martina und Jens bis in die Morgenstunden über Politik. Und sahen sich dabei tief in die Seele.

Das Verlieben
»Für intelligente Männer, die mit Sprache umgehen können, hatte ich schon immer eine Schwäche.«
Am Tag nach dem Rendezvous am See unter funkelndem Sternenhimmel hatten Martinas Schmetterlinge im Bauch schon ordentlich Wellengang: Die beiden küssten sich zum allerersten Mal auf einer Mole in Warnemünde.
„Mir hat an ihm gefallen“, sagt sie, „dass er so wahnsinnig frech war. Jens konnte Dinge sagen wie ,Wann schläfst du mit mir?’ und es war immer noch charmant.“
Zu erotischen Stunden zu zweit kam es in der Woche allerdings nie: Martina war, wie die meisten ostdeutschen Journalistinnen und Journalisten, bei Privatpersonen untergebracht und schlief in einem engen Bett bei einer sechsköpfigen Familie. Jens war zwar in den Genuss eines Hotelzimmers gekommen, doch da sich ein Besuch von Erich Honecker ankündigte, musste das Hotel kurzfristig geräumt werden. So landete er schließlich in einem Seemannsheim mit Stockbetten, in dem er sich ein Zimmer mit drei anderen teilen musste.
Aufgrund fehlender Rückzugsmöglichkeiten suchten sich die beiden ruhige Orte in der Stadt, um lange Blicke und intensive Gespräche auszutauschen. „Für intelligente Männer, die mit Sprache umgehen können, hatte ich schon immer eine Schwäche. Und er war auch viel freier als alle, die ich bis dahin kennengelernt hatte – in seiner ganzen Beurteilung der Welt und des Lebens.“

»Wenn Martina wegen dir Ärger bekommt, dann beschütze ich sie.«
Jens hatte in den Sechzigern an der Universität Tübingen bei Ernst Bloch studiert. Der berühmte deutsche Philosoph und Neomarxist, der zur Zeit des Nationalsozialismus im Exil gelebt und sich nach dem Krieg für ein Leben in Ostdeutschland entschieden hatte, war 1961 nach dem Bau der Mauer von einer Reise in den Westen nicht zurückgekehrt und nahm eine Gastprofessur in Tübingen an. Später arbeitete Jens viele Jahre lang als persönlicher Assistent von Theodor W. Adorno, ein anderer berühmter deutscher Philosoph und Soziologe, der zu den Hauptvertretern der sogenannten Frankfurter Schule zählte, eine als Kritische Theorie bezeichnete Denkrichtung.
Das Ausmaß der Gefühle war beiden schnell bewusst: „Wir haben uns richtig ineinander verliebt“, erzählt Martina. Vor dem skeptischen Kollegen hielt sie ihr Rendezvous geheim.
Zwei Tage vor der Abreise wechselte das Personal und ein neuer Gesandter der National-Zeitung kam in Rostock an. Martina kannte diesen Kollegen bereits und mochte ihn. Kurzerhand entschied sie, ihn mit Jens bekannt zu machen. Die Chemie zwischen den Dreien stimmte sofort. „Wir gingen sogar zusammen einen saufen“, erzählt sie von einem Abend in der Kogge, der ältesten maritimen Kneipe der Stadt. Das Trio prostete sich ordentlich zu. Nach ein paar Gläsern trafen sich die Männer am Urinal und der ostdeutsche Kollege versprach dem westdeutschen Journalist: „Wenn Martina wegen dir Ärger bekommt, dann beschütze ich sie.“

»Ich muss Meldung machen.«
Am Ende der Woche fuhr Martina mit Jens zurück nach Ostberlin. Er schlief eine Nacht bei seinem Bruder, der im Westteil der Stadt studierte. Am nächsten Tag folgte die tränenreiche Verabschiedung vor der Wohnung von Martinas Familie in Berlin-Karlshorst. Als sich die beiden in den Armen lagen, sah ihre Mutter vom Fenster aus auf den suspekten Westler herab und beobachtete das Geschehen mit finsterer Miene.
Wenige Stunden später, es war Sonntagabend, klingelte das Telefon. Ein Anruf des Kollegen aus Rostock: „Du Martina, ich habe nochmal mit meiner Frau darüber gesprochen“, beginnt er seinen Satz. Er habe sich überlegt, dass er doch ziemlich Ärger bekommen könnte, falls die Geschichte mit der Liebelei auffliegt. „Ich muss Meldung machen“, beschloss er daher – auf Drängen seiner Frau. In Martinas Augen flackert noch heute der Blick eines trotzigen, verliebten Teeangers auf, wenn sie von ihrer Antwort erzählt: „Ich habe dann schnippisch gesagt: Wenn es sein muss, dann mach das.“ Am nächsten Tag war nichts mehr so wie davor.

Die Strafe
»Hat der Mann Sie angefasst? Haben Sie den geküsst? Haben Sie mit dem geschlafen?«
Am Montagmorgen stöckelte Martina in die Prenzlauer Allee, wo die Büroräume der National-Zeitung lagen. Das Blatt diente als Zentralorgan der National-Demokratischen Partei Deutschlands. Da das formale Mehrparteiensystem der DDR eine Farce war, installierte die sowjetgelenkte SED mehrere andere offizielle Parteien, die sich gegenseitig künstlich Konkurrenz machten. Die NDPD war eine dieser Pseudo-Parteien, aus der das demokratische Mäntelchen der SED-Herrschaft gestrickt war. Einst war sie gegründet worden, um Alt-Nazis in das sozialistische System einzugliedern. Die Arbeitsstelle bei dem NDPD-Blatt war definitiv nicht Martinas erste Wahl, aber journalistische Volontärsplätze waren in der DDR mehr als rar.
Kaum war sie im Büro angekommen und hatte ihre Tasche auf dem Schreibtisch abgelegt, teilte ihr die Sekretärin mit: „Frau Schirrmacher, bitte zum Chefredakteur!“ Den sah die junge Volontärin normalerweise nur alle vier Wochen bei einer großen Redaktionskonferenz.
Spätestens als sie sein Büro betrat, wusste Martina, dass sie in Schwierigkeiten war. Vor ihr saßen nicht nur der Chefredakteur, sondern auch der Personalchef und sogar der Verlagsleiter. Eine Reihe alter Männer, die ihren Autoritarismus noch aus dem Dritten Reich hinüber in das neue System gerettet hatten.
Eine Stunde arbeiteten sie sich verbal an der jungen Frau ab: „Was bilden Sie sich ein? Der Mann ist ein Spion! Glauben Sie, Sie hätten ihn vom Sozialismus überzeugen können?“ Martina wurde beschimpft und zunehmend in die Enge getrieben. Dabei wurden die Fragen immer indiskreter: „Sie sind ein politischer Versager! Hat der Mann Sie angefasst? Haben Sie den geküsst? Haben Sie mit dem geschlafen?“

»Das hättest du wissen können, wenn du mit einem Westler anbandelst.«
„Die haben mich regelrecht fertiggemacht“, erinnert sich Martina heute mit zittriger Stimme. Am Ende der Tirade wurde ihr mitgeteilt: So politisch unreif, wie sie sei, könne man ihr nicht gestatten zu studieren. Sie müsse noch ein Jahr in der Obhut der National-Zeitung bleiben, um sich zu bewähren. Zudem wurde gedroht: „Nehmen Sie keinen Kontakt mehr mit dem Mann auf, wir lassen Sie ab jetzt von der Stasi überwachen.“
Auf einmal stand Martina auf der Seite jener Menschen, die keinen sicheren Platz mehr im System der DDR hatten. Was muss das für ein Staat gewesen sein, der Angst vor dem Sommerflirt einer Teenagerin hatte?
Verständnis oder gar Verteidigung konnte sie nicht erwarten, noch nicht einmal von engen Freunden oder ihrer Familie. „Die gingen auf Abstand“, erzählt Martina und fügt hinzu: „Sie vertraten die Haltung, dass ich mir das selbst zuzuschreiben hätte. Es hieß: Das hättest du wissen können, wenn du mit einem Westler anbandelst.“ Dann zögert sie eine Weile und sagt: „Es ging mir ganz fürchterlich.“ Vor allem die Reaktion ihrer Mutter brannte sich Martina ins Gedächtnis. Kreischend und zeternd machte sie ihrer Tochter Vorwürfe: „Um Gottes Willen! Deinetwegen dürfen deine Geschwister jetzt auch nicht studieren und ich verliere meinen Job.“

»Ich war gezwungen ihm zu schreiben, dass ich einen anderen Typen hätte.«
Am nächsten Tag wurde die Mutter tatsächlich zu den „alten Säcken“ bestellt, um über die Verfehlung ihrer Tochter Bericht zu erstatten. Als sie von ihrem Verhör zurückkam, nötigte sie Martina, einen handschriftlichen Brief an Jens zu verfassen: „Ich war gezwungen ihm zu schreiben, dass ich einen anderen Typen hätte und daher nichts mehr von ihm hören oder sehen wollte.“
Nachdem der erzwungene, von vorne bis hinten gelogene Text abgeschickt war, tobte es in Martina. Dabei erinnerte sich wieder an Jens’ Abschiedsworte, die ihr damals in Rostock eher unwichtig erschienen waren: Wenn sie Ärger bekomme, sagte er damals, solle sie eine Nachricht an seinen Bruder in Westberlin schicken. Adresse: Knesebeckstraße 16. In den darauffolgenden Tagen stand Martina unzählige Male am sogenannten Tränenpalast, der berühmt-berüchtigten Grenzübergangsstelle am Bahnhof Friedrichstraße. In ihren Händen hielt sie die fertig formulierten Zeilen, doch am Ende traute sie sich einfach nicht, einen fremdem Westtouristen anzusprechen und ihn zu bitten, ihren Brief in den anderen Teil der Stadt zu schmuggeln.
„Ich gab mir selbst die Schuld an meinem Unglück“, berichtet Martina. „Ich warf mir vor, dass ich damals in Rostock so naiv war und mir keine Gedanken über die drohenden Konsequenzen gemacht hatte. Und so war ich mit meiner Situation absolut einsam und alleine“, sagt sie mit feuchten Augen. Aber trotz der enormen Einschüchterungen rebellierte Martinas eigenes Wertesystem gegen irgendeine Einsicht, gegen irgendeine Läuterung: „Ich hatte nicht das Gefühl, etwas Verwerfliches gemacht zu haben, dafür hatte ich mich in diesen Mann einfach zu sehr verliebt. Daher war ich fest davon überzeugt: Die haben gar kein Recht, daran irgendetwas Falsches zu sehen!“

Die Repressalien
»Als du auf Toilette warst, hat der Typ deine gesamte Handtasche durchwühlt.«
In den Wochen nach dem Vorfall wurde Martina in ihrem Arbeitsumfeld von vielen Menschen gemieden. Reden konnte sie mit niemandem. Eines Tages ging sie mit einem entfernten Kollegen aus der Redaktion ein Bier um die Ecke des Verlags trinken. Ein paar Schriftsetzer saßen am Nebentisch. Am nächsten Morgen erzählten ihr diese Mitarbeiter: „Weißt du, mit wem du da gesessen hast? Als du auf Toilette warst, hat der Typ deine gesamte Handtasche durchwühlt und deinen Ausweis rausgenommen.“
Von da an war Martina allen Menschen gegenüber misstrauisch. „Wenn jemand freundlich zu mir war, bin ich sofort auf Abstand gegangen. Ich fragte mich immer: Ist der von der Stasi oder ist das einfach nur ein netter Mensch?“, beschreibt sie ihr damaliges Bauchgefühl. Dieses grundsätzliche Misstrauen setzte sich lange in ihr fest. Sie lernte, ihre Gedanken zurückhalten und den Blick zu senken. Außerdem versuchte sie in den folgenden Monaten, so fleißig wie möglich zu sein, um sich zu „bewähren“ und doch noch studieren zu können. Immer wieder wurde sie von ihren Vorgesetzten dazu gedrängt, endlich in die NDPD einzutreten.
Noch heute erinnert sich Martina an einen besonders unpassenden Überredungsversuch eines Parteimitglieds: „Sie müssen uns zeigen, dass wir füreinander gut sind. Das ist wie in einer guten Ehe: So kann man sich beweisen, dass man auch nach Verfehlungen wieder Vertrauen zueinander finden kann.“

»Meinen Sie denn, dass die Arbeiterklasse Schlamm wäre?«
Doch Martina weigerte sich jedes Mal, einen Mitgliedsantrag zu unterschreiben. Mit dieser Altnazi-Partei wollte das junge Mädchen nichts zu tun haben, auch nicht auf dem Papier. Die Strafe: Auch nach einem Jahr Bewährungs-Sanktion wurde ihr das Studium erneut verweigert und der Chefredakteur drohte: „Bilden Sie sich nicht ein, dass Sie irgendwo was anderes finden. Wir kennen uns hier und werden die Kollegen vorwarnen.“ In Gesamt-Ostdeutschland könne sie ohne das Wohlwollen der National-Zeitung keine Journalistin mehr werden.
Nach zwei Jahren Wartezeit und diversen Erpressungsversuchen schmiss Martina hin. Die Abschiedsworte aus dem Verlag: „Wir haben Ihnen alle Brücken gebaut, aber wenn Sie durch Schlamm waten wollen, bitte sehr!“ Martina nahm all ihren Mut zusammen und schleuderte folgende Frage zurück: „Meinen Sie denn, dass die Arbeiterklasse Schlamm wäre?“ Bevor sie sich umdrehte, sah sie noch die verdutzten Gesichter, die ihre vorbildliche sozialistische Antwort hinterlassen hatte.

Das Leben
»Das hatte nicht die gleiche Qualität wie mit Jens und mir.«
1973 fand die junge Frau eine Anstellung als Sekretärin an der renommierten Akademie der Wissenschaften. Ihr „politischer Fehler“, wie sie ihn nennt, begleitete sie auf Schritt und Tritt. Doch dann tat sich ein Jahr später eine ungewöhnliche Chance auf: An der Humboldt Universität wurde ein Lehrstuhl für Soziologie geschaffen. Martina bewarb sich umgehend um einen Studienplatz – mit Erfolg. Der Grund war simpel: An der Universität wurde die Personalakte nicht weitergeführt, sondern ein ganz neuer Ordner angelegt. Aus bürokratischer Sicht hatte sie wieder eine weiße Weste.
Auch wenn die Forschungsfelder streng von staatlicher Seite bestimmt und kontrolliert wurden, hatte Martina wenig Interesse an den Zielsetzungen der SED. So erinnert sie sich heute an glückliche und unbeschwerte Jahre, wenn sie an ihre Zeit an der Humboldt Universität zurückdenkt – auch weil sie gleich zu Beginn ihres Studiums ihren späteren Ehemann, Peter Geng, kennengelernt hatte. Jens war vergessen. Oder zumindest an einem Ort der Seele verschlossen, an den sich der Mensch im Alltag nicht mehr erinnert. Auch in Peter sei sie damals sehr verliebt gewesen, sagt Martina. „Aber das hatte nicht die gleiche Qualität wie mit Jens und mir.“

»Zu Ostzeiten war Scheidung noch viel einfacher.«
Dennoch ging das Leben seinen fast üblichen Gang. Das Paar bekam zwei Kinder, 1974 wurde die erste Tochter geboren, 1977 die zweite. Ein Jahr vor der Geburt des zweiten Kindes heirateten Martina und Peter – was übrigens zu dieser Zeit in Westdeutschland mindestens als unkonventionell angesehen worden wäre, wenn nicht sogar als unmöglich. Dem jungen Paar wurde eine eigene Wohnung zugewiesen und neben dem Studienstipendium gab’s vom Staat auch noch Geld für die Kinder. Jobben, wie man es heute auf Neudeutsch nennen würde, mussten sie nicht. Natürlich war das Geld immer knapp, dennoch hatten junge Familien im sozialistischen System oft bessere Ausgangschancen als im Westen.
Leider stellte sich im Laufe der Ehe heraus, dass Peter alkoholabhängig war. Nach Jahren der Co-Abhängigkeit ließ sich Martina 1986 scheiden. “Gott sei Dank noch vor dem Mauerfall! Zu Ostzeiten war Scheidung noch viel einfacher“, kommentiert sie den Vorgang aus der heutigen Perspektive.

Der Mauerfall
»In den letzen Jahren der DDR gab es ständig Abschiede, das waren immer große, traurige Feiern.«
Die Jahre kurz vor der friedlichen Revolution verbrachte Martina als Mitarbeiterin an der Akademie der Künste, wohin sie nach Abschluss ihres Studiums zurückkehrte. Die Akademie galt in dem sozialistischen Staat als eines der liberalsten Institute. „Für DDR-Verhältnisse war das eine Oase der Freiheit“, erinnert sich Martina. „Im Kollegium waren wir geistig frei. An den Sozialismus glaubten wir schon lange nicht mehr.“
Der Gedanke an eine Flucht kam ihr in all den Jahren aber nie. Dafür habe sie zu viel Verantwortung mit den Kindern gehabt, sagt sie. Und außerdem gab es zu viele Leute, an denen sie hing. Freunde, Bekannte, Familie. Dennoch hatte sie sich – wie viele andere – daran gewöhnt, Menschen an ein Leben im Westen zu verlieren. „In den letzen Jahren der DDR gab es ständig Abschiede, das waren immer große, traurige Feiern. Ich wäre gerne gegangen, aber das wollte ich weder meinen beiden Mädels zumuten noch mir selbst“, sagt sie.
Im Herbst 1989 beteiligte sich Martina mit Kollegen an den Ablegern der Leipziger Montagsdemos in Berlin. Als am 4. November 1989 eine Großdemonstration rund um den Alexanderplatz stattfand, lauschte sie nicht nur den Reden von Künstlergrößen wie Jan-Josef Liefers oder Ulrich Mühe. Sie wurde auch Zeugin, wie sich Günter Schabowski, damals Mitglied des Zentralkomitees der SED, auf der Bühne als einer der wenigen DDR-Führungspolitiker den tobenden Bürgern stellte.


»Ich stand im Supermarkt und wusste nicht, welche Zahnpasta ich kaufen sollte.«
Als am 9. November kurz nach 21 Uhr die Mauer schließlich fiel, war Martina überglücklich. Sie selbst wagte an diesem Abend jedoch noch nicht über die Grenze, da ihre beiden Töchter im Bett lagen und schliefen. „In diesen Stunden war alles so ungewiss, man wusste nicht genau, ob man wieder zurückkommen darf“, berichtet sie. Doch am nächsten Tag war auch ihre Neugierde so groß, dass sie sich mit Kolleginnen zu einem Spaziergang über den Grenzübergang Bornholmer Straße verabredete. Als sie die deutsch-deutsche Grenze passiert hatten, lagen sich die Frauen heulend in den Armen. Noch heute kommen Martina die Tränen, wenn sie im Fernsehen Berichte über den Mauerfall sieht.
Obwohl die alleinerziehende Mutter in der aufwühlenden Zeit nach dem 9. November 1989 auch erstmals wieder an Jens dachte, hatte für sie zunächst die Eingliederung in die neue Ordnung oberste Priorität. „Wir mussten uns ganz neu orientieren. Ich stand im Supermarkt und wusste nicht, welche Zahnpasta ich kaufen sollte“, beschreibt Martina die Erfahrungen vieler Ostdeutsche in den frühen Neunzigern. „In den Jahren war ich ganz schön damit beschäftigt, mich in diesem Wessi-Staat zurechtzufinden.“

»Der hat doch bestimmt Familie und erinnert sich gar nicht mehr an dich.«
Am meisten genoss sie die plötzliche Reisefreiheit. Nach der Grenzöffnung nahm sie die Bahn nach Hamburg oder fuhr mit ihren Töchtern von Kreuzberg aus nach Italien und Norwegen. Doch die Schattenseiten ließen nicht lange auf sich warten. Wie so viele Ostdeutsche wurde auch Martina bald nach der Wende arbeitslos. Die Akademie der Künste im Osten musste ihre Mitarbeiterzahl von 300 auf 30 reduzieren, nachdem sie mit ihrem Westberliner Pendant fusioniert war.
Ende 1992, das Leben im wiedervereinten Deutschland wurde allmählich zur Normalität, schob sich auch immer öfter das Gesicht von Jens vor Martinas geistiges Auge. Sie suchte die beiden Liebesbriefe heraus, die sie damals von ihm erhalten hatte. Die Sehnsucht nach diesem Mann pochte nach all den Jahren immer noch in ihr. „Ich habe überlegt, ob ich ihn suchen soll. Doch ich hielt mich zurück, weil ich mir dachte: Was für ein Quatsch, Martina! Der hat doch bestimmt Familie und erinnert sich gar nicht mehr an dich.“ In einem Moment des Loslassens verbrannte sie die wertvollen Briefe. „Inzwischen denke ich, dass ich ihn damit herbeigehext habe“, lacht Martina.

Die Wiedervereinigung
»Wenn das Telefon klingelt und ein Mann nach mir fragt, dann sag ihm, dass Mama nicht zuhause ist.«
Ein Vierteljahr später klingelte das Telefon zu einer ungewöhnlichen Tageszeit. Martina hatte damals einen ungewollten Verehrer, deshalb hatte sie ihrer jüngsten Tochter eingeimpft: „Wenn das Telefon klingelt und ein Mann nach mir fragt, dann sag ihm, dass Mama nicht zuhause ist.“
Als die Tochter das Telefonat annahm, saß Martina im Nebenraum und hörte, wie aus dem anfänglichen Abwimmelversuch ein immer längeres Telefonat wurde, von dem sie hier und da die bruchstückhaften Antworten ihrer Tochter mitbekam: „Mama ist nicht zuhause… Ich bin 14, meine Schwester ist 16… Nein, meine Eltern sind geschieden.“
Nachdem Martinas Tochter aufgelegt hatte, kommentierte sie den gespannten Blick ihrer Mutter wie folgt: „Ich soll dich schön grüßen – von einem Jens Jahnke. Ihr seid euch vor 22 Jahren mal begegnet. Er ruft wieder an.“

»Da ist mir schwarz vor Augen geworden.«
„Da ist mir schwarz vor Augen geworden“, erinnert sich Martina. Sie sank tief in einen Sessel und plötzlich kam alles wieder hoch: die zarte Leidenschaft der gemeinsamen Sommertage und die zerstörerischen Repressalien, die dem unschuldigen Flirt in Rostock folgten und den Lauf ihres Lebens für immer veränderten.
Marina saß wartend am Telefon. Kurz vor Mitternacht klingelte es erneut. Es war Jens. Zum ersten Mal seit 22 Jahren hörte sie wieder seine Stimme. Er sei zufällig auf einer Tagung in Potsdam, sagte er, und es sei ihm eingefallen, dass Martina in Berlin wohne. Jens hatte ursprünglich vor, das gesamte Berliner Telefonbuch nach dem Namen Schirrmacher abzutelefonieren. Da Martinas Schwester nie geheiratet hatte und mit Vornamen Andrea hieß, hatte er das Glück, gleich beim ersten Versuch an jemanden zu geraten, der ihm die Nummer von Martina nennen konnte.
In einem stundenlangen Telefonat erzählten sich die beiden, was sie in den letzen zwei Dekaden im Leben des jeweils anderen verpasst hatten. Es schmerze ihn sehr zu erfahren, dass ihre Rostocker Begegnung zu so viel Leid in Martinas Leben geführt hatte. Im Gegensatz zu Martina hatte Jens das Glück, dass er viele Jahre lang als Journalist für die Frankfurter Rundschau und das ZDF um die ganze Welt reisen durfte. Später lebte er im Rahmen längerer Projekte in Südamerika und Indien.

»Ich komme zu dir nach Hause. Du entkommst mir sowieso nicht!«
Auch wenn Jens auf der kapitalistischen Seite der Mauer ganz andere Erfahrungen gemacht hatte als Martina, so zeigten sich doch überraschende Parallelen. Beide hatten im selben Jahr geheiratet, beide wurden Eltern von zwei Kindern, die im selben Jahr und sogar im selben Monat das Licht der Welt erblickten. Jens wurde Vater eines Sohnes und einer Tochter. Dieser gab er den Zweitnamen Martina, ganz bewusst nach seiner verflossenen Sommerliebe – seine Frau kannte die Geschichte. Doch mittlerweile lag auch seine Ehe in Trümmern. Später gab er zu: Den Kongress in Potsdam hatte er nur vorgetäuscht. Er war ausschließlich nach Berlin gekommen, um Martina zu suchen.
Am Ende dieses ersten Telefonats fragte Jens, wann sie sich persönlich treffen könnten. Martina schlug ein Café im Prenzlauer Berg vor, um eine gewisse Distanz zu wahren. Doch Jens fasste einen anderen Beschluss: „Nein, ich komme zu dir nach Hause. Du entkommst mir sowieso nicht!“
Aufgeregt wie ein Teenager wartete Martina auf einen Mann, den sie zuletzt gesehen hatte, als sie gerade 19 und er 28 Jahre alt war. Sie wusste, dass sie sich auf einen Glatzkopf einstellen musste. Doch als er vor ihr stand und sein Kopf über einem riesengroßen Blumenstrauß auftauchte, entdeckte sie kaum Spuren des Alters. Stattdessen waren die Augen und das Lächeln genauso wie in ihrer Erinnerung.

»Es fühlte sich an, als hätten wir uns vorgestern zuletzt getroffen.«
Die beiden lagen sich sofort und sehr lange in den Armen: „Es fühlte sich an, als hätten wir uns vorgestern zuletzt getroffen. An dieser Begegnung war absolut nichts Fremdes.“ Nach einem langen Gesprächsabend in der Küche folgte eine leidenschaftliche Nacht – die erste von vielen. „Gefühlt ist er sofort bei mit eingezogen. Und nie wieder gegangen.“
Das wiedervereinigte Paar reiste viel zusammen und genoss einen großen, illustren Freundeskreis. Die wilden Jahre im Prenzlauer Berg wurden von schwärmerischen Ausflügen mit einem Campingbus abgelöst, ein uraltes DDR-Gefährt, das Jens eigenhändig umgebaut hatte. Irgendwann führte sie eine ihrer vielen Touren an den Werbellinkanal in Eichhorst, einem beschaulichen Brandenburger Örtchen eine Stunde von Berlin entfernt. Die beiden fanden es dort so schön, dass sie sich zuerst einen Garten an der Wasserstraße und später ein Haus in dem kleinen Dorf kauften.
Mitte der Nullerjahre wurde Jens, der Wessi, sogar Bürgermeister dieses ostdeutschen Ortes. Seine wichtigste Mission: Eichhorst hatte keine einzige Kneipe und das passte dem geselligen Lebemann überhaupt nicht. Noch in seiner Amtszeit machten drei verschiedene Gastronomien auf. Martina erzählt von einem bunten Leben in einem bunten Haus, voller Bücher und Katzen, mit einer gemütlichen Küche. Noch heute ist die Wand mit Fotos geschmückt ist, die Jens von Martina während der Zubereitung eines Festtagsvogels geschossen hatte. Auf der anderen Seite hängen zwei Portraitfotos der beiden – direkt nebeneinander. Während das Martinas Bild in jener Woche von Jens aufgenommen wurde, in der sie sich in Rostock begegneten, wurde sein Portrait von einem Freund in Kalkutta fotografiert.

»Es war nicht immer ganz einfach mit ihm. Aber mit den Dingen, die mir wichtig waren, habe ich mich durchgesetzt.«
Martina und Jens hatten noch 18 gemeinsame Jahre, bevor Jens, der Impulsmensch, 2011 an Herzversagen verstarb. Bereits Ende 1999 hatte er einen ersten Infarkt. „Es war nicht immer ganz einfach mit ihm, war er in seiner Art doch recht dominant“, sagt Martina und ergänzt: „Aber mit den Dingen, die mir wichtig waren, habe ich mich durchgesetzt.“ Sie schweigt für einen Moment, dann fährt sie mit ihren Erinnerungen fort: „Mit Jens war es immer unheimlich spannend, weil er wirklich ständig neue Ideen hatte. So einen Menschen habe ich weder zuvor noch jemals danach wieder erlebt.“
Auch wenn Martina es nie ganz verschmerzt hat, dass sie kein Leben als Journalistin führen durfte, empfindet sie sich doch als Gewinnerin über die DDR-Diktatur. „Jens wieder zu begegnen war ein später, aber toller Ausgleich für das, was ich damals verloren hatte. Es ist ein unfassbares Geschenk der Geschichte, dass wir doch noch so viele Jahre miteinander verbringen durften.“

#mauerfall #mauerfall30 #wiedervereinigung #ddr
#katharinaweiss #jonasmeyer #stevenluedtke #mypmagazine
Mehr über die Friedliche Revolution von 1989 und den Mauerfall:
Mehr über die Aufarbeitung der SED-Diktatur:
Interview & Text: Katharina Weiß
Co-Autor: Jonas Meyer
Fotografie: Steven Lüdtke
Sebastian Schneider
Portrait — Sebastian Schneider
Anleitung zum guten Leben
Was wäre die Welt ohne das geschriebene Wort? Und was wäre das geschriebene Wort ohne die Menschen, die es auf die Theaterbühne bringen? Wir haben Schauspieler Sebastian Schneider fast ein Jahr lang begleitet und erfahren, warum ein Buch wie ein bester Freund sein kann. Und wieso es wichtig ist, das Unbekannte zu umarmen.
30. Oktober 2019 — MYP N° 26 »Stil« — Text: Jonas Meyer, Fotografie: Maximilian König

Die folgende Geschichte – also alles, was sich über die Dauer von fast einem Jahr ereignen wird –, beginnt mit einem simplen Post auf Instagram. Am 3. November 2018 veröffentlicht dort Sebastian Schneider, Theater- und Filmschauspieler und zu dieser Zeit 27 Jahre alt, in einer Insta-Story folgende Textpassage, die er aus einem Buch abfotografiert hat:
„Popmusik ist die Form der Menschen, verstehen Sie? Wenn Intellektuelle mit den Menschen zu kommunizieren versuchen, scheitern sie in der Regel. Das ist, als versuchte man, in Japan in Althochdeutsch oder Französisch zu kommunizieren. Wenn man nach Japan geht, sollte man japanisch sprechen. Der ganze intellektuelle Müll dieses Ritual, das daraus gemacht wird, interessiert mich nicht. Man muss sich auf das wirkliche Gefühl – das einfache, menschliche Gefühl – besinnen und es in einer einfachen Sprache ausdrücken, die die Menschen erreicht. Ohne Firlefanz. Wenn ich den Menschen etwas mitteilen will, sollte ich deren Sprache sprechen. Popsongs haben diese Sprache. Sie sind eine sehr starke Form der Kommunikation.“
Es sind die Worte von Yoko Ono, die im Jahr 1980 zusammen mit John Lennon dem Journalisten David Sheff ein dreiwöchiges Interview gab. Dieses Interview, das das letzte gemeinsame des weltberühmten Künstlerpaars werden sollte, erschien am 6. Dezember 1980 im Playboy. Zwei Jahre später wurde es erneut veröffentlicht, in einem Buch mit dem Titel „Die Ballade von John und Yoko: Das letzte große Interview“. Und so fand dieses Gespräch irgendwann auch den Weg in die Hände von Sebastian Schneider, der es liebt, Texte als kleine Kostbarkeiten zu verpacken und sie anderen genauso nah ans Herz zu legen wie sich selbst. Wer ist wohl dieser Mensch? Und wie ist er?

1. Akt: Gorgonzola Club
Vier Wochen später, wir haben uns mit Sebastian zum Pizzaessen verabredet. Vorgeschlagen hat er das Restaurant Gorgonzola Club, das man im Berliner Stadtteil Kreuzberg in einer kleinen Seitenstraße zwischen Kottbusser Tor und Oranienplatz findet. Als wir das Lokal betreten, ist der junge Schauspieler bereits da und sitzt an einem kleinen Tisch mit dem Rücken zu einem großen Fenster. Seine aufrechte, leicht gespannten Körperhaltung hinterlässt zusammen mit den streng zurückgekämmten Haaren einen Eindruck, den man vor einigen Jahrzehnten wohl als aufgeräumt bezeichnet hätte. Sebastians Rücken wirkt so durchgedrückt, wie es sich bei Tisch wohl alle Omis dieser Welt von ihren bei Enkeln nur so wünschen würden.
A propos Omis: Noch bevor wir einen ersten Blick in die Karte geworfen haben, lässt uns Sebastian wissen, dass er nach der Pizza auf jeden Fall noch ein besonderes Dessert bestellen wird: Vanilleeis mit heißen Himbeeren – eine Nachtischbombe, die bei vielen von uns Erinnerungen an zuhause und an Omas gute Küche weckt.
Das Besondere an Sebastians Bestellhinweis ist nicht die Information an sich. Sondern die Art und Weise, wie er sie vermittelt. Der Schauspieler ist jemand, der die Gabe hat, das eher Beiläufige mal kurz zum Unbedingten zu erklären – allerdings ohne dabei Gefahr zu laufen, das Profane mit den wirklich großen Themen des Lebens auf eine Stufe zu stellen. Zu den wichtigsten Gehilfen seines Ausdrucks zählen außerdem die dunkle, akzentuierte Stimme und die wachen Augen, die sein jeweiliges Gegenüber im Gespräch wie Suchscheinwerfer in den Fokus nehmen – und dort lassen, bis das zu Sagende gesagt ist.
Wir bestellen Pizza und Weißwein. Sebastian greift in die Innentasche seiner Jacke, zieht ein Buch heraus und legt es vor sich auf den Tisch: Die Ballade von John und Yoko: Das letzte große Interview. „Zu der Zeit, als ich dieses Buch gelesen habe“, beginnt er zu erzählen, „habe ich auch sehr viel Musik von den Beatles gehört – wahrscheinlich, weil ich das in meiner Kindheit verpasst habe.“ Dabei sei vor allem der Song For No One bei ihm hängengeblieben. „Dieser Song handelt von einer Liebe, die vorbei ist“, erklärt Sebastian. „Die Melodie ist total einfach, der Text aber sehr tiefsinnig. Das macht den Song für mich so allgültig und zu einem der schönsten Liebeslieder, die ich je gehört habe“, gesteht er und fügt hinzu: „Dieser Song geht jedem direkt ins Herz – der Beat ist so schnell wie das Leben, das an einem vorbeirauscht, wenn man es nicht irgendwann mal packt.“

»Manchmal hat man ein Buch dabei wie einen besten Freund.«
Die besagte Textstelle, die er damals auf Instagram gepostet habe, thematisiere genau das, lässt uns Sebastian wissen. Wie in der Musik gehe es auch in der Schauspielerei darum, sich auf das wirkliche Gefühl – das einfache, menschliche Gefühl – zu besinnen und es in einer einfachen Sprache ausdrücken, die die Menschen erreiche. „Lies dieses Buch!“, stößt es aus ihm heraus. „Es ist voller großer, wichtiger Gedanken. Manchmal hat man ein Buch dabei wie einen besten Freund. Ich trage es seit Wochen in meiner Tasche und habe gerade in der U-Bahn nochmal darin gelesen. Das, was John und Yoko sagen, ist eigentlich recht einfach – aber trotzdem ist es extrem wichtig, dass es überhaupt jemand sagt.“
Bei diesem ersten Gespräch mit Sebastian Schneider trägt er einen dunkelgrauen Pullover, auf dem in Brusthöhe die Worte Don’t look back zu lesen sind. Wer in den Neunzigerjahren aufgewachsen ist und den Aufstieg und Niedergang der Band Oasis erlebt hat – und sei es nur beiläufig im Radio –, fühlt sich fast automatisch dazu hingerissen, in anger zu addieren. „Natürlich ist es auch wichtig, in die Vergangenheit zu blicken“, sagt Sebastian. „Viel interessanter finde ich es aber, nach vorne zu schauen.“ Ein Lebensmotto sei dieser Satz allerdings nicht, fügt er hinzu. „Don’t look back ist eine Verneinung. Wenn ich tatsächlich ein Motto für mich persönlich formulieren müsste, würde ich daraus immer ein Ja machen – etwas Positives.“
Aufgewachsen ist der Schauspieler im niedersächsischen Ottersberg, einem kleinen Dorf in der Nähe von Bremen, wo er eine Waldorfschule besuchte. Besonders in Erinnerung geblieben, so erzählt er, sei ihm ein äußerst engagierter Klassenlehrer, der in der 8. Klasse mit den Schülerinnen und Schülern sechs Wochen lang das Theaterstück Der Herr der Fliegen von William Golding einstudierte: „Dieser Lehrer hatte vor den Proben zwei Tonnen Sand besorgt und auf die Bühne gekippt. Wir Kinder sollten dann diverse Topfpflanzen von zuhause mitbringen, mit denen wir auf dem Sand das Bühnenbild errichtet haben: einen Dschungel.“
Ein leichtes Grinsen wandert über Sebastians Gesicht. „Wenn ich mich daran zurückerinnere, waren diese sechs Wochen für mich das Geilste“, erklärt er. „In dieser Zeit habe ich gewusst, warum ich zur Schule gehe – dafür habe ich mich sonst nie so wirklich interessiert.“ Ohnehin habe er sich als Kind viel gelangweilt, gesteht er und fährt fort: „Es gab damals nichts anderes, bei dem ich so viel Kraft, Begeisterung und Schonungslosigkeit aufbringen konnte wie in dieser Theaterzeit.“

»Ich bin ein Staunender bei allem, was ich erlebe.«
Schon in der ersten Klasse spielte Sebastian einen Feuergeist. Die Aufführung fand im Freien und bei starkem Regen statt, doch das war ihm egal. „Nach der Vorstellung haben mich die Leute dafür gelobt, dass sie mich trotz des schlechten Wetters bis in die letzte Reihe verstehen konnten. Das war ein tolles Kompliment und hat mir sehr geschmeichelt.“
Durch die Schulaufführungen hatte der Junge Blut geleckt. Und so dauerte es nicht lange, bis er auch außerhalb der Schulzeit Theater spielen wollte. Er lernte das Theater am Goetheplatz in Bremen kennen und übernahm dort wenig später erste Rollen. Das altehrwürdige Haus im Bremer „Viertel“ hatte es ihm aber nicht nur als Schauspieler angetan, sondern auch als Zuschauer. „Ich habe an diesem Ort wirklich sehr viel Zeit verbracht“, erzählt er. „Oft saß ich staunend im Publikum und dachte: Mein Gott, was macht ihr da! Ich war völlig beeindruckt von diesem besonderen Kosmos, den ich dort kennenlernen durfte, und wollte unbedingt Teil dessen sein.“
Dieses Staunen, von dem Sebastian berichtet, ist etwas, was ihm in den folgenden Jahren immer wieder begegnen sollte. „Ich bin ein Staunender bei allem, was ich erlebe – vor allem in Situationen, mit denen ich nie gerechnet hätte“, erklärt er und fügt hinzu: „Ich staune sehr oft und sehr viel in meinem Leben.“ Doch er habe ebenso feststellen müssen, sagt er, dass gerade dieses anfängliche Staunen, das er als jugendlicher Zuschauer im Bremer Theater immer wieder an sich selbst erlebte, mit den Jahren abgenommen habe. „Diese Art von Staunen ist mir auf jeden Fall abhandengekommen – oder hat sich zumindest sehr verändert“, sagt Sebastian. „Manchmal passiert es zwar wieder– aber das kostet etwas.“

»Wenn man aus so einer Liebe einen Beruf macht, verändert sich der Blick darauf.«
Der Grund, warum diese Art des Staunens mit der Zeit immer seltener geworden sei, sei ganz banal, erklärt er: „Wenn man aus so einer Liebe einen Beruf macht, verändert sich der Blick darauf.“ Dass es überhaupt so weit kam in Sebastians Leben, liegt an den Darstellerinnen und Darstellern, die er am Bremer Schauspielhaus kennengelernt hatte. Von ihnen erfuhr er, dass es so etwas wie Schauspielschulen gibt, an denen man diesen Beruf von Grund auf erlernen kann. Das wusste er bis dahin nicht – und so stand für den mittlerweile 18-Jährigen relativ schnell fest, was er nach der Schule machen wollte. Sein Abitur hatte er da gerade mit Ach und Krach bestanden.
Was folgte, waren vier Jahre Ausbildung an einer der renommiertesten Schauspielschulen Deutschlands, der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ Berlin. „Als ich angefangen habe, dort zu studieren, hatte ich keine Ahnung von nichts“, erinnert sich Sebastian „Ich war ein kleiner Junge. Und so war ich erst mal völlig weggefegt von dem, was mir dort entgegenkam.“
An der Schauspielschule, so erklärt er, befinde man sich in der besonderen Situation, dass man fast ununterbrochen mit Leuten zusammen sei, die das Gleiche machen und lieben wie man selbst. „Das sind Menschen, die alle einen ganz ähnlichen Weg gegangen sind – und die sich irgendwann entschieden haben, mit der Schauspielerei ernst zu machen“, sagt er und ergänzt: „Das war für mich manchmal auch schwierig, denn ich war jetzt nicht mehr der Einzige.“ Diese Zeit habe ihn sehr verändert, erzählt Sebastian. „In diesen vier Jahren Ausbildung bin ich irgendwie erwachsen geworden – falls ich überhaupt jemals erwachsen werde, ich weiß es nicht so genau.“ Und er fügt hinzu „Man lernt einen Beruf und ist gleichzeitig Teil einer Konstellation von Menschen, die alle von Anfang an das große Bedürfnis hatten, sich viel voneinander zu geben.“

»Uns hat interessiert, was wir in der heutigen Zeit mit Heiner Müller anfangen können – wir, die wir alle nach 1989 geboren sind.«
Diese Verbindung zu seinen Mitstudentinnen und -studenten war so stark, dass sie selbst bestehen blieb, als er im Jahr 2015 sein Studium an der „Ernst Busch“ erfolgreich beendete. Zusammen mit fünf anderen Schauspielern formte Sebastian eine Theatergruppe, die den Namen Neues Künstlertheater Berlin trägt und bis heute immer wieder gemeinsam Stücke erarbeitet und auf die Bühne bringt.
Ihre Geburtsstunde erlebte die Theatergruppe bereits 2014, als die jungen Künstlerinnen und Künstler sich mit dem Antikendrama Philoktet von Heiner Müller beschäftigten. Müller gilt als einer der wichtigsten deutschsprachigen Dramatiker der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und zählt zu den bedeutendsten Schriftstellerpersönlichkeiten der DDR. „An der Busch gibt es etliche Dozentinnen und Dozenten, die in der ehemaligen DDR lebten und arbeiteten“, erklärt Sebastian. „Dementsprechend kann dort jeder ganz genau sagen, wie man Heiner Müller macht – oder besser gesagt, wie man diese Sprache spricht und wie man seine Werke inszenieren muss.“ Das habe ihm und seinen Kommilitonen damals aber nicht gereicht: „Dieser Text ist ein sehr politischer. Daher hat uns vor allem interessiert, was wir persönlich in der heutigen Zeit mit diesem Stück und dem Autor Heiner Müller anfangen können – wir mit unserer kurzen Vergangenheit, die wir alle nach 1989 geboren und in Westdeutschland aufgewachsen sind.“
Die sechsköpfige Truppe nahm sich zu Beginn der Proben zwei Wochen Zeit und ging mit dem Text in Klausur. „Wir haben uns vorgenommen“, erzählt Sebastian, „dass wir uns 14 Tage geben. Sollten es uns in dieser Zeit nicht gelingen, irgendetwas mit dem Stück anzufangen, nehmen wir ein anderes.“ Sebastian macht eine kurze Pause, dann fügt er hinzu: „Aber wir haben uns in diesen Text wortwörtlich verliebt – und so haben wir daraus eine eigene Inszenierung gemacht. Und nicht nur das, wir haben dabei auch eine ganz eigene Arbeitsweise entwickelt. In dieser intensiven Probenzeit entstand zwischen uns ein besonderer Zusammenhalt, der bis heute besteht.“

»Mein Bauchgefühl hat mir gesagt, dass meine Arbeit in Bern nicht viel mit dem zu tun hat, was ich für mein Leben möchte.«
Seit 2014 hat das Neue Künstlertheater Berlin Heiner Müllers Philoktet immer wieder aufgeführt, in ständig wechselnden Konstellationen, Orten und Darstellungsweisen. „Unser Stück verändert sich dauernd“, erklärt Sebastian. „Das liegt daran, dass es einen inhaltlichen Bezug zur aktuellen Lage der Welt herstellt – und die verändert sich ebenso permanent.“ Was sich im Laufe der Jahre auch veränderte, war die Gruppe selbst. Bestand es 2014 aus sechs männlichen Schauspielern, verdoppelte sie in fünf Jahren nicht nur die Anzahl ihrer Mitglieder, sondern reduzierte auch signifikant die Männerquote von anfangs einhundert Prozent.
Auch wenn sich die jungen Schauspielerinnen und Schauspieler mit dem Neuen Künstlertheater Berlin eine gemeinsame Plattform geschaffen hatten, trieb es sie nach ihrem Abschluss an der „Ernst Busch“ und auf der Suche nach einem festen Engagement in alle Himmelsrichtungen. Sebastian fand eine Anstellung am Konzerttheater Bern – und erlebte dort „viel Konfrontation mit der Realität“, wie er berichtet. „Nach vier Jahren Schauspielschule war ich hundertprozentig sicher, dass ich ans Theater gehen will, um dort so viel es irgendwie geht zu spielen. Ich dachte: Das ist genau das, was ich machen will.“ Doch nach einer Spielzeit beendete Sebastian sein Engagement. „Ich habe plötzlich gemerkt, dass es für mich woanders weitergeht – aber wo genau, habe ich damals noch nicht gewusst. Mein Bauchgefühl hat mir gesagt, dass meine Arbeit in Bern nicht viel mit dem zu tun hat, was ich für mein Leben möchte.“ Diesem Bauchgefühl folgte er und zog kurzerhand zurück nach Berlin. Dennoch, das sei ihm wichtig zu sagen, habe er die Zeit in der Schweiz nie bereut. Dieses Jahr sei eine sehr wichtige Erfahrung für ihn gewesen.
»Man entscheidet jeden Tag selbst, wie man leben möchte.«
Dass diese Phase des Suchens keine einfache war, merkt man ihm an, zumindest für einen Moment. Wenn es um das eigene Leben geht, kann Angst ein ständiger Begleiter sein – ein Begleiter, der mit Dauerkarte jeden Abend im Publikum sitzt. Und sitzen bleibt, auch wenn die Vorstellung schon lange zu Ende ist. „Für mich war irgendwie klar, dass ich gegen Ängste kämpfen will, und zwar dauernd“, sagt Sebastian und fährt fort: „Angst ist manchmal ein Riesenmotor und manchmal ein Riesenhindernis. Als ich noch ein Teenager war, war meine Entscheidung, in die Schauspielerei zu gehen, eine völlig unbewusste und dementsprechend angstfreie. Aber mittlerweile denke ich anders über die Dinge nach und frage mich immer wieder, was Angst bedeutet. Dabei bleibt mir nichts anderes übrig, als meine Angst genau anzuschauen, sie ernst zu nehmen und zu fragen, wo sie mich hinführt. Ob sie reagiert. Ob sie mich vielleicht sogar anlächelt und sagt: Hey, ich bin auch da! Aber das ist ok. Man entscheidet ja jeden Tag selbst, wie man leben möchte.“
Es ist spät geworden an diesem ersten Gesprächstermin. Wirkte Sebastian zu Beginn noch überaus aufgeräumt, scheint es jetzt fast so, als hätte er eine zweistündige Theateraufführung hinter sich – auf der Bühne, wohlgemerkt. Die streng zurückgekämmten Haare haben sich im Laufe des Abends zu einer wilden Frisur verwandelt, seine Gestik wurde energetischer, die Mimik bestimmter, die Stimme noch entschlossener.
Die Kellnerin des „Gorgonzola Club“ serviert einen großen Eisbecher mit heißen Himbeeren und nimmt die mittlerweile leere Weinflasche mit. Ein breites Grinsen wandert über Sebastians Gesicht. Für heute soll es genügen.

2. Akt: Aunt Benny
Fünf Monate später, es ist der 28. April 2019 und Sebastian Schneider seit wenigen Tagen 28 Jahre alt. Um unser Gespräch aus dem Dezember fortzusetzen, haben wir uns mit dem Schauspieler bei Aunt Benny verabredet, einem kleinen Café zwischen Ostkreuz und Frankfurter Allee.
Wie bei unserem ersten Treffen kurz vor Weihnachten ist Sebastian bereits da und sitzt gedankenversunken und mit dem Rücken zur Wand an einem kleinen Tisch – wobei sitzt nicht das treffende Wort ist. Halb kauernd, halb lehnend hat er seinen Oberkörper so ungewohnt in einen kleinen Wandvorsprung verdreht, dass es scheint, als wolle er sich in die kahle Wand kuscheln. Von seiner eigenen Körperhaltung völlig unbeeindruckt, hat er sich in ein Reclam-Büchlein vergraben, das er mit seiner rechten Hand dicht vor seiner Nase hält. Ein Industriestrahler, der genau über seinem Kopf hängt, dient ihm dabei als Leselampe.
Während wir diese etwas skurril anmutende Situation für einen Moment beobachten, fühlen wir uns an Sebastians Worte aus dem letzten Jahr erinnert: „Manchmal hat man ein Buch dabei wie einen besten Freund.“ Und so ist es uns fast ein wenig unangenehm, dieses freundschaftliche Zwiegespräch zu unterbrechen.
Aber die Sorge ist unbegründet. Sebastian empfängt uns mit einem freundlichen Blick und legt sein Büchlein zur Seite. Und bevor wir uns versehen, befinden wir uns auch schon wieder im Gespräch. Zurzeit arbeitete er mit seinem Neuen Künstlertheater Berlin an This Is Our Youth von Kenneth Lonergan, erzählt uns der Schauspieler. Das Stück, das im New York der frühen 1980er Jahre spielt und 1996 uraufgeführt wurde, erzählt die Geschichte des 19-jährigen Warren, der von seinem Vater zuhause rausgeworfen wird, diesem vorher noch 15.000 Dollar stiehlt und bei seinem älteren Freund und Drogendealer Dennis unterkommt. Die beiden laden zwei junge Frauen ein, mit ihnen Zeit zu verbringen, doch nur eine kommt: Modestudentin Jessica. Als sie in Dennis‘ Wohnung auftaucht, entsteht eine überraschende Dynamik zwischen den drei Protagonisten. Der Verlag S. Fischer findet dafür folgende Worte: „Es ist 1982 in New York, der Beginn der Reagan-Ära. Drei kiffende Teenager aus gutem Hause an der Schwelle zum Erwachsensein in einer Zeit, in der alles in Frage gestellt wird, was man ihnen in ihrer Kindheit beigebracht hat.“

»Man fängt an, sich locker zu unterhalten, und ehe man sich versieht, ist man bei den großen politischen Themen.«
„Das tolle an dem Stück ist“, sagt Sebastian, „dass es eine ganz außergewöhnliche Freundschaft erzählt. Dennis macht den drei Jahre jüngeren Warren eigentlich die ganze Zeit gnadenlos runter. Er schreibt ihm vor, wie er zu leben hat und erklärt ihm, wie die Welt funktioniert. Gleichzeitig merkt man zwischen den Zeilen, wie dringend sich beide gegenseitig brauchen.“ An dem Stück interessiere ihn vor allem, fügt er hinzu, dass es darin so viele Situationen gebe, die man selbst aus dem eigenen, realen Leben kenne. „Man fängt an, sich locker zu unterhalten, und ehe man sich versieht, ist man bei den großen politischen Themen“, erzählt Sebastian und verrät: „Im Original, das 1982 spielt, geht’s um Reagan. Vielleicht werden wir in unserer Inszenierung eher einen Bezug zu Trump herstellen, wer weiß.“
This Is Our Youth beeindrucke ihn und alle anderen Mitwirkende wegen der besonderen Konstellation der Charaktere, erzählt Sebastian. „Irgendwann werden von den drei jungen Leuten die großen Themen unserer Zeit diskutiert. Dabei entwickeln sie – in aller Beiläufigkeit – eine gewisse Wahrhaftigkeit. Das finden wir überaus spannend.“ Außerdem sei der Text so gut geschrieben, dass man sich da als Schauspieler „einfach reinfallen lassen und direkt finden“ könne, erklärt Sebastian und fügt hinzu: „Bis jetzt gab es beim Proben keinen einzigen Moment, in dem ich dachte: Wie machen wir das jetzt? Es ging immer sofort das Spiel los.“
Die gesellschaftspolitische Diskussion zwischen Dennis, Warren und Jessica spitzt sich im Laufe des Stücks immer weiter zu. Als die Situation zu eskalieren droht, schreitet Jessica ein und schlägt vor, einfach das Thema zu wechseln und unaufgeregt anzuerkennen, dass alle Beteiligten unterschiedlicher Meinung sind. „Ich finde diese Haltung großartig, vor allem von einer 19-Jährigen“, schwärmt Sebastian. „Unterm Strich heißt das doch: Du hast deine Meinung, ich habe meine – und das sagt überhaupt nichts über uns als Menschen aus. Ich finde, das ist eine Fähigkeit, die den meisten Leuten abhandengekommen ist. Wenn man das aufs große Ganze übertragen würde, bräuchte man am Ende vielleicht keine Kriege mehr.“

»Jeder Mensch hat eine andere Vorstellung davon, was ›das Böse‹ bedeutet.«
Folgender kurzer Dialog, so lässt uns Sebastian wissen, habe sich beim Lesen des Textes besonders in seine Erinnerung gebrannt: „Ich habe wirklich den Eindruck, dass in unserer Zeit das Böse triumphiert.“ – „Ja, das glaube ich auch.“
Auch wenn der Autor des Stücks, das in den frühen 1990er Jahren unter den Eindrücken der zurückliegenden Reagan-Ära entstand, nicht erahnen konnte, was in den USA und der Welt in den folgenden drei Jahrzehnten passieren sollte, wirkt dieser kurze Gedankenaustausch heute aktueller denn je. „Jeder Mensch hat eine andere Vorstellung davon, was das Böse bedeutet, daher ist es schauspielerisch sehr schwer, mit dem Begriff umzugehen“, sagt Sebastian. „Allerdings wurde gerade uns Deutschen geschichtlich eingemeißelt, was passieren kann, wenn das Böse triumphiert. Wenn ich Gottfried Benn, Mascha Kaléko oder Lion Feuchtwanger lese – also Autorinnen und Autoren, die die Zeit des Nationalsozialismus erlebt und in Texten verarbeitet haben –, da wird mir wirklich anders, insbesondere wenn ich Parallelen zu den Entwicklungen in unserer heutigen Gesellschaft denke.“
Trotzdem sei er kein Pessimist, versichert uns Sebastian: „Ich hoffe, dass wir Menschen in der Lage sind, uns zu entwickeln und aus den Fehlern der Generationen vor uns zu lernen. Ich persönlich glaube, dass uns das gelingen kann – wie Orestes, der schon in der griechischen Tragödie den ewigen Kreislauf der Blutrache durchbricht und sagt: Ich mache dem ganzen Elend ein Ende.“

»Wichtig ist nur, dass jemand selbstständig wird durch das, was er auf der Bühne sieht.«
Sebastian schweigt für einen Moment und verrät uns dann, dass er überaus glücklich sei, dass es in Deutschland eine so vielfältige und große Theaterlandschaft gebe. Alleine durch die unzähligen Bühnen im Land habe Theater so etwas wie einen gesellschaftlichen Auftrag. „Aber danach wird es gleich sehr individuell“, ergänzt er. „Wenn man als Schauspieler am Theater arbeitet, sucht man sich bestenfalls ein Thema, bei dem man das Gefühl hat, dass es einen etwas angeht. Und dann hat man sechs Wochen oder acht Wochen lang die Möglichkeit, sich mit diesem Thema intensiv zu beschäftigen. Als gesellschaftlich interessierter Mensch kann man durch die Konfrontation oder Auseinandersetzung mit einem Thema zu Fragen kommen, die einen mehr interessieren als man selbst“, erklärt er und fügt hinzu: „Dass man das tun darf, ist ein Ausdruck von Freiheit. Und dass man dafür sogar Geld bekommt, ein riesiges Privileg.“
Sebastian erzählt, dass es ihn mit Glück erfülle, wenn er die Zuschauer durch sein Spiel dazu bringen könne, etwas Bestimmtes zu assoziieren oder zu empfinden. „Das kann auch mal Scham oder Abscheu sein“, sagt er. „Wichtig ist nur, dass jemand selbstständig wird durch das, was er auf der Bühne sieht.“ Und er ergänzt: „Wenn allerdings niemand im Publikum etwas mit dem anfangen kann, was ich da tue, haben wir ein Problem.“ Sofort schießen einem wieder die Worte von John Lennon in den Kopf, die der junge Schauspieler damals auf Instagram gepostet hatte: „Man muss sich auf das wirkliche Gefühl – das einfache, menschliche Gefühl – besinnen und es in einer einfachen Sprache ausdrücken, die die Menschen erreicht.“

»Vielleicht wächst da eine Gesellschaft heran, die verlernt, Mitleid zu empfinden. Die verlernt, dass es etwas anderes gibt außerhalb von mir.«
A propos John Lennon: Wir kommen auf Daddy’s Car zu sprechen – ein Song im musikalischen Stil der Beatles, der im September 2016 von Wissenschaftler des SONY CSL Research Lab veröffentlicht wurde. Das Lied wurde vollständig von einer künstlichen Intelligenz komponiert und geschrieben – auf Basis eines errechneten Querschnitts aller existierenden Beatles-Songs. Und auch wenn der Song alles andere als authentisch klingt, lässt es doch erahnen, in welche Richtung sich die Welt entwickeln wird. „Ich glaube“, vermutet Sebastian, „dass wir uns in den nächsten Jahren durch neue Technologien noch viel stärker verändern werden, als wir das bereits in den letzten zwei Dekaden getan haben. Was das mit zukünftigen Generationen machen wird, weiß ich nicht. Vielleicht wächst da eine Gesellschaft heran, die verlernt, Mitleid zu empfinden. Die verlernt, dass es etwas anderes gibt außerhalb von mir – etwas, das genauso groß ist wie ich und genauso komplex.“
Sebastian sagt, er habe die Hoffnung, dass Theater dieser Entwicklung in irgendeiner Form entgegenstehen könne – da es schon immer den Menschen in den Mittelpunkt gestellt habe und das auch zukünftig tun werde. „Menschen können Fehler machen, Menschen sind nicht perfekt – und werden es auch nie sein. Maschinen vielleicht schon“, erklärt er. „Aber ein Beatles-Song ist ja nur deshalb ein wahnsinnig guter Song, weil er eben nicht perfekt ist. Wenn man wie bei Daddy’s Car alles zusammenwirft und zu versucht, daraus etwas Perfektes zu entwickeln, verliert es seine Außergewöhnlichkeit. Unvollkommen sein ist etwas, was nur wir Menschen können.“
»Glück und Elend können vielleicht im selben Moment auf dich zukommen.«
Außerdem falle ihm noch etwas anderes ein, was der Mensch einer Maschine voraushabe: das Empfinden von Neugier. Und Neugier, erklärt Sebastian, bedeute letztendlich, sich immer wieder der Unklarheit zu stellen und für sich und andere herauszufinden, was dieses Neue bedeute. Das sei eine Form von ständiger Bewegung. Und er fügt hinzu: „In Bewegung, im Wachstum zu sein – das ist das, was mich antreibt.“
Diese Neugier, so sagt er, sei etwas, was er selbst jeden Tag aufs Neue erlebe. Dabei gehe es für ihn darum, sich dem Glück genauso auszusetzen wie dem Elend. Beides sei unfassbar wichtig. „Glück und Elend können vielleicht im selben Moment auf dich zukommen. Ich glaube, dass genau diese Ambivalenz das Leben ausmacht.“

3. Akt: Treptower Park
25. August 2019, wir treffen Sebastian Schneider ein drittes Mal. Der Schauspieler hat uns eingeladen, ihn bei einem Sonntagsspaziergang zu begleiten, und so schlendern wir zusammen erst durch den Görlitzer, dann durch den Treptower Park. Eigentlich wollten wir unser Gespräch mit Fragen zum Theaterstück Herz der Finsternis beginnen, in dem Sebastian ab dem 10. Oktober an der Schaubühne Lindenfels in Leipzig zu sehen sein wird. Gerade hat er intensive Probewochen hinter sich.
Doch ein ganz anderes Thema drängt sich geradezu auf, auch weil es fast unmöglich ist, der medialen Berichterstattung dazu zu entgehen: Der brasilianische Regenwald steht in Flammen, eine Katastrophe biblischen Ausmaßes. „Ich dachte ja“, sagt Sebastian mit besorgter Stimme, „dass es keine Bilder gibt, die mich noch schockieren könnten. Aber auf diese Fotos, die die abertausenden Feuer im Amazonasgebiet zeigen, war ich wirklich nicht vorbereitet – auch nicht darauf, was das emotional mit mir macht. Ich kann das gar nicht in Worte fassen.“
»Der Mensch handelt immer erst dann, wenn es ihn persönlich angeht oder wenn es viel zu spät ist.«
Sebastian lässt seine Augen durch die sattgrüne Parklandschaft wandern. Dann fährt er fort: „Was mich extrem nachdenklich macht, ist, dass die Menschheit scheinbar immer noch nicht so weit ist, rechtzeitig zu reagieren. Es ist doch irgendwie komisch, dass der Mensch auf eine gewisse Art und Weise so gemütlich ist, oder? Er handelt immer erst dann, wenn es ihn persönlich angeht oder wenn es viel zu spät ist. Es fällt ihm extrem schwer, sich aus dieser Lähmung zu befreien, die auch unsere Generation so stark befallen hat.“ Sebastian erklärt, dass er normalerweise ein von Grund auf optimistischer Typ sei. „Aber ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, dass ich nicht große Sorge habe, was die Zukunft unserer Welt betrifft,“ lässt er uns wissen.
Dennoch: Das Letzte, was der Schauspieler jemals aufgeben werde, sei die Hoffnung. „Ich glaube, dass wir – insbesondere die Leute im Alter zwischen 20 und 40 – eine extreme Kraft besitzen“, sagt Sebastian. „Noch hat das Böse nicht triumphiert. Aber um das zu verhindern, müssen wir uns aktiv die Frage stellen, was wir überhaupt wollen – und uns dann sehr schnell entscheiden, was wir tun können, um das zu erreichen.“ Und er ergänzt: „Wenn’s etwa ums Klima geht, braucht es ganz konkrete Entscheidungen, Verabredungen und Gesetze. Und Leute, die mutig genug sind aufzustehen und zu sagen: Ich denke anders!“

»Greta Thunberg tut nichts anderes, als sich selbst in dem ernst zu nehmen, was sie fühlt.«
Die in der Gesellschaft weit verbreitete Einstellung, als Einzelner könne man eh nichts ausrichten, lasse er nicht gelten: „Das ist eine Ausrede, um das eigene Nichtstun zu legitimieren“, sagt er. Man könne immer etwas tun, auch als einzelne Person. „Dass ein 16-jähriges Mädchen es schafft, mit den einfachsten Mitteln eine weltweite Jugendbewegung zu starten, die die zweitgrößte nach den Beatles ist, ist das beste Beispiel“, erklärt Sebastian und fügt hinzu: „Was macht Greta Thunberg denn letztlich? Sie tut nichts anderes, als sich selbst in dem ernst zu nehmen, was sie fühlt. Dabei geht sie in einer bestimmten Radikalität mit sich selbst um und sagt: Ich kann bestimmte Dinge nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Deshalb lasse ich sie sein. Das ist das Einzige, was sie tut.“
Wir laufen an einigen Ausflugsdampfern und Hausbooten vorbei, die im kleinen Hafenbereich am nordwestlichen Ende des Treptower Parks vor Anker liegen. „Heiterkeit“ und „Frohsinn“ steht auf zweien geschrieben. Was für eine schöne, Mut machende Geste! Und was für ein deutlicher Wink mit dem Zaunpfahl, endlich über Herz der Finsternis zu sprechen.
Der Literaturklassiker von Joseph Conrad aus dem Jahr 1899 beginnt passenderweise mit einer Szene, die sich an Bord einer Hochseeyacht auf der Themse abspielt. Dort wartet Kapitän Marlow zusammen mit ein paar anderen Männern auf die einsetzende Flut. Während sie dort ausharren, beginnt der Kapitän, eine Geschichte zu erzählen, die sich in seinem Leben vor Jahren ereignete und die er seitdem mit sich herumgetragen hat. Diese Geschichte handelt davon, wie er einst auf einem Flussdampfer im belgischen Kongo anheuerte – aus purer Abenteuerlust und Neugier. Bereits als Kind träumte er davon, die vielen weißen Flecken zu erkunden, die es damals noch auf der Landkarte gab. Das Innere des Kongo war ein solcher weißer Fleck.
Für den Kapitän wird das Erkunden dieses weißen Flecks zu einer bedrückende Reise in das „Herz der Finsternis“ eines unbekannten Kontinents, die er, so beschreibt es Joseph Conrad, „wie eine ermüdende Pilgerfahrt durch angedeutete Alpträume“ empfindet. Aber nicht nur das: Gleichzeitig entwickelt sich diese Expedition für Marlow auch zu einer Reise zu sich selbst – und er wird mitten in der unheimlichen Fremde mit seinem innersten Selbst konfrontiert.

»Im Leben geht es nicht darum, alles verstehen zu müssen. Sondern darum, das Unbekannte als etwas anderes wahr- und anzunehmen.«
„Für diese Übermacht der Natur, der der Kapitän auf seiner Reise ausgesetzt ist“, erklärt Sebastian, „fehlen ihm eigentlich permanent die Worte. Ihm gelingt es nicht zu beschreiben, was er da sieht – weil er es mit seinem westlichen Erkennungsmechanismus, der ihm inne ist, nicht greifen kann.“ Und er ergänzt: „Für mich ist dieser Roman ein Lobgesang auf das Nichtbegreifen, Nichtverstehen, Nichtordnen und Nichtunterwerfen der Natur. Wir Menschen streben ja danach, das Gegenteil zu tun – etwas zu unterwerfen, zu kontrollieren und uns an die Spitze zu setzen. Aber ist es nicht viel spannender herauszufinden, was genau passiert, wenn man das nicht tut? Wenn man diesen menschlichen Mechanismus reflektiert und versucht, das Unbekannte und Unvorhersehbare auszuhalten. Und wenn man beobachtet, was das Neue ist, das dabei entstehen kann.“
Diese Systematik könne man auf alles im Leben übertragen, sagt Sebastian – etwa auf die Liebe: „Am meisten interessiert mich doch, was mein Gegenüber von mir selbst unterscheidet. Wenn alle Menschen so wären wie ich, dann könnte ich ja permanent bei mir zuhause vorm Spiegel sitzen und mich anschauen. Das ist doch langweilig“ Und er erklärt: „Im Leben geht es nicht darum, alles verstehen zu müssen. Sondern darum, das Unbekannte als etwas anderes wahr- und anzunehmen und offen dafür zu sein, was dann passiert.“
Dieses Unbekannte war in Sebastians Leben vor einigen Jahren noch die Sparte Film und Fernsehen. Den Beruf des Schauspielers habe er in seiner Kindheit und Jugend nur über das Theater kennengelernt, erklärt er. Doch das änderte sich mit seiner Rückkehr aus der Schweiz. Kurz nachdem Sebastian in Berlin wieder Fuß gefasst hatte, übernahm er auch immer öfter Rollen in Film- und Fernsehproduktionen. „Film ist gerade etwas, was mich unfassbar umtreibt und sehr, sehr interessiert“, erzählt er. „Mich fesselt dabei vor allem die Art und Weise, wie man die Figuren anlegt und auf welche Reise man mit ihnen geht.“ Und er fügt hinzu: „Ich habe das Gefühl, dass ich da sehr viel lernen kann – nicht, dass das beim Theater nicht so wäre. Aber diese absolute Zuspitzung auf den Moment, wie es vor der Kamera passiert, empfinde ich als etwas extrem Reizvolles. Die Klappe fällt und man gibt 150 Prozent – für zwei Minuten. Dann folgt eine längere Phase der Entspannung, bis die nächsten 150 Prozent gefordert sind.“
»Was heißt es heute, im Jahr 2019, ein Mann zu sein? Was wird da von einem erwartet in unserer Gesellschaft?«
Momentan steht Sebastian für das ZDF-Format Helen Dorn vor der Kamera, in dem er „Lola, eine Frau mit männlichen Geschlechtsmerkmalen“ spielt. „Durch diese Rolle habe ich mir immer wieder die Frage gestellt, was die Begriffe Männlichkeit und Weiblichkeit überhaupt bedeuten“, erklärt er und fragt: „Was heißt es heute, im Jahr 2019, ein Mann zu sein? Was wird da von einem erwartet in unserer Gesellschaft? Ich persönlich habe für mich festgestellt, dass ich mit den Männlichkeitsbildern, die man aus der Vergangenheit kennt, nicht so viel anfangen kann – obwohl ich selbst ja ein Mann bin.“ Und er verrät: „Ich merke, dass Menschen oft überrascht sind, dass ich als Mann in irgendeiner Form sehr sensibel und gefühlvoll bin. Manche können das gar nicht so richtig einordnen. Aber zu den gängigen Klischees, die es so gibt, fühle ich mich einfach nicht zugehörig. Die habe ich zwei Jahre lang zuhause in Bremen erlebt – und vor allem gelebt –, als ich bei Werder im Stadion in der Ostkurve stand. Dort habe ich immer so geschrien, dass ich danach total heiser war. Das brauche ich heute nicht mehr.“
Oft ist Sebastian nicht mehr in Ottersberg bei Bremen, wo nach wie vor der Großteil seiner Familie lebt und wo er mal zuhause war. Aber wenn er dort mal wieder zu Besuch sei, lässt er uns wissen, dann sei er dort besonders gerne. Für ihn sei das Wort Zuhause eh nicht an so etwas wie Heimat gebunden, sondern habe eine ganz andere Bedeutung: „Zuhause sein heißt doch eigentlich, dass man so sein kann, wie man ist, ohne dass es gegen einen verwendet werden kann – weil Zuhause im Idealfall ein absolut sicherer Ort ist. Und auch ein Ort, an dem Zukunft möglich ist: Weil ich dort so sein kann, wie ich bin, bin ich in der Lage, von mir aus nach vorne zu gehen.“
Nach vorne, vorbei an „Heiterkeit“ und „Frohsinn“.
In ständiger Bewegung.
Und in der Tasche ein Buch wie ein bester Freund.
Klingt wie die Anleitung zu einem guten Leben.
#sebastianschneider #theater #maximiliankoenig #jonasmeyer #mypmagazine
Mehr von und über Sebastian Schneider:
ahoi.agency/talent/sebastianschneider
instagram.com/sebastianschneiderr
Text: Jonas Meyer
Fotografie: Maximilian König
maximilian-koenig.com
instagram.com/studio.maximilian.koenig
Assistenz: Frederike van der Straeten
Christian Scholz
In Memoriam — Prof. Christian Scholz
Natur, die ewig weitergeht
»Einen Ort mit Worten zu beschreiben, ist wie Farbe in Schwarz-Weiß zu beschreiben.« 2011 veröffentlichte Prof. Christian Scholz diese Zeilen in unserer zweiten MYP-Ausgabe. Vor wenigen Tagen ist er plötzlich und unerwartet verstorben. Mit seinem Text zum Thema »Mein Platz« erinnern wir an einen ganz besonderen Menschen, der viel zu früh von uns gegangen ist.
11. Oktober 2019 — MYP N° 26 »Stil« — Foto & Text: Prof. Christian Scholz

Ein Zimmer mit großen Landkarten an den Wänden: Farbige Pins markieren besuchte Orte auf der ganzen Welt. Doch was ist „mein“ Platz? Für ihn gibt’s keinen Pin. Er liegt in der Mitte. Um ihn dreht sich alles. Ein kleines Holzhaus in Österreich mit Blick auf den Attersee. Ja, der Satz klingt kitschig. Trotzdem: Hier bin ich seit über 50 Jahren mehrere Wochen pro Jahr.
Am Anfang stand das Haus ganz alleine da. Inzwischen hat es viele Nachbarn bekommen. Am Anfang war ich froh, auf dem Grundstück irgendwo hinter dem Haus etwas Schatten zu finden. Inzwischen sind die Bäume so hoch, dass man das Haus mit Google Earth kaum noch erkennen kann. Aber jetzt hat es ein taubenblaues Metall-Dach. Doch das hat Google noch nicht erkannt.
Hier lernte ich Latein-Vokabeln, bereitete mich auf mein Diplom-Examen vor, feierte Promotion und Habilitation. Und saß stundenlang an Manuskripten. Bücher, Aufsätze, Kolumnen: Ganz vieles ist hier entstanden. Weit weg von Stress und nur mit einem weißen Blatt Papier oder einem nicht mehr weißen MacBook.
Vom Balkon aus kann ich auf den See schauen. Früher war ich dort wochenlang beim Windsurfen. Einmal einen Sommer lang, der aus drei Monaten bestand. Nicht der Summer of 69, aber so ähnlich.
Unterschiedliche Wetterlagen: klirrende Kälte, dick zugeschneit, Holz holen. Oder schwüle Sommerabende mit tobenden Gewittern, die von West nach Ost über den See ziehen. Auf der Terrasse sitzen: Blitze zählen, Grünen Veltliner trinken. Am Morgen: das Gefühl, langsam aufzuwachen. Klappernde Kaffeetassen aus Gmundner Keramik. Traditionelle Himbeermarmelade. Als ganz kleines Kind habe ich dort gespielt. Dann mit eigenen Kindern gespielt.
Jeden Sommer. Viele Ostern. Einige Pfingsten. Manche Winter. Immer dieser Ort. Einen Ort mit Worten zu beschreiben, ist wie Farbe in Schwarz-Weiß zu beschreiben. Es geht nicht.
Endlos schöne Sommertage. Routinen, die in einem halben Jahrhundert erlernt wurden. Sozial konstruierte Realität jenseits der realen Hektik der Welt. Gefühle? Natürlich Entspannung, Geborgenheit, Ausgelassenheit – aber auch Konzentration, Energie und Gestaltungswille.
Und Natur. Die ewig weitergeht. Auch noch in vielen Generationen. Irgendwie. Aber definitiv!

Prof. Christian Scholz † (1952-2019)
Der Text wurde am 16. April 2011 in MYP Magazine N° 2 erstveröffentlicht.
#christianscholz #professor #hr #inmemoriam #mypmagazine
Offizielle Websites von Prof. Christian Scholz †:
Josh Byer
Submission — Josh Byer
Ghosts Of The Lower Mainland
With his collection of British Columbian landscapes, Vancouver-based artist Josh Byer presents paintings that keep a secret: Each of them contains hidden images that become visible only when exposed to UV light. So they inform the viewer about the social, historical, or environmental context of the original composition.
8. Oktober 2019 — MYP N° 26 »Stil« — Paintings: Josh Byer
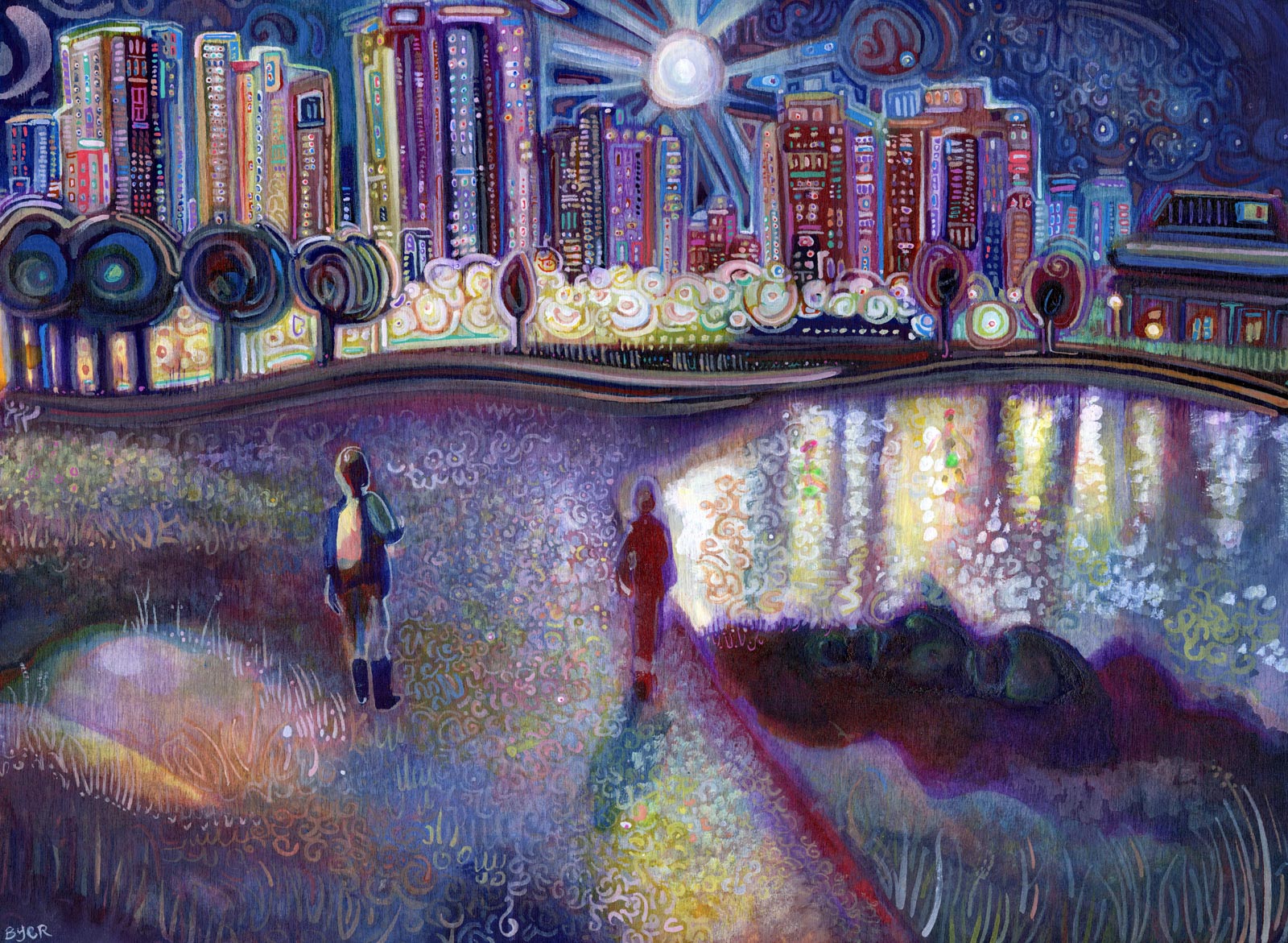
English Bay In The Moonlight, mixed media on wood panel, 12” x 16”

The Owl Goddes, mixed media on cold press paper, 11” x 15”

An Abandoned Farm In Langley, mixed media on wood panel

Harrison Lake, mixed media on wood panel, 12” x 16”

Gabriola House No.3, mixed media on paper, 11” x 15”

Herons Above Stanley Park, mixed media on wood panel, 24” x 30”

Ironworkers Memorial Bridge No. 1, mixed media on wood panel, 12” x 16”

Ironworkers Memorial Bridge No. 2, mixed media on wood panel, 12” x 16”
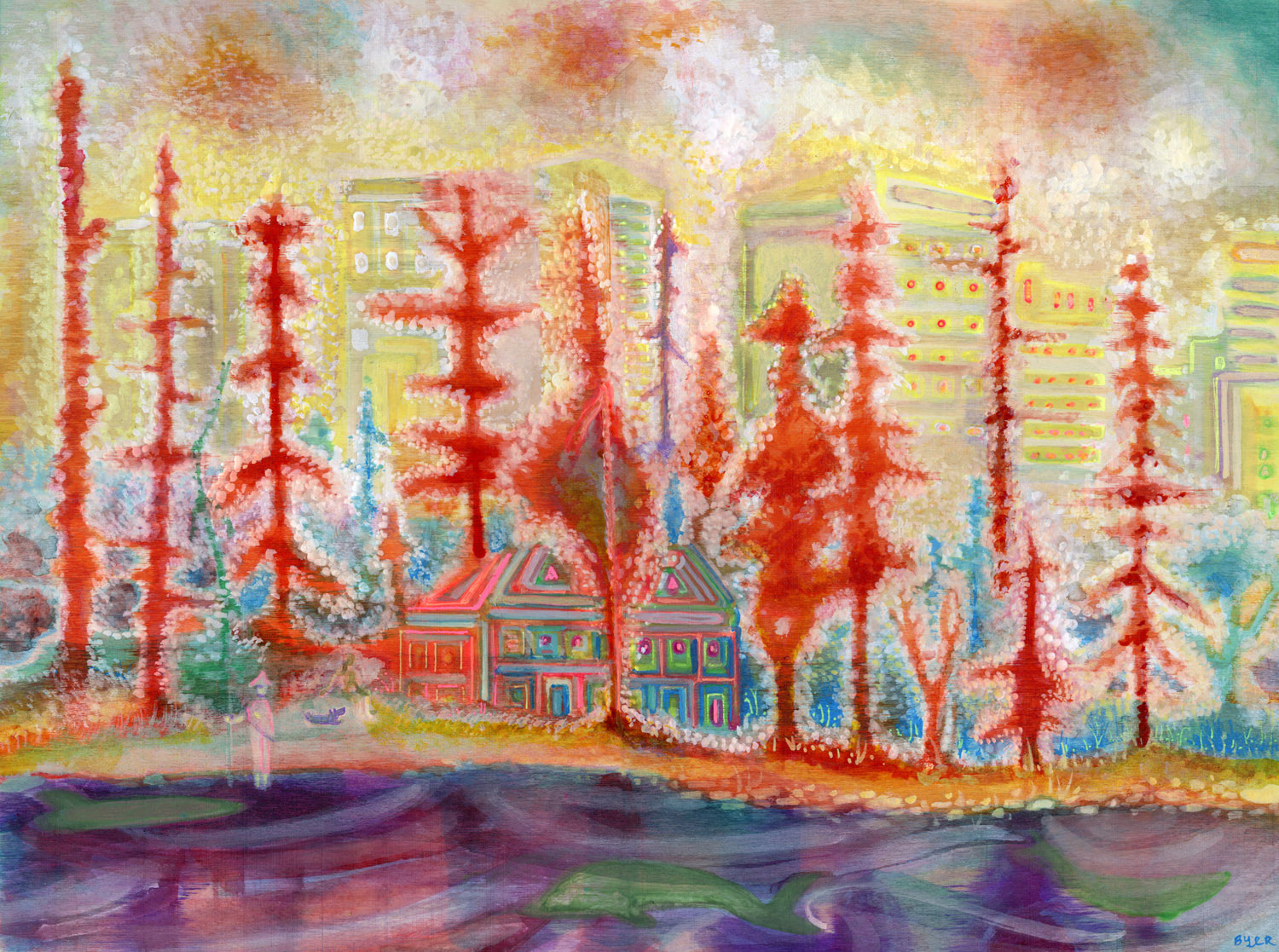
Dead Man’s Island No.1, mixed media on wood panel, 12” x 16”
#joshbyer #fauxfauvism #painting #uvlight #mypmagazine
Art by Josh Byer:
Tom Böttcher
Editorial — Tom Böttcher
Stilles Ensemble
Schauspieler Tom Böttcher ist nicht nur in der deutschen Film- und Fernsehwelt zuhause, sondern hat vor ein paar Jahren auch seine Liebe zur Fotografie entdeckt. Am liebsten portraitiert er Kolleginnen und Kollegen. Wir zeigen einige seiner nahbarsten Bilder.
27. September 2019 — MYP N° 26 »Stil« — Fotografie: Tom Böttcher

Paul Boche

Johanna Polley

Alexander Sehan

Paul Boche

Kira Molter

Ingmar Böske

Sarah Schulze-Tenberge

Ludwig Simon

Justus Johanssen

Kira Molter

Kira Molter

Max Hegewald

Paul Boche

Justus Johanssen

Justus Johanssen

Paul Boche

Sarah Schulze-Tenberge

Justus Johanssen

Johanna Polley

Ludwig Simon

Zoë Valks
#tomboettcher #stillesensemble #schauspieler #mypmagazine
Fotografie: Tom Böttcher
instagram.com/tmbtt
instagram.com/tomboettcher
agentur-gipfelstuermer.de
Simon Sumbert
Opinion — Simon Sumbert
#FreeCarola – und der Rest?
Ausgehend von den Ereignissen rund um die »Sea-Watch 3« nimmt Simon Sumbert, 21 Jahre alt und Mitglied des Freiburger Stadtrats, zu den »dringlichsten politischen und moralischen Aspekte der Geflüchtetenpolitik der Europäischen Union« Stellung – und appelliert für mehr Engagement und Humanität in der Gesellschaft.
21. September 2019 — MYP N° 26 »Stil« — Text: Simon Sumbert, Fotos: Sea-Watch e.V.

Foto: Fabian Melber
»Ich will nicht auf Heldinnen und Helden hoffen müssen, damit ich mir sicher sein kann, dass die Europäische Union jedem Menschen sein Grundrecht auf Leben zugesteht.«
„Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit.“ [1]
„Jeder hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person.“ [2]
Carola Rackete war vor ein paar Wochen in aller Munde. Die deutsche Kapitänin der „SeaWatch 3“ wurde von der italienischen Polizei auf Lampedusa festgenommen. Der offizielle Vorwurf lautete „Beihilfe zur illegalen Einwanderung“. Dieser Vorwurf war rechtlich natürlich nicht zu halten, aber um all das geht es mir auch nicht. Vielmehr geht es mir darum, dass sich im Jahr 2019 in Deutschland, Europa und der sonstigen westlichen Welt Risse auftun, wo keine sein sollten, wo keine sein dürfen. Da, wo es um das elementarste Grundrecht eines jeden Einzelnen geht. Das Grundrecht auf Leben.

Foto: Chris Grodotzki / jib collective
Carola Rackete hat in einer konkreten Situation, als sie mit ihrer Crew und über vierzig aus dem Mittelmeer geretteten, erschöpften, teilweise suizidalen Geflüchteten unterwegs war, eine Entscheidung getroffen. Es war die Entscheidung, nicht länger zu akzeptieren, dass die Europäische Union mit ihren 500 Millionen Einwohner*innen und ihrem milliardenschweren Haushalt in 14 Tagen keine Lösung zur Aufnahme von 42 geflüchteten Menschen finden konnte. Eine Entscheidung, freiwillig ins Gefängnis zu gehen, weil sie ihre Crew und die Geretteten nicht weiter gefährden wollte. Carola Rackete ist zweifelsfrei eine Heldin. Für mich persönlich hat die Sache aber einen großen Haken:
Ich will nicht auf Heldinnen und Helden hoffen müssen, damit ich mir sicher sein kann, dass die Europäische Union jedem Menschen sein Grundrecht auf Leben zugesteht. Ich will Gesetze und Regeln und ich will, dass es nie wieder einen Riss in der europäischen Gesellschaft gibt, wenn es um die Frage geht, ob man Menschenleben retten soll oder auch nicht. [3]

Foto: Jon Stone
Das ist, glaube ich, nicht nur mein persönliches Ziel, sondern auch das von Carola Rackete und allen weiteren, vernünftigen Menschen, die etwas von den sogenannten europäischen Werten halten. Und dieses Ziel sollte auch verfolgt werden, wenn die Presse nicht voll von Berichten ist über eine deutsche, weiße Frau, die wegen ihres Engagements verhaftet wird.
Ich bin kein Held wie Frau Rackete, nicht einmal ansatzweise, aber ich weiß, dass der Weg zu diesem Ziel ein langer ist, der nur durch viel Bildungs- und Aufklärungsarbeit und klare Kante gegen menschenfeindliche Ideologien begehbar wird. Ich weiß auch, dass man das Erreichen dieses Ziels nicht nur an Fragen der Migrationspolitik messen kann.

Foto: Felix Weiss
Dennoch gibt es aktuell wohl kein besseres und gleichzeitig grausameres Beispiel für das, was passiert, wenn nicht zumindest mit allen Mitteln versucht wird, dieses Ziel zu erreichen: tausendfaches Sterben von Menschen im Mittelmeer in den letzten Jahren.
Tausendfaches, grausames, unvorstellbares Leid von Männern, Frauen und Kindern.
Als ich 13 Jahre alt war, habe ich das erste Mal passiv miterlebt, welche konkreten Auswirkungen politische Entscheidungen und der verallgemeinernde Umgang mit Geflüchteten für die Betroffenen haben. Seitdem engagiere ich mich ehrenamtlich und zeitweise auch hauptamtlich in verschiedenen Einrichtungen der Geflüchtetenhilfe in Freiburg. In dieser Zeit habe ich viele geflüchtete Menschen kennenlernen dürfen. Mit manchen habe ich mich überhaupt nicht verstanden. Mit manchen bin ich noch heute in Kontakt und befreundet. Manche zähle ich heute zu meiner Familie.
In jedem Fall habe ich in den letzten acht Jahren viele persönliche Erfahrungen gesammelt, zumindest sofern das aus meiner Perspektive möglich ist.

Foto: Fabian Melber
»Gerade beim Thema Geflüchtetenpolitik geht es vor allem um die Frage, ob wir wirklich nach den Werten leben und handeln wollen, auf die wir uns berufen und auf die wir stolz sind.«
Mit diesem Text will ich versuchen, jeden Menschen, der sich für eine humanere Geflüchtetenpolitik einsetzt, zu bestärken und zu unterstützen.
Gleichzeitig will ich auch versuchen, die Menschen, die sich bisher aus verschiedensten Gründen noch nicht an der Debatte beteiligen wollen oder können und keine Stellung beziehen, zu überzeugen, genau dies – mit einem faktenbasierten Grundwissen dazu – zu tun. Ich glaube nicht, dass es viele Zeitpunkte in der jüngeren Geschichte gab, in denen genau das wichtiger war.

Foto: Fabian Melber
Dafür möchte ich in folgendem Text meine Erfahrung, mein Wissen und meine Meinung zu den dringlichsten politischen und moralischen Aspekten der Geflüchtetenpolitik der Europäischen Union, ihren einzelnen Mitgliedsstaaten und ihren Konsequenzen erklären. Dazu gehören selbstverständlich sowohl die positiven als auch die negativen Seiten dieser Politik.
Gerade beim Thema Geflüchtetenpolitik geht es aber schlussendlich und vor allem um die Frage, ob wir wirklich nach den Werten leben und handeln wollen, auf die wir uns berufen und auf die wir stolz sind. Und das ist ultimativ immer eine moralische Frage.

Foto: Chris Grodotzki / jib collective

Foto: Sea-Watch e.V.
»Ein zentraler Bestandteil des Rechtsrucks in Europa in den letzten Jahren war das aktive, willentliche Verbreiten und das passive, naive Glauben von falschen Informationen im politischen Kontext.«
Die „Flüchtlingskrise“ – eine deutsche Geschichte
Deutschland ist heute ein tief gespaltenes Land. Die aktuelle Dekade wird als ein Jahrzehnt in die Geschichtsbücher eingehen, indem es Populisten, Nazis und Demagogen in Deutschland und europaweit geschafft haben, in Parlamente gewählt zu werden und zunehmend mehr Raum im gesellschaftlichen Diskurs einzunehmen.
Migrations- und Integrationspolitik ist definitiv nicht der alleinige Auslöser dieser traurigen Entwicklung. Sie ist viel mehr der Tropfen im berühmten übervollen Fass und gleichzeitig Katalysator dieser Entwicklungen. Ein zentraler Bestandteil des Rechtsrucks in Europa in den letzten Jahren war das aktive, willentliche Verbreiten und das passive, naive Glauben von falschen Informationen im politischen Kontext.
Ich denke, dass es essenziell wichtig ist, dass solchen „Fake News“ vehement entgegentreten wird. Der Trick an guten Lügen und „Fake News“ ist, dass oft nur ein kleiner Teil des Gesamtkontextes einer Situation ausgelassen oder geändert wird, sodass sich das wahrgenommene Bild einer Begebenheit komplett ändert, die Hintergrundgeschichte aber immer noch relativ plausibel erscheint. Um diese Lügen zu entkräften, muss man ebendiesen Gesamtkontext korrekt und anschaulich darstellen und klarmachen, wo genau entscheidende Details ausgelassen oder abgeändert wurden und das Gesamtbild verzerrt wird. Und auch, wo nicht.

Foto: Marcus Wiechmann
Die Geflüchtetenpolitik der letzten Jahre in Deutschland ist gescheitert, und zwar in den allermeisten Aspekten. Was bleibt, sind aktuell eine große Frustration und Resignation, sowohl bei vielen Menschen, die ihr Leben lang in Deutschland gelebt haben, als auch bei Geflüchteten. Ich halte es ganz grundsätzlich für falsch, nicht jeden Menschen als Individuum zu erachten und auch dementsprechend zu behandeln. Im Folgenden werde ich dennoch manches vereinfachen müssen und die äußerst heterogenen Gruppe von Menschen, die seit September 2015 nach Deutschland geflohen ist, ein Stück weit unter einen Hut stecken, um problematische und teilweise gefährliche Tendenzen ansprechen zu können, ohne dabei endlos auszuholen – und auch um jenen Menschen adäquat antworten zu können, die diese Verallgemeinerungen per se nutzen, um gegen Menschengruppen zu hetzen.

Foto: Marcus Wiechmann
»Die deutsche Verwaltung war mit der großen Anzahl an Geflüchteten komplett überfordert.«
In vielen exemplarisch genannten Politikbereichen entstehen Problematiken übrigens auch erst durch die konkrete Masse und nicht durch die einzelnen Individuen.
In Deutschland wurden seit Anfang des Jahres 2015 bis Mai 2019 1.704.837 Asylanträge gestellt, wovon 116.617 Asylfolgeanträge und 1.558.220 Asylerstanträge waren. Die damalige Entscheidung zur Aufnahme all dieser Geflüchteten hat Konsequenzen für quasi jeden einzelnen politischen und gesellschaftlichen Teilbereich der BRD.
Die deutsche Verwaltung war mit der großen Anzahl an Geflüchteten komplett überfordert. Dies lag – abgesehen von der schieren Anzahl an Menschen, die in Deutschland Asyl suchten – auch daran, dass vielerorts die Infrastruktur zur Aufnahme und Versorgung von geflüchteten Menschen, die in den 90er Jahren während der großen Konflikte in Osteuropa und der daraus resultierenden Fluchtmigration aufgebaut wurde, rund um die Jahrtausendwende nicht intakt gehalten oder sogar zurückgebaut wurde.

Foto: Chris Grodotzki / jib collective
Die bürokratische Überforderung führte indes nicht nur zu Schwierigkeiten im Bereich Verwaltung und Logistik, sondern auch zu sicherheitspolitischen Problemen und Risiken. Ab September 2015 bis September 2016 wurden jeden Monat mindestens 40.000 Asylanträge gestellt, die überwiegende Mehrheit davon Erstanträge. [4] Bei solch hohen Zahlen ist und war es den deutschen Sicherheitsbehörden nicht möglich, die Identität jedes einzelnen geflüchteten Menschen genau zu überprüfen. Das Resultat dieser Situation war wiederum, dass es durchaus eine ungewisse Anzahl an Menschen gab, die sich an deutschen und europäischen Grenzen als Geflüchtete und Schutzsuchende ausgegebene haben, in Wahrheit aber terroristische Anschläge planten und oft genug leider auch durchführten. [5] Diese Tatsache darf meiner Meinung nach niemals dazu führen, dass man in Deutschland Menschen mit berechtigtem Fluchtgrund nicht aufnimmt. Sie darf aber auch niemals verschwiegen werden.
In jedem Land, das Geflüchtete aufnimmt, werden die staatlichen Sozialsysteme dadurch beansprucht. In Deutschland erhält ein Mensch, dessen Asylantrag in Bearbeitung ist, aktuell das „Existenzminimum“ nach deutschen Standards. Dies bedeutet für einen alleinstehenden Menschen Regelleistungen zwischen 359 Euro im Monat nach dem AyslBLG, oder – nach Abschluss des Asylverfahrens oder dem Ende einer bestimmten Frist – eine monatliche Regelleistung im Rahmen des Hartz 4-Regelsatzes von 424 Euro pro Monat durch das zuständige Jobcenter. Zusätzlich wird zu beiden Regelleistungen natürlich noch die Unterkunft des Menschen bezahlt, solange sich die Kosten dafür nach den Standards der jeweiligen Kommune im angemessen Rahmen befinden. Außerdem werden für geflüchtete Menschen, deren Asylantrag anerkannt wird, auch sogenannte „Integrationskurse“ und diverse andere Bildungsangebote finanziert.

Foto: Erik Marquardt
»Die Aufnahme von geflüchteten Menschen darf in keinem Fall durch ein Kostenargument verhindert werden. Die Wahrung von Menschenrechten ist unbezahlbar.«
Nun kann man lang und breit und berechtigterweise über die Höhe und Angemessenheit dieses Existenzminimums und der Finanzierung der Integrationskurse etc. diskutieren. Dabei kann man dann zum Beispiel darauf hinweisen, dass aktuell immer mehr geflüchtete Menschen in Ausbildung und Arbeit finden und dass die daraus resultierenden Steuereinnahmen, wenn man diese Entwicklung stärker und effizienter politisch unterstützt, hoch genug sein können, um die aktuellen Ausgaben mittelfristig mindestens auszugleichen.
Ich persönlich möchte mich auf so eine Diskussion aber nicht einlassen, denn für mich steht fest:
Die Aufnahme von geflüchteten Menschen darf in keinem Fall durch ein Kostenargument verhindert werden. Die Wahrung von Menschenrechten ist unbezahlbar.
Die soziale Frage ist aber nicht auf die finanziellen Kosten beschränkt, denn es entstehen durch die Aufnahme von Geflüchteten auch zahlreiche andere gesellschaftliche Spannungsfelder. Der gefühlte Konsens, dass in Deutschland jeder Mensch Anrecht auf genügen Geld zum (Über-)Leben haben sollte, ist schwer zu vermitteln, wenn ein Mensch einen Großteil seines Lebens gearbeitet hat, in die Langzeitarbeitslosigkeit fällt und dann erfährt, dass er vom Staat dieselbe Unterstützung bekommen wird wie die geflüchteten Nachbarn, die seit einem Jahr in Deutschland sind.

Foto: Fabian Melber

Foto: Fabian Melber
»Die deutsche Wohnungs- und Bildungspolitik war in Teilen auch schon vor 2015 äußerst fragwürdig und steuerte geradewegs auf die aktuelle Situation zu.«
Ähnliche Situationen ergeben sich auch in der Wohnungs- und Bildungspolitik, denn natürlich hat der fluchtbedingte Zuzug von über 1,5 Millionen Menschen drastische Auswirkungen auf diese Bereiche und trägt zur aktuellen Lage, sprich Wohnungsnot und Lehrer*innenmangel bei. Auch hierbei ist es jedoch wichtig, immer wieder zu betonen, dass die Aufnahme von Geflüchteten diese Problematiken zwar verschärft, insbesondere wenn man die Demographie und durchschnittliche Geburtenrate der geflüchteten Menschen in Deutschland berücksichtigt. Sie ist aber auf keinen Fall die einzige Ursache oder auch nur der entscheidende Faktor dieser Probleme.
Menschen, die den Großteil ihres Lebens gearbeitet haben, verdienen meiner Meinung nach mehr als das nackte Existenzminimum, falls sie arbeitslos werden sollten. Die deutsche Wohnungs- und Bildungspolitik war in Teilen auch schon vor 2015 äußerst fragwürdig und steuerte geradewegs auf die aktuelle Situation zu. Geflüchtete werden in diesem Kontext zu oft als der alleinige Sündenbock gesehen.

Foto: Ruben Neugebauer
»Repressionen gegenüber Geflüchteten und im extremem Fall Abschiebungen gehen die Wurzel des Problems nicht wirklich an, sondern verlagern dieses bestenfalls.«
Abgesehen von der Nennung konkreter und schwieriger Sachverhalte durch die Aufnahme von so vielen geflüchteten Menschen, muss ich an dieser Stelle auch noch anmerken, dass es oftmals nicht nur politische und soziale Probleme sind, sondern auch kulturelle.
Zumindest persönlich habe ich erlebt, dass Antisemitismus, Rassismus, Frauenfeindlichkeit sowie Homophobie und Queerfeindlichkeit unter Geflüchteten weit verbreitet sind und auch aktiv weitervermittelt werden. Dies betrifft Geflüchtete untereinander, wenn sich beispielsweise in Geflüchteten-Wohnheimen Hierarchien nach der Herkunft der Menschen bilden, Frauen innerhalb der Familie häusliche Gewalt erleben, oder jüdische Spätaussiedler aus Russland vor der eigenen Zimmertür antisemitisch angefeindet werden. Vor allem aber richtet sich dieser Hass gegen jedes Mitglied unserer offenen Gesellschaft, insbesondere gegen Angehörige marginalisierter Gruppen. An dieser Tatsache gibt es nichts klein- oder schönzureden.
Repressionen gegenüber Geflüchteten und im extremem Fall Abschiebungen gehen die Wurzel des Problems aber auch nicht wirklich an, sondern verlagern dieses bestenfalls. Was wirklich hilft gegen Hass dieser Art, ist Aufklärungsarbeit und Bildung. Und zwar mit der Gießkanne. Und zwar schon ab der frühen Jugend, damit zumindest jedem Kind rassistischer, antisemitischer, sexistischer und homophober Eltern in Zukunft zumindest ansatzweise die Möglichkeit und das Wissen um Unterstützung vermittelt wird, das nötig ist, um sich von solchen Ressentiments und deren Umfeld loszusagen.

Foto: Marcus Wiechmann
»Schon der Weg nach Europa ist für die meisten Geflüchteten mit unzähligen, tödlichen Gefahren und Wagnissen gepflastert.«
„Flüchtlingskrise“ – eine Geschichte voller Ungerechtigkeit
Es gibt hunderte Probleme auf der Welt, die dadurch entstehen, dass Menschen nicht mehr in ihren Heimatländern leben wollen und können. Der aktuelle Umgang mit diesen Problemen verschlimmert diese aber mehr, als zu helfen. Im ersten Kapitel dieses Textes habe ich versucht, die Probleme der Aufnehmenden darzustellen. Aber zu jeder umfassenden Problemdarstellung gehören zwei Seiten und in der Politik eigentlich mindestens siebenundzwanzig.
Viele Geflüchtete in Freiburg sind beispielsweise aus Gambia geflohen. Ein Land, das laut der Einschätzung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge relativ sicher ist.
Ich habe einmal zu oft gehört, was Geflüchteten in Gambia, auf dem Weg durch Zentralafrika und die Sahara und in Europa passiert und wie mit ihnen überall auf der Welt umgegangen wird.

Foto: Marcus Wiechmann
Ich will versuchen, gemeinsame Punkte und Erlebnisse innerhalb dieser Biographien zu erzählen und zusammenzufassen. Denn genau durch diese Biographien habe ich gelernt, dass Migrationspolitik in Deutschland mindestens zwei Seiten hat und dass nicht nur die Aufnehmenden genug Gründe haben, sich zu beschweren.
Schon der Weg nach Europa ist für die meisten Geflüchteten mit unzähligen, tödlichen Gefahren und Wagnissen gepflastert. Gambier nennen den Weg über Zentralafrika und Libyen bis nach Italien und Deutschland gerne die „Backway-Route“.
Die Route führt durch Mali, Burkina Faso und Niger nach Libyen und von dort, wenn mensch viel Glück hat, nach Europa. Die Durchquerung und der Aufenthalt innerhalb dieser Länder als geflüchteter Mensch mit dunkler Hautfarbe sind eine Odyssee aus Misshandlungen, Korruption, Androhung von und durchgesetzte Gefangennahme und zahllosen weiteren Menschenrechtsverletzungen. Im schlimmsten Fall Folter, Vergewaltigung und Mord.

Foto: Chris Grodotzki / jib collective
»Die Menschen fliehen nicht, um sich zu bereichern. Sie fliehen, weil Armut und Elend ihre Existenz so sehr bedrohen, dass eine lebensgefährliche Flucht nach Europa für sie den einzigen Ausweg aus einer verzweifelten Situation darstellen.«
In Deutschland nennt man Geflüchtete aus Gambia oft „Wirtschaftsflüchtlinge“.
Die Bezeichnung suggeriert meiner Meinung nach, dass es den Geflüchteten um einen finanziellen Gewinn oder einen tollen Job geht, wenn sie ihre Heimatländer verlassen. In Gambia lebt die Hälfte der Bevölkerung in extremer Armut, viele Kinder sterben noch bevor sie das fünfte Lebensjahr erreichen. Ich habe für mich gelernt, dass der Begriff „Armuts-„ oder „Elendsgeflüchtete“ die Situation und die Gründe für Flucht aus Gambia deutlich besser beschreibt als „Wirtschaftsflüchtling“. Die Menschen fliehen nicht, um sich zu bereichern. Sie fliehen, weil Armut und Elend ihre Existenz so sehr bedrohen, dass eine lebensgefährliche Flucht nach Europa für sie den einzigen Ausweg aus einer verzweifelten Situation darstellen. [6] Ich glaube, auch Du würdest fliehen.

Foto: Nick Jaussi
Falls geflüchtete Menschen aus Gambia den ersten Teil ihrer Reise durch Zentralafrika, die Sahara, Libyen und die Fahrt auf dem Mittelmeer auf einem meist nicht wirklich seetauglichen Schlauchboot überleben (und sich die EU-Mitgliedsstaaten auf eine Verteilung der ankommenden Menschen geeinigt haben), erwartet sie eventuell der Aufenthalt in einer deutschen Landeserstaufnahmestelle, während über ihren Asylantrag verhandelt wird. Mitspracherecht über ihren neuen Wohnort haben die Geflüchteten dabei zumindest auf rechtlichem Wege nicht. Auch wenn ein geflüchteter Mensch in Paris Familie hat, die ihm eine Wohnung stellt und Stütze bei der Integration ist, spielt das keine Rolle, wenn in Bremen gerade ein Platz freigeworden ist und das BAMF meint, dass dort der richtige Platz für den Menschen sei. Aus Gründen.

Foto: Chris Grodotzki / jib collective
»Gerade beim Sicherheitsdienst habe ich den Missbrauch solcher Macht auch persönlich viel zu oft miterlebt und mitbekommen. Konsequenzen gab es quasi nie.«
In diesen sogenannten LEAs oder Ankerzentren gibt es nur zu bestimmten Zeiten am Tag Essen, eine finanzielle Versorgung unter dem, was in Deutschland als Existenzminimum gilt und kaum Privatsphäre, da sowohl Polizei als auch die zuständigen Sicherheitsdienste unangekündigt und verdachtsunabhängig Zimmer kontrollieren dürfen. Gerade beim Sicherheitsdienst habe ich den Missbrauch solcher Macht auch persönlich viel zu oft miterlebt und mitbekommen. Konsequenzen gab es quasi nie. [7] Aus Gründen.
Auch in einer Sammelunterkunft, in die Geflüchtete nach dem Ablauf einer Frist oder Beendigung des Asylverfahrens überwiesen werden, sind die Bedingungen nur begrenzt besser, denn auch hier gilt: Jeder Person stehen 7qm zu, oftmals in einem Container, in dem es im Sommer ruhig mal 40 Grad Celsius hat. Das Bad und die Küche werden mit den Zimmernachbarn geteilt und wer diese sind, entscheiden oftmals weder die Sozialarbeiter*innen vor Ort, die die (soziale) Situation kennen, noch die geflüchteten Menschen selbst. Das entscheidet das Amt. Aus Gründen.

Foto: Chris Grodotzki / jib collective
»Der durchschnittliche Prozess eines Asylverfahrens in Deutschland ist für Geflüchtete eine enorme bürokratische und emotionale Zumutung.«
Zu dieser Ausgangslage kommt noch hinzu, dass der durchschnittliche Prozess eines Asylverfahrens in Deutschland eine enorme bürokratische und emotionale Zumutung für Geflüchtete ist. Eine Zumutung in vier Akten.
Erstens: Die Basis für die Entscheidung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, welcher Aufenthaltsstatus einer geflüchteten Person zugewiesen wird, bildet ein Interview. In diesem Interview werden zunächst einige standardisierte Fragen wie beispielsweise nach dem Herkunftsland, der Adresse, Familie, Geburtstag der Person etc. gestellt. Anschließend wird der Person die Möglichkeit gegeben, sich frei zum Asylantrag und seinen Gründen zu äußern. Dieser Termin kann über die gesamte weitere Existenz der geflüchteten Person entscheiden. Angesichts dieser Tatsache ist es für mich erschreckend, dass es bei den Interviewterminen oftmals an professionellen Dolmetscher*innen und psychologisch geschulten Personal fehlt.

Foto: Chris Grodotzki / jib collective
»Unter solchen Umständen wird kein 19-jähriger Junge aus Gambia davon erzählen, dass sein Vater ihn seit seiner Kindheit immer wieder vergewaltigt, geschlagen, zur Kinderarbeit gezwungen und schlussendlich aus ›Kostengründen‹ aus dem Haus geworfen hat.«
Manchmal müssen Geflüchtete sogar nahezu den ganzen Tag vor ihrem Interview in einem Warteraum ohne anständige Verpflegung verbringen, nachdem sie bereits früh morgens stundenlang zur Stadt gereist sind, in der das Interview stattfindet. Dies ist oft nämlich nicht die Stadt, in der sie leben – und ein konkreterer Termin als „ab 8.30 Uhr“ wird auch nicht genannt.
Unter solchen Umständen wird kein 19-jähriger Junge aus Gambia davon erzählen, dass sein Vater ihn seit seiner Kindheit immer wieder vergewaltigt, geschlagen, zur Kinderarbeit gezwungen und schlussendlich aus „Kostengründen“ aus dem Haus geworfen und auf den „Backway“ geschickt hat. Wahr sind solche Geschichten leider dennoch.

Foto: Chris Grodotzki / jib collective
»Der gesamte Asylprozess rund um das Interview ist ein Sumpf aus Papierkram – für die Ämter und Geflüchteten gleichermaßen.«
Zweitens: Der gesamte Asylprozess rund um das Interview ist ein Sumpf aus Papierkram – für die Ämter und Geflüchteten gleichermaßen. Auf Bürokratie schimpfen ist zwar manchmal berechtigt, aber oftmals ist eine schriftliche Festmachung solcher Prozesse unabdingbar und hilft beiden Seiten. Um durch diesen Sumpf durchwaten zu können, braucht es aber entweder sehr gute, deutsche Sprachkenntnisse, die logischerweise nicht vorhanden sind, oder eine gute und ausreichende Betreuung durch Sozialarbeiter*innen für geflüchtete Menschen. In meiner hauptamtlichen Zeit in der Geflüchtetenhilfe in Freiburg schwankte der Betreuungsschlüssel „Geflüchtete Person zu Sozialarbeiter*in“ zwischen 85:1 und 130:1. Das schadet nicht nur den Geflüchteten, sondern auch den Sozialarbeiter*innen enorm.

Foto: Chris Grodotzki / jib collective
»Die Zeit des Wartens und Hoffens bedeutet für geflüchtete Menschen Dauerstress und eine große emotionale Belastung.«
Drittens: Asylprozesse in Deutschland dauern zwischen wenigen Monaten und vielen Jahren. Das ist ein Problem, weil diese Zeit des Wartens und Hoffens für geflüchtete Menschen Dauerstress und eine große emotionale Belastung bedeutet – und weil sie auf diese Dauer nur schwer aushaltbar ist, besonders wenn gleichzeitig von den Menschen zurecht erwartet wird, sich gesellschaftlich zu integrieren. Ein viel größeres Problem ist die lange Dauer aber im Falle eines negativen Asylbescheids. Die Abschiebung einer Familie in den Kosovo, die zwei Wochen in Deutschland war, ist meiner Meinung nach an sich schon extrem grenzwertig, weil mit ihr fast immer menschliche Härten verbunden sind. Aber die Abschiebung einer Familie in den Kosovo, deren Kinder seit drei Jahren in den deutschen Kindergarten gehen, die Sprachen sprechen und in Fußballvereinen spielen, in denen sich ihre Eltern ehrenamtlich nach ihrer Arbeit engagieren, ist nicht nur komplett unlogisch. Es ist unmoralisch und grausam.

Foto: Fabian Melber
Viertens: Viele Asylprozesse in Deutschland führen teilweise zu falschen Ergebnissen. Es ist allgemein bekannt, dass es inoffizielle Leitlinie des BAMF ist, möglichst wenigen geflüchteten Menschen einen Aufenthaltsstatus zu gewähren. Rund ein Fünftel der ausgegebenen Asylbescheide, gegen die Einspruch erhoben wird, ignorieren das deutsche und das Menschenrecht und halten einer Klage der Geflüchteten nicht stand. [8] Das ist ein trauriger Höhepunkt deutscher „Abschreckungspolitik“.
Man muss dem BAMF lassen, dass sich die Situation in vielen Punkten, wie beispielsweise den Ort der Interviews und der Dauer der Asylprozesse in den letzten Jahren, sehr langsam, aber stetig auf den Weg der Besserung befand.

Foto: Fabian Melber
»Die bekannten Stigmata des ›Flüchtlings‹ und der strukturelle und gesellschaftlich inhärente Rassismus in Deutschland machen eine erfolgreiche Integration um einiges schwerer.«
Auch abseits des rechtlichen Asylprozesses trifft Geflüchtete in Europa oftmals im aufnehmenden Land die harte Realität, dass es zwar durchaus berufliche und gesellschaftliche Perspektiven gibt, diese aber mit vielen unheimlich frustrierenden „Abers“ und „Wenns“ verbunden sind.
Die Schulbildung der meisten ankommenden Geflüchteten reicht vergleichsweise selten aus, um eine echte Perspektive zu ermöglichen, die mehr als einen Vollzeit-Aushilfsjob beinhaltet. Und selbst wenn, ist nicht garantiert, dass das zuständige Amt die entsprechenden Zeugnisse und die damit verbundene Leistung zertifiziert und anerkennt.

Foto: Felix Weiss
Meine persönliche Erfahrung ist, dass die meisten Arbeitsmöglichkeiten für Geflüchtete dort entstehen und gefördert werden, wo entweder akuter Arbeitskräftemangel herrscht, oder in Arbeitsbereichen, für die sich kaum deutsche Staatsbürger*innen bewerben wollen.
Bevor ein C1-Sprachkurs gefördert wird, wird eine einjährige Ausbildung gefördert. Ich halte dieses Vorgehen für sehr kurzsichtig und ehrlich gesagt habe ich ein bisschen Angst, welche Dynamiken dies langfristig gesellschaftlich auslöst.
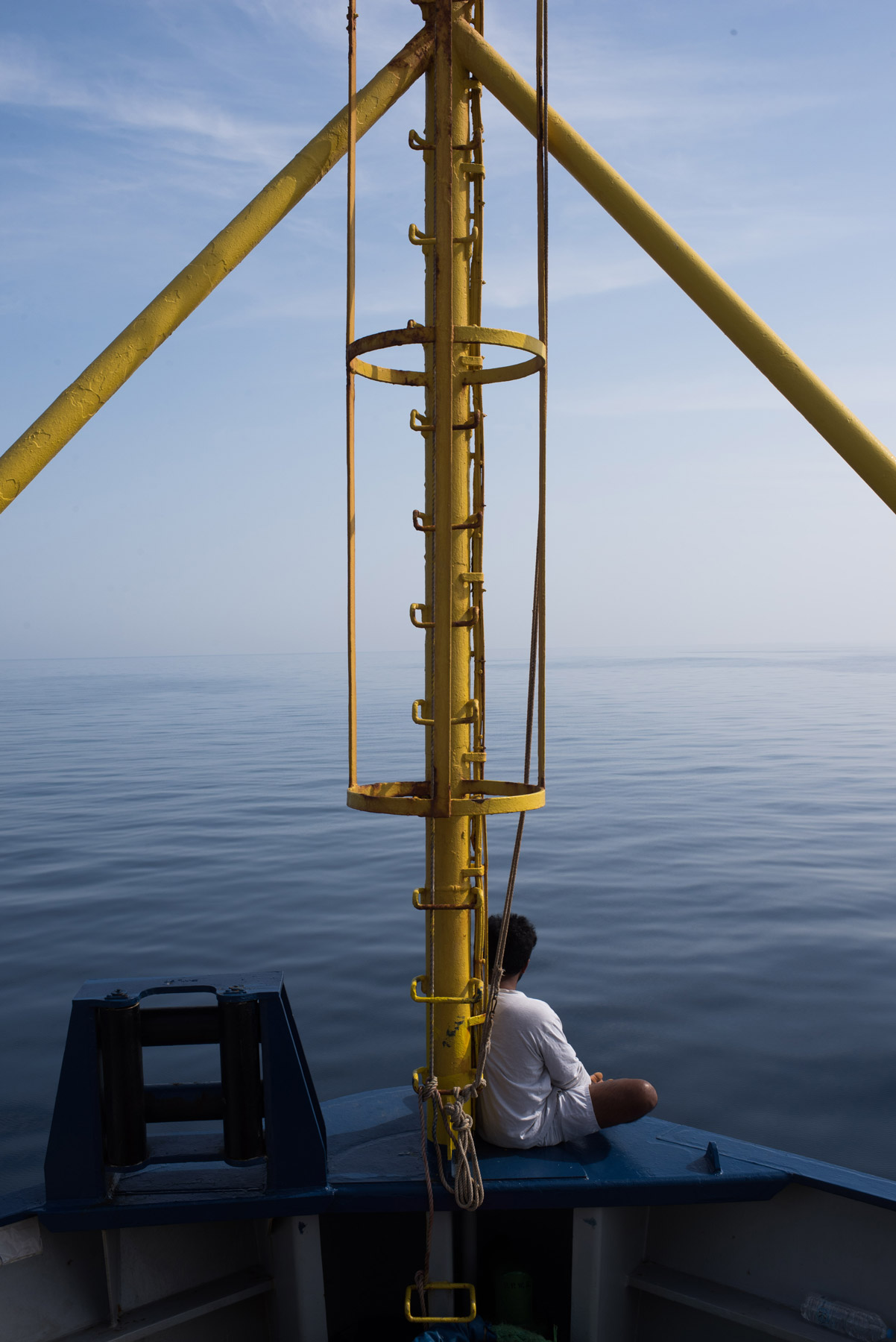
Foto: Chris Grodotzki / jib collective

Foto: Fabian Melber
»Ich bin mir sicher, dass der Anteil an Geflüchteten, die nicht den Stereotypen entsprechen, die immer wieder in Medien oder am Stammtisch repliziert werden, chronisch unterschätzt wird.«
Die bekannten Stigmata des „Flüchtlings“ und der strukturelle und gesellschaftlich inhärente Rassismus in Deutschland machen eine erfolgreiche soziale und wirtschaftliche Integration natürlich auch um einiges schwerer. Offensichtlich sind nicht alle Stereotypen und Stigmata per se ganz unbegründet. In Freiburg beispielsweise ist der Anteil an gambischen Drogendealern im Vergleich zum Durchschnitt sehr hoch – und für diese Erkenntnis braucht man wirklich kein*e ausgebildete*r Kriminolog*in sein. Der Punkt dabei ist aber, dass ein Stereotyp des „drogendealenden Gambiers“ in Freiburg entsteht, bei dem a) jegliche sozialen Faktoren außer Acht gelassen werden und sich nur auf die Nationalität/Hautfarbe konzentriert wird. und dass b) allen Gambiern und gambisch aussehenden Menschen in Freiburg dadurch geschadet wird. Insbesondere denen, die mit Drogenhandel überhaupt nichts zu tun haben. Ich persönlich bin mir sicher, dass der Anteil an Geflüchteten, die nicht den Stereotypen entsprechen, die immer wieder in Medien oder am Stammtisch repliziert werden, chronisch unterschätzt wird. Falls ich damit Recht habe, ist das tragisch. Und gefährlich.

Foto: Chris Grodotzki / jib collective
»Psychisch kranke und labile Menschen werden in Länder wie Afghanistan abgeschoben. Horst Seehofer konnte an seinem 69. Geburtstag darüber lachen.«
Die deutsche Regierung hat aufgrund von Stereotypen und der gesellschaftlichen Stimmung, die auf ihre Verbreitung folgt, einen Weg eingeschlagen, der dazu führt, dass viele komplett unschuldige geflüchtete Menschen kaum mehr eine Chance haben, ihre Familien aus Kriegsgebieten nach Deutschland nachzuholen. Ein Weg, der dazu führt, dass psychisch kranke und labile Menschen in Länder wie Afghanistan abgeschoben werden. Horst Seehofer konnte an seinem 69. Geburtstag darüber lachen. Jamal Nasser M. wird nie mehr lachen.

Foto: Chris Grodotzki / jib collective

Foto: Chris Grodotzki / jib collective
»Eine grundlegende Verbesserung der Lebensrealität von Geflüchteten fängt weder bei der Seenotrettung an noch hört sie dort auf.«
Die Geschichte von Dilemma und Dialog
Ich habe mir selbst einmal versprochen, dass ich als politischer Mensch keine einfachen, verkürzte Antworten auf komplizierte Fragestellungen geben will. Und die Frage, was sich an Migrationspolitik ändern muss, um jedem Menschen ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen, ist aktuell vielleicht die komplizierteste politische Frage, die man sich stellen kann.
Auf diese Frage gibt es nicht die eine kohärente, logische Antwort.

Foto: Erik Marquardt
Klar ist, dass eine grundlegende Verbesserung der Lebensrealität von Geflüchteten weder bei der Seenotrettung anfängt noch aufhört. Es muss es endlich vernünftige und angepasste Entwicklungshilfeprogramme ohne diplomatische Hintergedanken in den Herkunftsländern geben. Genauso müssen auch Menschenrechtsverletzungen innerhalb von Europa und die menschenunwürdigen Bedingungen in vielen Sammelunterkünften angegangen werden. Genauso muss jegliche Kooperation mit Fluchtverursachern gestoppt werden, auch wenn diese wirtschaftlich verlockende Waffendeals möglich machen. Die Liste könnte an dieser Stelle noch sehr viel länger weiter gehen.

Foto: Marcus Wiechmann
»Der gesellschaftliche Dialog ist an Unsachlichkeit und Hass erkrankt. Das wird im Netz besonders sichtbar.«
Ein Punkt, der unter all diesen Problemfeldern viel zu selten angesprochen wird, ist, wie sehr der gesellschaftliche Dialog an Unsachlichkeit und Hass erkrankt ist. Das wird im Netz besonders sichtbar.
Viel zu oft kann man dort, oftmals unwidersprochen, Thesen lesen wie:
„Wenn wir die Menschen im Mittelmeer retten, dann werden immer mehr Menschen versuchen, übers Mittelmeer zu fliehen.“ (Ganz abgesehen von der menschenverachtenden Logik dieses Arguments ist der sogenannte „Pull-Effekt“ eine populistische, unwissenschaftliche Erfindung. [9])
„Es kommen immer nur junge, afrikanische Männer hier nach Deutschland, die ihre Familien zuhause im Stich lassen.“ (Im Jahr 2019 wurden 43% aller Asylanträge von Frauen* und 45% von/für Kindern unter 16 Jahren gestellt. [10])
„Warum bringen sie die Geretteten nicht wieder zurück nach Nordafrika? Dort sind die wirklich nähergelegenen sicheren Häfen.“ (Die meisten Geflüchteten werden einige Seemeilen von Tripolis entfernt in internationalen Gewässern auf Rettungsschiffe aufgenommen. Die nächstgelegenen Häfen sind von dort aus fünf tunesische Häfen, die allesamt mitten in der Wüste liegen und weder über die rechtlichen Voraussetzungen noch über die Infrastruktur verfügen, um die Geretteten unter menschenwürdigen Umständen aufnehmen zu können. Danach kommen die Häfen in Lampedusa und Malta.)

Foto: Fabian Melber
»Niemand wird die ›Flüchtlingskrise‹ als Einzelperson lösen können. Zu widersprechen, wenn leise Rechtsradikale Gerüchte und Unwahrheiten über Menschen mit Fluchthintergrund und nicht-weißer Hautfarbe verbreiten, halte ich trotzdem für einen sehr guten Anfang.«
Auch an dieser Stelle könnte die Liste leider noch sehr lange weitergehen. Die Folgen dieses erkrankten Dialogs spüren übrigens nicht nur geflüchtete Menschen (weil offener, struktureller und auch leiser, verdeckter Rassismus immer salonfähiger in Deutschland wird), sondern auch all diejenigen, die sich für Sachlichkeit und Menschlichkeit diesbezüglich einsetzen. Zu diesen Menschen zähle ich auch Walter Lübcke.
Niemand wird die „Flüchtlingskrise“ als Einzelperson lösen können. Dazwischen zu gehen und zu widersprechen, wenn leise Rechtsradikale Gerüchte und Unwahrheiten über Menschen mit Fluchthintergrund und nicht-weißer Hautfarbe verbreiten, halte ich trotzdem für einen sehr guten Anfang. Und dabei kommt es auf jeden einzelnen Menschen an.

Foto: Marcus Wiechmann
»Es gab nicht viele Zeitpunkte in der jüngeren Geschichte, in denen es wichtiger war aufzustehen, politisch zu werden und sich zu wehren gegen jeden Versuch, menschenfeindliche Ideologien wieder gesellschaftsfähig zu machen.«
Die Moral von den Geschichten
Dieses ist das entscheidende Kapitel meines Textes. Ich habe in allen vorhergehenden Zeilen versucht, die aktuelle Situation aus Sicht einer einundzwanzigjährigen deutschen Kartoffel zu schildern, die vielleicht ein paar mehr ausländische Freunde mit Fluchthintergrund und Erfahrung im politischen Bereich hat als der Durchschnitt.
Doch warum das alles?
Zu Beginn dieses Textes habe ich geschrieben, dass ich glaube, dass es nicht viele Zeitpunkte in der jüngeren Geschichte gab, in denen es wichtiger war aufzustehen, politisch zu werden und sich zu wehren gegen jeden Versuch, menschenfeindliche Ideologien wieder gesellschaftsfähig zu machen.
In den letzten Jahren habe ich durch mein Engagement und meine persönliche Verbundenheit mit vielen geflüchteten Menschen einen Einblick bekommen, was passiert, wenn zu viele Menschen sich entschließen, Verstöße gegen die internationalen Menschenrechte zu ignorieren, zu rechtfertigen oder sogar zu unterstützen.

Foto: Marcus Wiechmann
»Die allermeisten deutschen Menschen haben das Glück, dass man in ihrem ganzen Leben wahrscheinlich niemals ihre Menschenrechte auch nur annähernd so grundlegend verletzen wird, wie das bei geflüchteten Menschen der Fall ist.«
Menschenrechtsverletzungen. Das ist ein Wort, dass man oft in den Nachrichten hört und das zu vielen Menschen zu locker über die Lippen geht.
Die allermeisten deutschen Menschen, inklusive mir, haben das Glück, dass man in ihrem ganzen Leben wahrscheinlich niemals ihre Menschenrechte auch nur annähernd so grundlegend verletzen wird, wie das bei geflüchteten Menschen der Fall ist.
Der Auslöser meines persönlichen und politischen Engagements in der Geflüchtetenhilfe war immer der direkte Kontakt.
Persönlich, weil ich durch mein Engagement mit die liebsten Menschen in meinem Leben kennengelernt habe und es mir einfach unglaublich viel Freude bereitet, Zeit mit ihnen zu verbringen.
Politisch, weil ich ihr Leid gesehen habe und sehe und nichts tun konnte, außer dumm daneben zu stehen und zu versuchen, ein bisschen Trost zu spenden.

Foto: Marcus Wiechmann
»Am Telefon erzählt ihm seine Frau, dass sie von einer Miliz gefangen genommen wurde und täglich gefoltert und vergewaltig wird.«
Was bedeuten Menschenrechtsverletzungen?
Menschenrechtsverletzungen bedeuten, dass ein guter Freund von mir aus Eritrea in einem deutschen Flüchtlingswohnheim von einer unbekannten Nummer angerufen wird. Am Telefon erzählt ihm seine Frau, dass sie von einer Miliz gefangen genommen wurde und täglich gefoltert und vergewaltig wird. Und dass alles nur aufhören wird, wenn ein Lösegeld gezahlt wird, das mein Freund nicht in kurzer Zeit zahlen kann.

Foto: Chris Grodotzki / jib collective
Menschenrechtsverletzungen bedeuten, dass ich diesen Freund verzweifelt weinen und innerlich zerbrechen sehe, weil er weiß, was das alles bedeutet, und sich selbst die Schuld daran gibt.
Menschenrechtsverletzungen bedeuten, dass man suizidale, an einer posttraumatischen Belastungsstörung leidende Menschen zwingt, sich mit einem unbekannten Menschen ein 14qm großes Zimmer zu teilen, weil ihr Einzelzimmerantrag vom Amt abgelehnt wurde.
Menschenrechtsverletzungen bedeuten, dass der Vater eines Arbeitskollegen in seiner Wohnung in Syrien an Bombensplittern stirbt, weil sich der Familiennachzug trotz bestmöglichen Aufenthaltsstatus über Monate und Jahre hinzieht.

Foto: Chris Grodotzki / jib collective
»In Libyen werden Männer wie Frauen aufs Brutalste eingesperrt, wie Sklaven an den Höchstbietenden verkauft, gefoltert und vergewaltigt.«
Menschenrechtsverletzungen bedeuten, dass ehrenamtlich Engagierten von verzweifelten Menschen Geld angeboten wird, dass sie nicht besitzen, um Familienmitglieder legal oder illegal ins sichere Deutschland zu bringen.
Menschenrechtsverletzungen bedeuten, dass ungeborene Kinder in Libyen oder auf dem Mittelmeer wegen mangelnder medizinischer Versorgung sterben, dass Männer wie Frauen in Libyen aufs Brutalste eingesperrt, wie Sklaven an den Höchstbietenden verkauft, gefoltert und vergewaltigt werden.
Ich habe all diese Geschichten und die Gesichter dazu viel zu oft persönlich erzählt und bewiesen bekommen. Oder sie miterlebt. Mir reicht es.
Ich will keine einzige Narbe mehr aus Afghanistan, keine einzige Träne aus Gambia, keine einzige Sorgenfalte aus Syrien mehr sehen, ohne diesen Menschen sagen zu können, dass sie jetzt in Sicherheit sind und sie keine Angst mehr haben müssen – und dabei ehrlich zu sein. Ich will nie wieder hören, dass Menschen im Mittelmeer ertrinken, weil die EU nicht helfen will.

Foto: Marcus Wiechmann
»In einer funktionierenden Demokratie sind alle Menschen Politker*innen – wenn sie es wollen.«
Ich glaube, ich bin aktuell zum ersten Mal in meinem Leben in der Position, in der ich zumindest einen minimalen Beitrag dazu leisten kann, dass der Tag kommt, an dem ich mir selber diesen Wunsch erfüllen kann. Und ich habe hiermit versucht, genau das zu tun.
In einer funktionierenden Demokratie sind meiner Meinung nach alle Menschen Politker*innen – wenn sie es wollen.
Das solche Dinge auf unserer Welt passieren, im Mittelmeer, in Libyen und in Deutschland, das ist die Schuld all jener, die sich für eine Politik aussprechen, die nicht jedem Menschen ein Grundrecht auf ein Leben in Sicherheit und Freiheit zugesteht. Es ist aber auch die Schuld all jener, die sich nicht gegen diese Menschen stellen. Und die schweigen im Angesicht solcher Grausamkeit.
Bitte hör auf zu schweigen, wenn Fremdenfeindlichkeit und Rassismus in Deutschland wieder auf dem Vormarsch sind. Es geht um alles.
Dein Simon
#simonsumbert #seawatch #carolarackete #refugees #eu #mypmagazine
Mehr von und über Simon Sumbert:
facebook.com/simonjungesfreiburg
instagram.com/simon.sumbert
twitter.com/simonsumbert
jungesfreiburg.de
Mehr von und über Sea-Watch e.V.:
sea-watch.org
instagram.com/seawatchcrew
facebook.com/seawatchprojekt
twitter.com/seawatchcrew
Quellenangabe zum Nachlesen:
[1] Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, Artikel 2, Absatz 2
[2] Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, Artikel 3
[3] https://www.zeit.de/2018/29/seenotrettung-fluechtlinge-privat-mittelmeer-pro-contra
[4] https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Broschueren/bundesamt-in-zahlen-2016.pdf?__blob=publicationFile,
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Broschueren/bundesamt-in-zahlen-2015.pdf?__blob=publicationFile
[5] Ein Beispiel: https://www.faz.net/aktuell/politik/kampf-gegen-den-terror/aus-syrien-fluechtlinge-mit-paessen-aus-is-faelscherwerkstatt-in-deutschland-13980052.html
[7] Mehr Infos hierzu: https://www.aktionbleiberecht.de/?page_id=7058
[8] http://www.bamf.de/SharedDocs/Meldungen/DE/2019/20190328-gerichtsstatistik-2018.html








