Jannis Niewöhner & Sabin Tambrea
Interview — Jannis Niewöhner & Sabin Tambrea
Hymne auf die Freundschaft
Hermann Hesses Roman »Narziß und Goldmund« gilt als Hymne auf das Leben, die Freundschaft und die Einzigartigkeit eines jeden Menschen. Die Erzählung, die zu den wichtigsten der deutschen Literatur zählt, wurde nun im großen Stil verfilmt. Wir haben die Hauptdarsteller Jannis Niewöhner und Sabin Tambrea zum Gespräch getroffen.
9. März 2020 — MYP N° 28 »Freundschaft« — Interview & Text: Jonas Meyer, Fotos: Steven Lüdtke

Als der S. Fischer Verlag im Juli 1930 den Roman „Narziß und Goldmund“ veröffentlichte, wurde es dem Autor Hermann Hesse etwas unheimlich. Zu positiv war das Echo, das seine sprachgewaltige Erzählung hervorrief, zu wohlwollend waren die Rezensionen. Unter den mehr als 20 Buchbesprechungen, die sich mit seinem neuesten Werk befassten, gab es nur eine wirklich kritische.
Noch mehr irritierte Hesse der Tonus vieler Zuschriften. Seinem guten Freund Otto Hartmann vertraute er damals an: „Meine Leser und namentlich Leserinnen schreiben mir täglich Briefe, wie schön der Goldmund sei und wie gut, dass ich vom Steppenwolf mich zu dieser ,Harmonie‘ hindurchgerungen habe. Es ist zum Speien. Für die Leute ist der Dichter da, um ihnen ,Harmonie‘ vorzutäuschen. Sobald er an den Tod, an die Tragik, an den Krieg, an alles Wirkliche erinnert, ist er ein lästiger Querulant.“
Aber kann man es den Leuten wirklich übelnehmen, dass sie sich in dieses Buch verlieben – in ein Buch, das nicht nur eine Hymne ist auf das Leben und die Freundschaft, sondern auch auf die Unterschiedlichkeit und Einmaligkeit eines jeden Menschen?
„Narziß und Goldmund“ erzählt die Geschichte zweier junger Männer, die sich um das Jahr 1500 in einer süddeutschen Klosterschule kennenlernen. Der eine, Novize Narziß, ist ein intellektueller und scharfsinniger Asket, sein wenige Jahre jüngerer Schüler Goldmund ein gutaussehender Lebemensch, der von seinem Vater ins Kloster abgeschoben wurde. Schnell entwickelt sich zwischen den ungleichen Figuren eine enge Freundschaft, die auch dann nicht zerbricht, als Narziß erkennt, dass Goldmunds Wesen nicht für das entbehrungsreiche und gottesfürchtige Leben als Mönch gemacht ist – und ihn dazu ermuntert, in die bunte weite Welt hinauszuziehen, um dort sein Glück zu finden.
„Narziß und Goldmund“ gilt heute als eines der wichtigsten Werke deutschen Literatur, seit 1930 hat sich der Roman millionenfach verkauft und wurde in über 30 Sprachen übersetzt. Die Entscheidung, ein solches Buch zu verfilmen, erfordert also eine gewisse Unerschrockenheit.
Regisseur Stefan Ruzowitzky hat diesen Schritt gewagt, mit viel Mut und einer hochkarätigen Besetzung. Herausgekommen ist ein kurzweiliger Streifen, der 115 Minuten lang in Hollywood-Optik glänzt und am 12. März in die deutschen Kinos kommt. An der Spitze des Ensembles stehen die beiden Hauptdarsteller Sabin Tambrea und Jannis Niewöhner, die ihren Figuren Narziß und Goldmund ein leinwandgerechtes Leben einhauchen konnten. Gedreht wurde der Film von August bis Oktober 2018 in Österreich, Tschechien und Südtirol. Ein gutes Jahr später haben wir die beiden in einem Kino am Potsdamer Platz zum Interview getroffen.


»Die Stärke der Geschichte ist, dass sie mit dem Leser mitwächst.«
Jonas:
Wann in Eurem Leben ist Euch die Geschichte von „Narziß und Goldmund“ zum ersten Mal begegnet? Und welchen Eindruck hat sie damals bei Euch hinterlassen?
Jannis:
Ich habe den Roman mit Anfang 20 zum ersten Mal gelesen. Eigentlich bin ich überhaupt keine Leseratte und habe große Schwierigkeiten, mich in Büchern zu verlieren – das ist eine Fähigkeit, die mir einfach nie gegeben war. Aber bei diesem Buch war es so, dass es vom ersten Moment an etwas mit mir gemacht hat. In „Narziß und Goldmund“ geht es um so elementare Fragen und Themen des Lebens, dass ich mich darin total wiedergefunden habe. Ich habe das Buch geradezu geliebt.
Sabin:
Das Besondere an dem Roman ist, dass er für jedes Lesealter seine eigene Gültigkeit hat. Das Buch ist in meiner Jugend irgendwie an mir vorbeigegangen, aber ich bin mir sicher, ich hätte es geliebt, da es viele Gedanken beinhaltet, die mich persönlich zu jener Zeit direkt betrafen. Als ich mich im Vorfeld des Drehs mit dem Roman auseinandergesetzt habe, bin ich aber auch auf ganz andere Facetten gestoßen – Facetten, die mir als Teenager noch verborgen geblieben wären. Ich meine damit etwa die vielen philosophischen Gedanken, die ich mit 15 Jahren noch nicht imstande gewesen wäre zu begreifen. Die Stärke dieser Geschichte ist, dass sie mit dem Leser mitwächst. Ich höre oft von Menschen, die alle paar Jahre diesen Roman in die Hand nehmen und sich über die vielen neuen Dinge erfreuen, die ihnen mit fortgeschrittener Lebenserfahrung auffallen.
Jannis:
Natürlich ist es auch so, dass man sich in unterschiedlichen Phasen des Lebens mit dem einen oder anderen Thema mehr oder weniger identifiziert. Das Buch erzählt zwei völlig unterschiedliche Charaktere, die ihre ganz eigenen Lebenswege verfolgen. Je nach persönlicher Lebenssituation findet man sich daher mal in der Figur des Narziß wieder und mal in der des Goldmund. Mir selbst ging es interessanterweise schon immer so, dass ich mich zu beiden Charakteren hingezogen gefühlt habe, weil ich mir für mich selbst auch beide Lebenswege vorstellen kann.

»Das Schönste an Narziß ist, dass er eine Offenheit und Neugier für das Unbekannte zeigt, ohne es zu verurteilen.«
Jonas:
Wo genau seht Ihr Schnittmengen zu Eurer eigenen Persönlichkeit? Was verbindet Sabin mit seiner Figur Narziß? Wo offenbart sich Jannis im Wesen des Goldmund?
Jannis:
Ich finde mich in grundsätzlichen Fragen des Lebens wieder, die Goldmund und mich gleichermaßen umtreiben: Was ist die eigene Kunst? Wie will man diese ausleben? Was will man mit seiner Kunst erzählen? Auf der einen Seite gibt es bei Goldmund und mir eine große Ungewissheit, mit der wir durchs Leben gehen, auf der anderen Seite versuchen wir, alles, was uns begegnet, sehr intensiv auszuleben. Wir wollen das Extreme und stürzen uns in alles hinein, was uns vor die Füße fällt. Dieses Irrationale, das Goldmund ausmacht, charakterisiert auch mich zu einem sehr starken Teil.
Sabin (unterbricht lächelnd):
Wer würde sich nicht gerne mit Goldmund identifizieren wollen, wenn er das Buch liest oder den Film sieht? Auch in mir steckt ein kleines bisschen Goldmund. Im Gegensatz zu Narziß ist er einfach der coole Lebemann, der so wenig Handbremse in sich hat, dass er alles ungefiltert erlebt.
Auf der anderen Seite bin ich aber auch zur Hälfte Narziß: Ich bin ein rationaler Mensch und wäge gerne ab. Für mich ist das Schönste an diesem Charakter, dass er – obwohl er Teil einer gestrigen Welt ist – eine Offenheit und Neugier für das Unbekannte zeigt, ohne es zu verurteilen. Mit dieser Haltung steht er übrigens auch im krassen Gegensatz zur Figur des konservativen Mönchs Lothar, der an alten Traditionen festhält und allem Neuen gegenüber misstrauisch bis feindlich eingestellt ist.
Was mich an dem Film ohnehin so beeindruckt, ist die Tatsache, dass er in der Lage ist, unsere gesamte Gesellschaft alleine über diese drei Figuren abzubilden: Goldmund steht für den Herzensmenschen, der sich aus seinem Bau wagt und die Welt entdeckt. Narziß ist der Intellektuelle, der durch seine Bücher eine große Offenheit entwickelt hat. Und Lothar ist der Unoffene, der im Gestern lebt. Damit hätte man übrigens auch die ganzen Populisten abgedeckt, die gerade mit bis zu 25 Prozent in den Parlamenten dieses Landes vertreten sind, was mir große Sorge bereitet.

»Ich würde nie behaupten, dass es bei Hesse weiße Stellen gibt.«
Jonas:
Durch die detaillierte und ausschmückende Sprache des Romans hat man als Leser das Gefühl, die beiden Hauptfiguren sehr gut kennenzulernen. Habt Ihr in der Buchvorlage dennoch weiße Stellen bei der Beschreibung der Charaktere identifiziert, bei denen Ihr das Gefühl hattet, diese erst durch Euer Spiel wirklich ausmalen zu können?
Sabin:
Ich würde nie behaupten, dass es bei Hesse weiße Stellen gibt. Dazu liefert er für die Fantasie viel zu viel Futter. Ich würde sogar sagen, dass die Romanvorlage fast schon zu flirrend ist, weil sie so unendlich viele Anknüpfungspunkte bietet. Unser Ziel war es, dafür eine adäquate Übersetzung zu finden. Auch wenn dies nie eins zu eins geschehen kann und sich nicht jeder einzelne Dialog in den Film übertragen lässt, mussten wir dennoch allen Gedanken des Romans gerecht werden und sie in eine filmische Sprache bringen.

»Für mich persönlich ist der Glaube an einen Gott etwas eher Irrationales.«
Jonas:
Dann lass mich anders fragen: Welche Wesenszüge Deiner Figur Narziß wolltest Du im Spiel unbedingt hervorheben? Was macht ihn für Dich so besonders?
Sabin:
Die Liebe zur Wissenschaft und zur Rationalität! Und die Tatsache, dass er dennoch keinen Zweifel an der Existenz eines Gottes hat. Für mich persönlich ist der Glaube an einen Gott etwas eher Irrationales. Daher habe ich mich im Vorfeld auch gefragt, wie ich die Wirkung der Religion auf Narziß in meinem Spiel zeigen kann. Meine Antwort war, dass dies nur über die Musik gelingen kann. Der Film gibt mir an zwei Stellen die kurze Chance, den Zuschauern zu zeigen, was die Religion für Narziß bedeutet, und zwar in den Momenten, in denen er die Choräle anstimmt. Diese Situationen ermöglichen den Zuschauern einen direkten emotionalen Anstoß. Daher war für mich ganz klar: Diese Momente mussten sitzen.

»Um meinen Goldmund darzustellen, habe ich in erster Linie aus mir selbst geschöpft.«
Jonas:
Im Spätmittelalter hatte Musik ohnehin einen ganz anderen Stellenwert. Während einem heute per Klick Milliarden von Songs zur Verfügung stehen, fand Musik damals nur in wenigen besonderen Momenten des Alltags statt. Wie habt Ihr euch in diese Zeit um 1500 hineingedacht? Hat für Euer Spiel das heutige Verständnis der Welt überhaupt eine Bedeutung gehabt?
Jannis:
In „Narziß und Goldmund“ finden etliche Themen statt, mit denen wir uns auch heute noch fast unverändert auseinandersetzen. Aus diesem Grund haben wir uns entschlossen, in unserem Film ein eher fiktives, romantisiertes Mittelalter zu beschreiben, was uns auch mehr Raum für die Erzählung der Charaktere gegeben hat. Für mich persönlich war die Zeit, in der die Geschichte spielt, mehr oder weniger egal. Um meinen Goldmund darzustellen, habe ich in erster Linie aus mir selbst geschöpft – aus all den Fragen, die ich habe, aus all dem Chaos, das sich so abspielt in meinem Leben, aus all dem auf der Suche sein. Goldmund trägt in sich eine große, undefinierbare Ungewissheit, gleichzeitig spürt er ein starkes Verlangen nach mütterlicher Liebe. Und auf der Suche danach entdeckt er die Kunst für sich. Das alles beschreibt für mich etwas zutiefst Menschliches und hat nicht wirklich etwas mit der Zeit zu tun, in der es stattfindet.

»Für junge Menschen ist es heute schwer, ihre eigene Identität zu entdecken – weil sie schon gefüttert werden, bevor sie Hunger haben.«
Jonas:
An einer Stelle des Films sagt Goldmund zu Narziß: „Durch dich habe ich suchen gelernt, aber suchen muss ich alleine.“ Muss man dieses Suchen auch heutzutage noch lernen – in einer Zeit, in der einem das gesamte Wissen der Welt zur Verfügung steht?
Sabin:
Ja, weil man heute mit dem Finden überschüttet wird. Egal, was man sucht oder nicht sucht, man erhält ständig tausende Antworten: tausende Spotify-Listen, tausende Google-Ergebnisse, tausende Posts, die einen überrollen. Daher ist es für junge Menschen heute auch so schwer, ihre eigene Identität zu entdecken – weil sie schon gefüttert werden, bevor sie Hunger haben. Und sobald es ein bisschen dunkel wird um sie herum, bekommen sie Angst: Angst davor herauszufinden, wer sie sind und wie sie empfinden.

»Im Film emanzipiert sich Goldmund schneller als im Roman.«
Jonas:
Ich persönlich hatte im Film den Eindruck, dass Sabins Narziß verletzlicher und nahbarer wirkt als die Figur im Roman, wohingegen sich Jannis‘ Goldmund emanzipierter und mutiger gibt. Welche Freiheiten haben Euch das Drehbuch und der Regisseur dabei gelassen, die Figuren jeweils so anzulegen, wie Ihr sie letztendlich gespielt habt?
Jannis:
Stefan Ruzowitzky hatte eine sehr klare Vision davon, was er mit dem Film erzählen will, und ich persönlich konnte mich dieser Vision sehr schnell anschließen, gerade in Bezug auf meinen Charakter Goldmund. Die einzige Frage, die ich mir stellen musste, war: Wie kann ich das, was mir das Buch vorgibt, auf meine Rolle im Film übertragen?
Vielleicht hast Du die beiden Figuren deshalb etwas verändert wahrgenommen, weil der Film die Geschichte wesentlich kürzer erzählt als das Buch. Beispielsweise verlässt Goldmund das Kloster im Film viel früher, als er es im Roman tut. Dort wird seine Zeit in der Klosterschule deutlich ausführlicher erzählt – inklusive der immer wiederkehrenden Zweifel, die ihn umtreiben, und inklusive der vielen Momente, in denen er mit sich hadert. Oder anders gesagt: Im Film emanzipiert sich Goldmund schneller als im Roman. Das ist auch nötig, um die Geschichte überhaupt in zwei Stunden erzählen zu können.
Sabin:
Was die von Dir im Film wahrgenommene Verletzlichkeit von Narziß angeht, muss ich sagen, dass ich diese im Buch schon immer gelesen habe. Es ist nur so, dass er diese Nahbarkeit nicht wirklich nach außen dringen lässt. Für mich als Schauspieler ist es aber viel spannender, den Zuschauern gegenüber durchlässig zu sein, statt eins zu eins die Figur des Buchs darzustellen – dadurch kann ich ihnen einladend eine Tür öffnen. Das ist im Buch gar nicht nötig, da die Figur sich über die Fantasie der Leser selbst in ihre Köpfe eingeladen hat.

»Wir haben über den gesamten Zeitraum versucht, Hermann Hesse gerecht zu werden.«
Jonas:
Habt ihr es jemals als Bürde empfunden, zwei Charaktere zu spielen, die eine so prominente Bedeutung in der deutschen Literatur haben?
Sabin:
Natürlich! Das kann man nicht von sich wegschieben. Als ich per SMS die Zusage für die Rolle bekommen habe, saß ich gerade in der Bahn. Im ersten Moment habe ich mich einfach nur gefreut und direkt meiner Frau geschrieben: „Ich bin Narziß!“ Aber schon im nächsten Moment schoss mir in den Kopf: Da gibt es jetzt unzählige Menschen in diesem Land, die alle sehr genaue, persönliche Vorstellungen davon haben, wie diese Figur zu sein hat und wie sie zu spielen ist. Genauso wie immer ganz viele Leute wissen, wie man Politik zu machen hat oder wie die deutsche Nationalmannschaft zu führen ist. Daher ist es eine enorme Herausforderung, so eine Rolle zu stemmen. Aber je ängstlicher man ist, desto unmutiger wird man. Und das ist da völlig fehl am Platz. Man muss mit voller Kreativität und Herzenskraft an so eine Aufgabe herangehen. Und entweder scheitert man dabei oder hat das Glück, ganz viele Menschen zu berühren.
Jannis:
Ein Scheitern kann es hier gar nicht geben – wenn überhaupt in Form einer harten Kritik. Aber davon muss man sich frei machen. Und man muss den Gedanken verstehen, dass die Verfilmung von so etwas Großem immer auch etwas extrem Subjektives hat. Wir als Team – und insbesondere Stefan Ruzowitzky – haben einfach aus unserer Wahrnehmung der Geschichte einen Film gemacht, immer darum wissend, dass so etwas nie wirklich perfekt gelingen kann. Dass liegt daran, dass jeder Mensch, der das Werk „Narziß und Goldmund“ kennt, damit ganz eigene Gedanken und Gefühle verbindet. Aus diesem Grund bleibt einem gar nichts anderes übrig, als so ein Projekt mit maximaler Hingabe anzugehen. Und ich glaube, das haben wir getan.
Sabin:
Und man kann guten Gewissens sagen, dass es in unserer Übersetzung von Roman zu Film keinen inhaltlichen Aspekt gibt, über den wir im Vorfeld nicht gesprochen hätten. Wir haben über den gesamten Zeitraum versucht, Hermann Hesse gerecht zu werden, insbesondere dann, wenn es Szenen im Buch gab, die es nicht in den Film geschafft hatten.

»In unserem Film werden die Zuschauer emotional ergriffen, und zwar ungefiltert.«
Jonas:
Romanverfilmungen müssen sich immer den Vergleich mit ihrer literarischen Basis gefallen lassen. Wenn man diesen Umstand mal über Bord wirft und „Narziß und Goldmund“ als ein grundsätzliches Anliegen versteht – als ein Thema, das es zu erzählen gilt: Was kann Euer Film zu diesem Anliegen beitragen, welche neue Perspektive kann er auf dieses Thema eröffnen?
Sabin:
Die direkte Herzensebene! In unserem Film werden die Zuschauer emotional ergriffen, und zwar ungefiltert. Sie können sich diesem Thema – komprimiert auf zwei Stunden – voll und ganz hingeben. Im Buch findet da eine ganz andere zeitliche Auseinandersetzung statt: über Tage, über Wochen oder sogar über Monate, je nach dem, wie lange man für die Lektüre braucht.
Jannis:
Das kann ich nur unterstreichen. Es ist das Medium an sich, das dem Thema oder Anliegen, wie Du sagst, einen bestimmten Mehrwert gibt. Davon abgesehen war es aber gar nicht unsere Aufgabe und auch nicht unser Ziel, da irgendetwas Neues zu finden. Vielmehr wollten wir der Geschichte an sich gerecht werden und ihren wesentlichen Kern erzählen.

»Auf einmal befindet man sich in so einer Art Fließbandarbeit.«
Jonas:
Goldmund wird als Kind von seinem Vater ins Kloster gebracht, weil er ihn loswerden möchte. Damit zwingt er ihm ein Leben auf, von dem der Junge selbst noch gar nicht weiß, ob er es später einmal leben möchte. Jannis, gab es in Deinem eigenen Leben je eine Situation, in der Du dich in eine Richtung genötigt gefühlt hast, in die Du eigentlich gar nicht gehen wolltest?
Jannis:
Das ist in meinem Fall ziemlich ambivalent, da ich sehr früh mit der Schauspielerei angefangen habe. Diese Entwicklung habe ich immer als großes Glück empfunden, aber es gab auch immer wieder Situationen, in der ich das absolut verflucht habe. Wenn man in so einen Beruf gerät und merkt, dass es halbwegs funktioniert, befindet man sich auf einmal in so einer Art Fließbandarbeit – auch wenn man das selbst gar nicht so empfindet. Plötzlich ist da ein Weg, der einem vorgegeben scheint. Daher kam bei mir auch immer wieder die Frage auf, ob dieser Beruf wirklich das ist, was ich will, weil ich nicht sicher war, ob die Schauspielerei nur etwas ist, das mir durch glückliche Fügungen begegnet ist – etwas, das mit einem Mal da war. Es wäre aber absolut falsch, das mit der Situation von Goldmund zu vergleichen, alleine weil ich immer große Freude an meinem Beruf hatte. Da war zum Beispiel die Schule viel eher etwas, in das ich unwillentlich hineingedrängt wurde (lacht).
Jonas:
Vielleicht hattest Du einfach Glück. Es gibt bestimmt viele Kinder, die insgeheim Schauspieler werden wollen, aber von ihren Eltern zu einer Ausbildung bei der Sparkasse gedrängt werden…
Jannis:
Und genauso gibt es bestimmt viele Eltern, die ihre Kinder vor eine Filmkamera drängen, obwohl diese vielleicht viel lieber bei der Sparkasse anfangen würden.

»Schauspielerei bedeutet nicht, dass man durch die Darstellung bestimmter Figuren ein bisschen aus seinem eigenen Leben erzählt.«
Jonas:
Im Roman sagt Narziß zu Goldmund Folgendes: „Indem ein Mensch mit den ihm von Natur gegebenen Gaben sich zu verwirklichen sucht, tut er das Höchste und einzig Sinnvolle, was er kann.“ Ist für Dich die Schauspielerei das einzig Sinnvolle, was Du tun kannst?
Jannis:
Ja, es fühlt sich auf eine bestimmte Art und Weise so an, zumindest in Kombination mit anderen Dingen: mit Musik, mit Freundschaft, mit der Fähigkeit, richtig zu lieben. Das, was einen antreibt und von Herzen kommt, ist ohnehin immer das Sinnvollste, was man im Leben tun kann. Für mich gibt es da aber nicht diese Eindeutigkeit, auf die Du hinauswillst. Klar, die Schauspielerei ist etwas, was ich persönlich als absolut sinnvoll und beglückend empfinde. Allerdings war mein Beruf für mich nie Teil eines Schwarzweißdenkens. Schauspielerei bedeutet nicht, dass man durch die Darstellung bestimmter Figuren ein bisschen aus seinem eigenen Leben erzählt. Ganz im Gegenteil: Das eigene Spiel ist im Wesentlichen geprägt von den Begegnungen mit anderen Menschen – oder auch von dem Druck, dem man immer wieder ausgesetzt ist.
Jonas:
Hattest Du je den Eindruck, aus Dir selbst eine Rolle herauszuschälen, so wie Goldmund im Laufe der Geschichte eine Skulptur aus einem Holzstamm herausschnitzt?
Jannis:
Ja, das könnte man tatsächlich so beschreiben. Allerdings habe ich im Vergleich zu Goldmund ganz am Anfang einer Rolle noch kein so konkretes Bild vor Augen. Oder anders gesagt: Ich schnitze fleißig, weiß aber oft noch nicht, was daraus einmal werden soll.

»Gewisse Verschiedenheiten zwischen den Menschen führen eher zu einer gewissen Wärme – und weniger zu einer Distanz.«
Jonas:
Die Geschichte von Narziß und Goldmund ist das Gegenteil des Sprichworts „Gleich und gleich gesellt sich gern“: Sie feiert nicht nur die Grundverschiedenheit der beiden Hauptfiguren, sondern beschreibt auch, wie sie sich durch ihre Diversität ergänzen und unterstützen. Konntet Ihr beide während des Drehs ebenfalls etwas voneinander lernen, was Euch bereichert und weitergebracht hat?
Jannis:
Total! So ähnlich, wie sich Goldmund von Narziß unterscheidet und in ihm eine gewisse Hilfestellung findet, so habe auch ich am Set immer wieder festgestellt, wie verschieden Sabin und ich sind – als Menschen wie als Schauspieler. Ich erinnere mich, wie ich immer wieder beobachtet habe, wie er auf ganz anderen Wegen zu etwas gefunden oder eine Szene gestaltet hat als ich. Daher war es für mich auch so spannend zu erleben, wie wir uns beim Dreh immer wieder ergänzt haben. Und was für einen großen Respekt wir uns bei all den Unterschiedlichkeiten entgegengebracht haben. Grundsätzlich glaube ich, dass gewisse Verschiedenheiten zwischen den Menschen eher zu einer gewissen Wärme führen – und weniger zu einer Distanz. Das kann aber nur gelingen, wenn jeder so ist, wie er ist, und niemand versucht, wie der andere zu sein.
Sabin (lächelt):
Über die Zeit mit Jannis Niewöhner könnte ich nur in der Form berichten, dass ich erröten würde. Daher möchte ich darüber in seiner Gegenwart eigentlich nicht sprechen. Aber Spaß beiseite: Für mich war diese Zusammenarbeit ein besonderes Erlebnis der Inspiration, die wir uns gegenseitig geschenkt haben.

»Ich habe das Gefühl, dass wir heute nicht mehr ganz so weit sind, wie wir eigentlich sein sollten.«
Jonas:
Das freundschaftliche Verhältnis zwischen Narziß und Goldmund ist auch von der Tatsache geprägt, dass Narziß schwul ist. Welchen Stellenwert haben all die gesellschaftspolitischen Errungenschaft unserer Zeit, wenn man das Thema Homosexualität in einem modernen Film des Jahres 2020 behandelt? Würdet Ihr sagen, dass Euer Werk an dieser Stelle wesentlich unbefangener und eindeutiger ist, als man das im Jahr 1930 sein konnte, als der Roman veröffentlicht wurde?
Sabin:
Ich glaube, dass wir uns bei den Dreharbeiten viel mehr Gedanken darum gemacht haben, wie, wann und in welcher Ausführlichkeit wir diesen Punkt darstellen können, als Hermann Hesse das wohl jemals beim Verfassen seines Romans getan hat. Bei ihm lässt er Narziß ganz direkt sagen: „Deine Träume sind von Mädchen, meine von Knaben.“ Wenn man bedenkt, dass Hesse bereits in der Hippie-Zeit als ein Symbol der freien Lebensart galt, so habe ich eher das Gefühl, dass wir heute nicht mehr ganz so weit sind, wie wir eigentlich sein sollten.

»Es ist absurd, wie sehr sich viele Menschen gegen andere, unbekannte Liebeskonzepte wehren, nur weil sie Angst davor haben.«
Jonas:
Apropos Liebe: Diese Geschichte befasst sich auf so vielen Ebenen mit einem Verständnis von Liebe, wie man es heutzutage gar nicht mehr gewohnt ist. Während unser moderner Liebesbegriff sich oft auf wenige Ausprägungen beschränkt, beschreibt Ihr auf Basis des Romans ein viel universelleres Verständnis des Gefühls Liebe. Ist diese feinsinnige und vielschichtige Ausprägung des Liebesbegriffs etwas, das wir als Gesellschaft erst wieder erlernen müssen?
Sabin:
Wir müssen vor allem lernen zu respektieren. Die Tatsache, dass unser heutiges Verständnis von Liebe so begrenzt ist, liegt doch darin begründet, dass wir in unserer Ignoranz andere Möglichkeiten gar nicht tolerieren. Dass wir heute beispielsweise noch Fußballer dazu ermutigen müssen, sich zu outen, ist eine Schande. Die Wahrnehmung ist ja bereits da, aber die Engstirnigkeit der Menschen muss weg. Und dafür bietet unser Film Vorlagen en masse. Egal, ob es um die Liebe zu Gott, um körperliche Liebe oder um geistige Liebe geht, das alles ist im Überfluss da. Man muss es nur erkennen.
Jannis:
Der Respekt entsteht dann, wenn die Angst davor verschwindet. Es ist absurd, wie sehr sich viele Menschen gegen andere, unbekannte Liebeskonzepte wehren, nur weil sie Angst davor haben. Es wundert mich sehr, dass das in unserer Zeit noch stattfindet.

»Wenn ich mich mit meinem besten Freund plötzlich nicht mehr verstehen sollte, würde ich mir eher Gedanken um mich selbst machen.«
Jonas:
Der Liebesbegriff in „Narziß und Goldmund“ schließt auch die Liebe zu einem engen Freund ein. Habt Ihr einen besten Freund oder eine beste Freundin, bei dem oder der Ihr die Gewissheit habt, dass er oder sie Euch für den Rest Eures Lebens begleiten wird?
Jannis:
Ja. Ich würde sogar sagen, da gibt es ein paar. Bei den meisten meiner Freunde ist es übrigens so, dass wir unterschiedlicher kaum sein könnten. Ich denke da etwa an einen meiner besten Freunde, mit dem ich zusammen aufgewachsen bin und bis zum Abi sehr viel zu tun hatte. Wir sind in unseren Leben komplett unterschiedliche Wege gegangen und sehen uns mittlerweile nur noch zwei-, dreimal im Jahr. Auch wenn sich um ihn mittlerweile andere Freundesgruppen gebildet haben, mit denen ich nicht wirklich etwas zu tun habe, habe ich nach wie vor das Gefühl, dass da noch ganz viel Substanz ist, wenn wir uns begegnen. Ich spüre dann, dass wir uns für alle Ewigkeit aufeinander verlassen können.
Sabin:
Mir geht es ähnlich. Auch wenn man sich eher selten sieht, gibt es einen gemeinsamen Ursprung. Wenn ich mich mit meinem besten Freund plötzlich nicht mehr verstehen sollte, würde ich mir eher Gedanken um mich selbst machen. Ich würde mich fragen, wie sehr ich mir treu geblieben bin oder nicht. Gott sei Dank bin ich immer noch in der glücklichen Situation, dass es in meinem Leben einige Menschen gibt, auf die ich mich voll und ganz verlassen kann – und die sich auf mich voll und ganz verlassen können.

»Das, was da entsteht, das bleibt.«
Jonas:
Ihr beide kanntet Euch vor den Dreharbeiten noch nicht wirklich. Seid ihr im Laufe der Monate Freunde geworden?
Jannis:
Ich würde sagen, ja. Es ist schon besonders, was einem so eine Zeit, so eine Phase gibt. Und das, was da entsteht, das bleibt.
Jonas:
Hesse hatte zwei Alternativtitel für sein Buch. Nummer eins: „Narziß oder Der Weg zur Mutter“. Nummer zwei: „Das Lob der Sünde“. Wenn Ihr eurem Film einen anderen Titel geben könntet, wie würde der lauten?
Beide lachen laut.
Jannis:
Ich glaube, da wäre alles viel zu platt, was mir gerade einfallen würde.
Sabin (grinst):
Ich würde sagen: „Goldmund und Narziß“.

ab 12. März im Kino
#narzissundgoldmund #jannisniewöhner #sabintambrea #freundschaft #mypmagazine #jonasmeyer #stevenluedtke
Mehr von und über Jannis Niewöhner:
instagram.com/jannisniewoehner_official/
die-agenten.de
www.film-pr.de
instagram.com/peterschulzefilm
Mehr von und über Sabin Tambrea:
instagram.com/sabintambrea
players.de
www.film-pr.de
instagram.com/peterschulzefilm
Interview & Text: Jonas Meyer
Fotos: Steven Luedtke
Hair & Makeup: Katharina Handel
Franz Grünewald
Editorial — Franz Grünewald
Lug ins Land
Fotograf Franz Grünewald, geboren 1993 im sächsischen Plauen, erkundete ab 2016 Orte seiner Kindheit, aber auch Orte, die ihm neu waren. Er begegnete alten Freunden, Fremden, Stille, immer wieder Politischem, dem Zwiespalt und Spuren des Alltags. Wir zeigen eine kleine Auswahl seiner umfassenden Fotoserie.
5. März 2020 — MYP N° 27 »Heimat« — Fotografie & Text: Franz Grünewald

Freital, Clausnitz, Heidenau, Bautzen, Chemnitz, Zwickau, Dresden – Orte, die unweigerlich Assoziationen hervorrufen: rassistische Übergriffe, Pegida, Hitlergruß, menschenfeindliche Sprechchöre, Bürgerwehr, NSU. Das Bundesland Sachsen hat ein Problem mit Rechtsextremismus. Studien wie der durch die Landesregierung in Auftrag gegebene »Sachsen-Monitor« zeigen: Trotz einer allgemeinen Zufriedenheit mit ihren Lebensumständen stimmen Sachsen rassistischen, demokratiefeindlichen und völkischen Thesen zu, deutlich mehr als im Rest der Republik.
Franz Grünewald (geboren 1993 in Plauen, Sachsen) erkundete ab 2016 Orte seiner Kindheit, aber auch Orte, die ihm neu waren. Er begegnete alten Freunden, Fremden, Stille, immer wieder Politischem, dem Zwiespalt und Spuren des Alltags. Eine einfache Erklärung auf die komplexe politische und gesellschaftliche Situation fand er nicht vor. Das Bundesland und seine Bevölkerung zeigen sich in ihrer Ambivalenz, zwischen Tristesse und Euphorie, zwischen Moderne und Abgeschiedenheit, zwischen Wut und Gleichgültigkeit.
























Link zur vollständigen Fotoserie
#franzgruenewald #luginsland #sachsen #heimat #mypmagazine
Fotografie: Franz Grünewald
Klaus Stockhausen
Portrait — Klaus Stockhausen
Am Geist der Zeit
Vom erzbischöflichen Gymnasium über den legendären Houseclub Front zum renommierten ZEITmagazin: Die Vita von Klaus Stockhausen ist facettenreich wie eine Discokugel. Heute gehört er zu den gefragtesten Stylisten der Welt – eine popkulturelle Heimatgeschichte.
27. Februar 2020 — MYP N° 27 »Heimat« — Text: Jonas Meyer, Fotografie: Maximilian König

Die Augen eines Menschen verraten vieles: Glück und Trauer, Erstaunen und Furcht, Lüge und Wahrheit. Doch eines verraten sie nicht: das Alter. Wer sich einzig und allein auf die Sehorgane eines Menschen konzentriert und alle anderen körperlichen Merkmale außer Acht lässt, wird nicht mehr sagen können, in welcher Lebensphase sich das Gegenüber gerade befindet. Das Wesen der Augen, so scheint es, ist zeitlos.
Bei Klaus Stockhausen, Fashion Director des ZEITmagazin, ist das nicht anders. Seine kleinen, grünblauen Augen stechen so neugierig und spitzbübisch hervor, dass man sie ohne Weiteres einem Heranwachsenden zuschreiben könnte, der gerade darüber nachdenkt, wie er am besten die Welt erobern könnte. Dabei ist er Jahrgang 1958.
Das renommierte Portal models.com bezeichnet Stockhausen als „einen der weltweit führenden Stylisten, der eine wichtige Rolle bei der Entwicklung von Modetrends und -ideen spielt.“ Gewiss, das alleine würde schon für eine gute Story reichen. Aber um die Geschichte hinter diesen juvenilen Augen zu verstehen, muss man einen Blick auf die gesamte Vita von Klaus Stockhausen werfen – eine Vita, die auch die gesellschaftliche Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland widerspiegelt. Nur eben etwas bunter und exzessiver. Und ein bisschen schwuler. Eine popkulturelle Heimatgeschichte sozusagen.

»In den 70er Jahren war ich noch viel zu jung, um die Welt aus politischer Perspektive zu betrachten.«
Aufgewachsen ist Stockhausen im behüteten Bonn, der damaligen Hauptstadt der noch jungen BRD. Seine Schulzeit, so erzählt er uns, habe er mehr oder weniger artig im Kardinal-Frings-Gymnasium am Rhein verbracht. Dass jemand wie er einst Schüler eines privaten katholischen Gymnasiums war, legt ihm noch heute ein breites Grinsen aufs Gesicht.
Von seinem Pult aus konnte Stockhausen auf den sogenannten Kanzlerbungalow am gegenüberliegenden Ufer blicken, das ehemalige Wohn- und Empfangsgebäude des deutschen Bundeskanzlers. „Ich weiß noch, wie ich durch das Fenster meines Klassenzimmers immer beobachtet habe, wie die Hubschrauber dort gelandet sind,“ erinnert er sich. „Das ist aber auch alles, was ich von der Bonner Republik mitbekommen habe. In den 70er Jahren war ich noch viel zu jung, um die Welt aus politischer Perspektive zu betrachten.“

»Ich hatte niemals negative ›Schwuchtel-Erfahrungen‹ oder Probleme – außer mit meinen Eltern.«
Dass er schwul ist, wusste er dagegen schon relativ früh. Es machte ihm auch nichts aus, dies offen zuzugeben. „Dafür habe ich mich noch nie geschämt!“, schießt es aus ihm heraus. Dabei wuchs er in einer Zeit auf, in der für Homosexuelle nicht nur in Westdeutschland das Leben alles andere als einfach war. Man denke nur daran, dass damals schwuler Sex noch unter Strafe stand – ein stigmatisierender und entwürdigender Spuk, dem erst 1994 mit der Abschaffung des Paragraf 175 ein Ende bereitet wurde. Doch im Vergleich zu anderen, so erzählt Stockhausen, habe er in dieser Hinsicht wirklich Glück gehabt. „Ich hatte niemals negative Schwuchtel-Erfahrungen oder Probleme – außer mit meinen Eltern.“
Spötter sagen, der Name Bonn sei ein Akronym für „Bundeshauptstadt ohne nennenswertes Nachtleben“. Vielleicht ist das der Grund, warum der junge Klaus mit 17 zuhause auszog und sich auf den Weg ins bunte Köln machte. „Eigentlich wollte ich studieren“, erzählt Stockhausen. „Dazu musste ich aber erst mal Geld verdienen.“ Und so klapperte er auf der Kölner Hohe Straße jede einzelne Jeansboutique ab, um sich als Aushilfe zu bewerben. „Niemand wollte mich anstellen, bis ich schließlich in einem schicken Versace-Laden stand“, erinnert er sich. „Irgendwie mochten die mich, nach einer Woche Probearbeiten wurde ich genommen.“

»Plötzlich stand ich da also mit meiner Popper-Frisur und habe die ganzen Lederjungs bespaßt.«
In dieser Boutique, so beschreibt es Stockhausen, seien „solvente Luden“ ein- und ausgegangen. „Die kauften dort ihre bunten Seidenhemdchen.“ Eines Tages erfuhr er von einem Zuhälter, der gleichzeitig auch eine Disko besaß, dass kurzfristig ein DJ ausgefallen war – und Schwups, stand Klaus Stockhausen an einem Mittwochabend am DJ-Pult und legte Musik auf. „Mit der Zeit wurde das mehr und mehr und hipper und hipper“, erinnert er sich. „Zuerst spielte ich nur dienstags und mittwochs, dann auch an den Wochenenden. Und plötzlich waren da auch lauter Kids.“
Es dauerte nicht lange und der Besitzer eines Kölner Industrial-Clubs namens Coconut wurde auf ihn aufmerksam. Dieser hatte die Idee, in seinem Laden jeden Sonntag einen sogenannten Gay Tea Dance zu veranstalten – nach amerikanischem Vorbild. „Plötzlich stand ich da also mit meiner Popper-Frisur und habe die ganzen Lederjungs bespaßt“, erzählt Stockhausen. „Wirklich begriffen habe ich das alles damals noch nicht, ich fand’s einfach nur spannend.“ Dann schweigt er für einen Moment und fügt hinzu: „Wahrscheinlich ist es mir auch nur gelungen, diese ganze Zeit zu überleben, weil ich da fast ausschließlich hinter den Plattentellern stand.“ Wie viele andere hat auch Klaus Stockhausen in den 1980er und 90er Jahren etliche Freunde und Bekannte an das Aids-Virus verloren – eine Tragödie, die für viele junge Menschen heute gar nicht mehr vorstellbar ist.

»Wahrscheinlich ist es mir nur gelungen, diese ganze Zeit zu überleben, weil ich da fast ausschließlich hinter den Plattentellern stand.«
Neben dem Coconut bespielte Klaus Stockhausen auch wenig später das Frankfurter No Name, wo er jeden Donnerstag und Freitag auftrat. Das Publikum bestand fast ausschließlich aus schwulen und lesbischen Mitgliedern der US-Armee, die unter anderem im benachbarten Rammstein stationiert waren. Der Besitzer des No Name war der damalige Partner und Liebhaber von Rainer Werner Fassbinder, dem berühmten Schauspieler, Regisseur und Drehbuchautor.
Doch mit den Engagements in Köln und Frankfurt war es noch nicht genug. Als Stockhausen eines schönen Tages mal wieder ins nahegelegene Amsterdam fuhr, um sich mit neuen Platten einzudecken, geriet er an einen weiteren Club. Dort gab es jeden Montagabend eine Veranstaltung – und da der Montag in seinem Kalender noch frei war, fing er auch in Amsterdam bald mit dem Auflegen an.
Für eine ganze Weile spielte sich nun sein Leben im Dreieck Köln-Frankfurt-Amsterdam ab. „Das war vor allem deshalb spannend, weil in jeder der drei Städte komplett andere Musik verlangt wurde“, erinnert er sich. „In Köln legte ich High Energy und Disco auf, in Frankfurt lief Phillysound und RnB, in Amsterdam spielte ich Britpop und Dance.“ Mit der Zeit reizte es ihn immer öfter, die einzelnen Stile zu vermischen und auszutesten, wie die Besucher der einzelnen Clubs auf die Musik der jeweils anderen reagierten.

»Als DJ war man zu damaligen Zeiten weder überbezahlt noch berühmt.«
Als im Frühjahr 1983 der Besitzer des No Name starb, eröffnete der Manager des Clubs einen neuen Laden in Frankfurt. Natürlich fragte er, ob Stockhausen dort am Eröffnungsabend auflegen könne. Dieser wollte sich aber erst die Erlaubnis von den Besitzern des Coconut einholen – die er nicht bekam, sie hatten etwas dagegen. „So eine Reaktion war zu damaligen Zeiten wirklich sonderbar“, sagt Stockhausen. „Man war ja weder überbezahlt noch berühmt.“
Also spielte er das Opening trotzdem – und wurde dabei von den Kölner Coconut-Leuten ertappt, die plötzlich in Frankfurt vor seinem DJ-Pult standen. „Es gab dann ein wenig Stress“, erinnert er sich. „Mein bester Freund Norbert schlug daher vor, dass wir mal ein paar Tage wegfahren, um die Lage zu entspannen. Die Frage war allerdings, wohin. München fand ich zum Kotzen und in anderen Städten war ich auch schon fivethousand times, also fiel die Wahl auf Hamburg.“

»Wir waren wohl etwas zu laut für die Hamburger Herrschaften.«
Kaum waren die beiden in der Hansestadt angekommen, ging es am Abend auch schon in eine Schwulenbar auf dem Kiez. „Das war ganz nett dort, aber wir beide waren wohl etwas zu laut für die Hamburger Herrschaften“, berichtet Stockhausen mit einem leichten Grinsen auf dem Gesicht. Man sagte den beiden Freunden, dass es wohl besser sei weiterzuziehen, und empfahl ihnen einen Club, der wenigen Wochen vorher erst eröffnet hatte und sich in den Kellerräumen des berühmten Kontorhauses „Leder-Schüler-Höfe“ am Heidenkampsweg befand. Der Name des neuen Hamburger Clubs: Front.
Die beiden Freunde machten sich auf den Weg. Als sie das Kontorhaus erreicht hatten und die Kellertreppe zum Front hinunterstiegen, kam ihnen der Besitzer entgegen – und warf sich vor den beiden prompt auf die Knie. „Ich verstand überhaupt nicht, was das sollte“, erzählt Stockhausen über seine erste Begegnung mit Front-Gründer Willi Prange. „Dann stellte sich aber heraus, dass der Typ fast jeden Sonntag nach Köln zum Tanzen fuhr, um mich als DJ im Coconut zu erleben und meine Tapes zu kaufen. Soll heißen: Er mochte meine Musik – und wollte, dass ich mal bei ihm im Front auflege.“ Dieses Angebot nahm der junge DJ an und zog wenige Wochen später von Köln nach Hamburg.
2012, kurz vor dem 30-jährigen Clubjubiläum, ließ DIE ZEIT in einem Artikel ehemalige Gäste, DJs und Mitarbeiter zu Wort kommen. Einer der Zeitzeugen erzählt: „Das Neue am Front war, dass es ein offener Club war – für eine Generation, die nicht mehr mit ihrem Coming-out kämpfte. Da amüsierten sich Heteros, Lederkerle und Wolfgang Joop in einem Raum miteinander.“
Davon abgesehen war das Front der allererste Club in Deutschland, in dem House-Platten aufgelegt wurden. So entwickelte sich der Laden innerhalb kürzester Zeit zu einer echten Institution: Bis zu seiner Schließung im Jahr 1996 bezeichneten ihn viele als den besten Club der Republik. Einen großen Anteil an diesem Erfolg hat auch Klaus Stockhausen, der von 1983 an neun Jahre lang als Resident-DJ die musikalische Sprache des Front prägen sollte.

»Irgendwie landete ich auf einem Stern-Cover – da war ich gerade mal acht Wochen in der Stadt.«
Der neue Wohnort eröffnete ihm aber nicht nur musikalisch neue Möglichkeiten. „Durch den Club und den Umstand, dass Hamburg schon immer eine Medienstadt war, landete ich zusammen mit einem Freund irgendwie auf einem Stern-Cover – da war ich gerade mal acht Wochen in der Stadt“, erzählt er und meint damit Ausgabe Nr. 5 vom 26. Januar 1984. Zu sehen ist der junge nackte Klaus Stockhausen, der im Arm eines anderen nackten Mannes liegt. Untertitelt ist das Ganze mit dem Satz „Jetzt sind die Schwulen wieder dran“, der auf einen Artikel zur sogenannten Kießling-Affäre verweist. Im Dezember 1983 wurde der Viersternegeneral Günter Kießling unfreiwillig in den Ruhestand versetzt, nachdem Gerüchte aufgekommen waren, er sei homosexuell. Zwar wurde er einige Wochen später rehabilitiert, wiedereingestellt und Ende März 1984 mit dem Großen Zapfenstreich ein zweites Mal in den Ruhestand verabschiedet. Aber seine Reputation war ruiniert. So war das eben im Deutschland der Achtziger.
Für Klaus Stockhausen dagegen öffneten sich in diesem Jahrzehnt immer neue Türen. Als 1983 in Hamburg die Band Boytronic gegründet wurde, eine elektronische Synthiepop-Gruppe nach dem Vorbild von a-ha und Alphaville, wurde er gefragt, ob er sich nicht vorstellen könne, dort mitzuwirken. „Wenn man 23 ist und so ein Angebot bekommt, findet man das einfach lustig und sagt zu“, erzählt er. Bald war er mit zwei anderen Jungs Anfang 20 nicht nur im Radio zu hören, sondern absolvierte auch seine ersten TV-Auftritte.

»Jetzt war ich im Fernsehen und in der Bravo zu sehen, das hat meinen Eltern imponiert.«
Bei YouTube findet man noch heute einige filmische Belegexemplare aus jener Zeit, unter anderem den Mitschnitt eines Boytronic-Auftritts in der Musiksendung Formel Eins aus dem Jahr 1984. „Waren wir da nicht alle im Sailor-Look unterwegs?“, erinnert sich Stockhausen grinsend und erklärt: „Was man da sieht, waren meine ersten Stylingexperimente – und die waren aus der Not geboren.“ Monate vorher, so erzählt Stockhausen, habe man die Band bei einem Videodreh in London in Mönchskutten gesteckt. „Da wusste ich, dass ich was unternehmen musste. Ich fand dieses sogenannte Styling so furchtbar, dass ich es für das nächste Plattencover und die folgenden Auftritte selbst in die Hand genommen habe – jedenfalls so, dass man wenigstens den Hauch von einem Konzept hatte.“
Bereut habe Stockhausen seinen Abstecher in die Welt der Boybands nie, erklärt er. „Ganz im Gegenteil: Diese zweijährige Boytronic-Episode hat mir dazu verholfen, dass meine Eltern plötzlich wieder cool mit mir waren – immerhin war ich jetzt im Fernsehen und in der Bravo zu sehen, das hat ihnen imponiert.“
Die Engagements im Front und bei Boytronic waren für Klaus Stockhausen aber nicht die einzigen Türen, die ihm seine neue Wahlheimat Hamburg öffnete. „Es passierte damals sehr, sehr viel in meinem Leben. Plötzlich war ich in Fotostudios unterwegs oder habe für Modenschauen Musik gemacht.“ Als 1987 bei einer Show in Düsseldorf der Assistent eines Stylisten plötzlich erkrankte und ausfiel, sprang Stockhausen kurzerhand ein. „Dadurch kam ich drei Wochen später an meinen ersten Job als Stylist – für die BILD der Frau“, erzählt er.

»Mit Mugler und Gaultier konnte Anfang der Achtziger noch keiner so richtig was anfangen.«
Mit der Welt der Mode war Stockhausen bereits Anfang der Achtziger in Berührung gekommen. „Mein bester Freund Norbert war Handelsvertreter und damals der Erste, der in Deutschland die Marken Mugler und Gaultier vermarktete“, berichtet Stockhausen. „Irgendwann hat er mich als Verstärkung mit zur Münchener Modemesse genommen, wo wir von den ganzen Boutique-Besitzern regelrecht ausgelacht wurden – Mugler und Gaultier hatten gerade ihre zweite Saison hinter sich, damit konnte noch keiner so richtig was anfangen.“ Aber das war Stockhausen egal, die beruflichen Ausflüge mit Norbert machten ihm Spaß. Und so begleitete er ab diesem Zeitpunkt seinen besten Freund zweimal im Jahr zu den deutschen Modemessen. „Dadurch habe ich mir schon früh ein kleines Netzwerk aufgebaut“, erklärt er und fügt hinzu: „Fashion war bei mir also schon immer irgendwie mit drin.“
Da das Front nur mittwochs bis sonntags geöffnet hatte, gab es in Stockhausens Wochenkalender noch ein paar freie Stellen. So kam es, dass er montags und dienstags als freiberuflicher Stylist arbeitete, etwa für die Zeitschriften Tempo und Tango oder für den berühmten Fotograf Kay Degenhard, der etliche Titel für den Stern fotografierte. „Damals wusste ganz Hamburg, dass montags der Stern anrief, um sieben Covermotive gleichzeitig in Auftrag zu geben“, erzählt Stockhausen. „Zu jenen Zeiten gab es für solche Fotoproduktionen auch noch Kohle ohne Ende, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.“
Bis Anfang der Neunziger verstand er seine beruflichen Ausflüge in die Mode eher als Nebenjob zu seinem musikalischen Engagement im Front. Doch als die Styling-Aufträge immer mehr wurden, musste sich Klaus Stockhausen irgendwann entscheiden. Er wählte die Mode, kehrte der Musik den Rücken und beendete 1992 seine neunjährige Residency im Front.

»Ich fand die Vorstellung schlimm, als DJ irgendwann zu einem Handlungsreisenden zu mutieren.«
Für diese Entscheidung, so sagt er heute, habe es im Wesentlichen zwei Gründe geben: „Zum einen fand ich die Vorstellung schlimm, als DJ irgendwann zu einem Handlungsreisenden zu mutieren. Wenn’s irgendwann nicht mehr so läuft, findet man sich in Trier oder Koblenz in irgendeiner Kaschemme wieder, wo keiner irgendwas begreift. Zum anderen hat mich die damalige Entwicklung der Musik gestört. Diese Waschmaschinen-Techno-Nummer, die Anfang der Neunziger überall in den Clubs zu hören war, war für mich wie ein Öffnen der Tore der guten Musik für die Vorstadt. Ich empfand das nie als wirklich schön oder richtungsweisend.“
Als 1994 die Macher der Zeitschrift Max mehrfach versuchten, Stockhausen zu ihrem Fashion Director zu machen, ließ er sich nach etlichen Monaten weichklopfen und nahm die erste Festanstellung seines Lebens an. „Anfangs fand ich das Magazin ziemlich doof, daher habe ich die Anfragen immer wieder abgelehnt und irgendwelche Jobs vorgeschoben“, erzählt er. „Aber irgendwann hat das als Ausrede nicht mehr funktioniert. Und dann habe ich gesagt: Ok, ich komme zu euch.“ Und er blieb – ganze zehn Jahre und sieben Monate lang.

»If you can do Naomi, you can do me.«
Mit diesem Engagement schlug Klaus Stockhausen nicht nur ein neues Kapitel auf, sondern auch ein äußerst glamouröses. Alleine in seiner Zeit bei Max kleidete er so ziemlich alles ein, was Rang und Namen hatte: von Musiker und Schauspieler Nick Cave über die deutsche Fußballnationalmannschaft bis zu den Supermodels Kate Moss, Claudia Schiffer, Linda Evangelista und Tyra Banks. Von 1995 bis 1997 arbeitete er zudem als persönlicher Stylist von Naomi Campbell, zwei Jahre später wurde Modeschöpfer John Galliano auf ihn aufmerksam. „If you can do Naomi, you can do me“, habe er zu ihm gesagt und ihn damit kurzerhand ebenfalls zu seinem persönlichen Stylisten erklärt, erinnert sich Stockhausen. „Freitags war ich bei ihm, montags war die erste Show.“ Auch diese Zusammenarbeit sollte über zehn Jahre Bestand haben.
Im Oktober 2004 wechselte Stockhausen als Fashion Director zu den Zeitschriften GQ und GQ Style. Als er dort Mitte 2007 eine Fotostrecke über Berliner Männer produzierte, lernte er Sven Marquardt kennen – und schätzen. Zu dem Ost-Berliner Fotografen und Türsteher des Berghain, jenem weltberühmten Technoclub, entwickelte sich über die Jahre nicht nur eine enge Freundschaft. Die beiden trafen sich auch immer wieder auf beruflicher Ebene und realisierten gemeinsame Projekte. „Ich habe Sven immer gerne gebucht“, lässt uns Stockhausen wissen und ergänzt: „Seine Portraits sind wirklich etwas Besonderes.“
Marquardt selbst sagt über Stockhausen: „In dieser Welt von Fashion und Lifestyle, in der immer jeder ausgetauscht wird in den nächst Jüngeren, ist Klaus inzwischen für seinen Beruf auch so etwas wie eine Legende und hat viele andere überdauert – durch Können, neugierig bleiben und Zeitgeist erfassen.“ Stockhausen fühlt sich von diesem Kompliment sehr geschmeichelt, relativiert aber etwas verlegen: „Ich glaube, ich bin vor allem deshalb immer noch da, weil ich mich selbst noch nie so wichtig genommen habe. Ich habe noch nie versucht, mich irgendwo in die erste Reihe zu schieben. In der ersten Reihe finde ich vielleicht mal kurzfristig statt, wenn ich gerade zwei tolle Cover hatte. Auf Dauer gehöre ich da aber nicht hin.“

»In der Mode funktioniert es nicht, wenn man nichts kann. Das ist wie im Handwerk.«
Dabei hat Stockhausen durchaus mit dem Gedanken gespielt, beruflich noch eine Schippe draufzulegen. „Es gab in meinem Leben mal eine Abfahrt, die ich hätte nehmen können“, erzählt er. „Das war zu der Zeit, als ich mit den Naomis und Gallianos dieser Welt gearbeitet habe. Da gab es tatsächlich einen Moment, in dem ich mit dem Gedanken gespielt habe, nochmal so ein Karriereprogramm zu starten. Aber was hätte das bedeutet? Ich hätte nach New York ziehen müssen, ich hätte vieles aufgeben müssen. Das wollte ich nicht.“
Stockhausen macht eine kurze Pause, dann fügt er hinzu: „In der Mode funktioniert es auch nicht, wenn man nichts kann. Das ist wie im Handwerk. Ich selbst bin nur ein einfacher Stylist, kein Designer und schon gar kein Modezar. Ich habe in meinem Leben unzählige Leute gesehen, die kurz modern waren und sich nach vorne geschoben haben, aber drei Jahre später hat man von ihnen nichts mehr gehört und gesehen.“

»Ich finde diese ganzen sogenannten Influencer overrated. Was genau können die? Was ist ihr Talent?«
Aus diesem Grund sieht Stockhausen auch Social-Media-Plattformen wie Instagram eher kritisch. „Das ist für mich alles eine Suppe“, gesteht er und erklärt: „Die Jungs sehen alle gleich aus, die Mädels sehen alle gleich aus, es geht einfach nicht weiter. Ich finde auch diese ganzen sogenannten Influencer overrated. Was genau können die? Was ist ihr Talent?“
Mit scheinbar perfekt aussehenden Menschen, wie man sie zu Abertausenden auf Instagram findet, kann Stockhausen auch bei seiner Arbeit als Stylist wenig anfangen. „Am schlimmsten sind diese Tchibo-Modelle, die genau wissen, wie gut sie aussehen“, befindet er und verrät uns: „Die haben maximal zwei Gesichtsausdrücke drauf, von denen sie wissen, dass sie damit nichts falsch machen können. Etwas anderes bieten sie nicht an – und sie lassen sich auch auf nichts anderes ein.“ So etwas finde er extrem langweilig, sagt der Stylist. „Und langweilig mag ich nicht – es sei denn, die Visage ist so geil, dass man sich sicher sein kann, dass das Portrait der Hammer wird.“


»Wir machen gerade viele Rollen rückwärts, sei es politisch oder gesellschaftlich.«
Viel spannender, so erklärt er uns, sei es doch, wenn an einem Menschen mal „was anders und unbekannt“ sei. Solche Typen seien aber immer schwieriger zu finden, vor allem innerhalb der jungen Generation. „Schau dir die Boys und Girls von heute doch an“, erklärt er. „Die Jungs sehen alle superschwul aus. Manche von ihnen haben so akkurat die Augenbrauen gezupft, dass man das Gefühl hat, sie wären abends als Marlene Dietrich unterwegs. Und die Mädels wirken alle wie Kardashian-Klons, die dir für 2,50 Euro alles machen. Wo, bitte, ist das denn schön?“
Ohnehin hat Stockhausen das Gefühl, dass viele junge Menschen heute wieder das einreißen, was die Alten über Jahrzehnte emanzipatorisch aufgebaut haben – etwa, indem sie durch ihre körperfixierte Selbstdarstellung auf Instagram in alte Rollenbilder zurückfallen, die man längst überwunden glaubte. „Auf mich wirkt es so, als würden wir gerade überhaupt viele Rollen rückwärts machen, sei es politisch oder gesellschaftlich“, sagt er und ergänzt: „Momentan erlebe ich die jungen Leute entweder als superkonservativ und hyperfokussiert, da kann es mit dem Bausparvertrag und der Eigentumswohnung gar nicht schnell genug gehen. Oder sie leben in einer Bubble zwischen Love Island, den Geissens und dem Sommerhaus der Stars – eine unechte Low-Level-Welt, in der scheinbar jeder alles kann. Und am Ende doch nichts richtig.“
Dann gesteht er, dass er ab und zu selbst ganz gerne vor dem sogenannten Unterschichtenfernsehen versackt: „Wenn ich nicht arbeite, hänge ich zuhause auch nur auf der Couch rum. Ich bin eigentlich total asozial.“

»Mein Bauchgefühl war immer auf Spaß aus. Daher hatte ich auch noch nie einen wirklichen Lebensplan.«
Der Gedanke an einen Bausparvertrag oder eine Eigentumswohnung hat für Stockhausen selbst nie eine Rolle gespielt, vor allem nicht in jungen Jahren. „Daran nicht zu denken, diesen Fehler habe ich leider gemacht“, sagt er voller Ironie und mit einem breiten Grinsen auf dem Gesicht. „Dieses Mein Auto, mein Haus, mein Boot-Feeling gibt es bei mir auch 30 Jahre später noch nicht. Ich habe so noch nie funktioniert, mein Bauchgefühl war immer auf Spaß aus. Daher hatte ich auch noch nie einen wirklichen Lebensplan. Irgendwie lief bei mir ja immer alles.“
Und wie es lief. Im Januar 2012 wechselte Stockhausen als Fashion Director von der GQ zum deutschen Ableger des berühmten Interview Magazin, das 1969 von Pop-Art-Künstler Andy Warhol und Journalist John Wilcock gegründet wurde. Bei Interview blieb er gut drei Jahre, bevor er schließlich im Mai 2015 Fashion Director des ehrwürdigen ZEITmagazin wurde.
Seit fast fünf Jahren nun prägt er das Heft mit seiner ganz eigenen Handschrift. Beim ZEITmagazin hat Stockhausen das Glück und Privileg, immer wieder genau die Persönlichkeiten einkleiden zu dürfen, die er selbst als das Gegenteil von langweilig empfindet. Im September 2019 beispielsweise übernahm er das Styling der 98-jährigen Iris Apfel, einer ehemalige Textilunternehmerin aus New York, die trotz oder gerade wegen ihres hohen Alters noch als Model arbeitet.

»Ich habe heute das Gefühl, dass die sogenannte Jugend die Alten gar nicht mehr verdrängt, sondern ihnen gerne auch mal zuhört.«
Auch wenn die Fashion-Industrie nach ewiger Jugend giert, haben für Klaus Stockhausen ältere Semester à la Iris Apfel einen berechtigten und wichtigen Platz in der Welt der Mode. „Ich habe heute das Gefühl,“ sagt er, „dass die sogenannte Jugend die Alten gar nicht mehr verdrängt, sondern ihnen gerne auch mal zuhört – weil sie merkt, dass die Generation vor ihnen vielleicht auch etwas zu sagen hat, was nicht immer sofort Quatsch ist.“
Aber vor allem hinter der Kamera, berichtet Stockhausen, stelle er immer wieder fest, dass den Jungen die Erfahrung der Älteren fehlt. „Wenn ich zu meinen Max-Zeiten mit jungen Leuten gearbeitet habe, hatten die genug Zeit, um sich auszuprobieren. Waren nach dem ersten Shooting-Tag die Fotos scheiße, hat man am nächsten Tag eben nochmal ein Set geschossen. Damals war auch für so etwas noch Geld da.“ Und er ergänzt: „Heute habe ich Jungfotografen, die zwar ganz toll sind, mit denen man aber zehn Fotos in acht Stunden machen muss. Oft sind sie schon nach dem dritten Foto mit den Nerven fertig und brauchen eine Stunde Ruhe, um sich zu sammeln. Und um darüber nachzudenken, ob das jetzt alles so wahnsinnig innovativ ist, was sie tun. Die sind einfach noch nicht soweit. Es geht heute alles zu schnell.“

»Es gibt zu viel Mode. Es gibt zu viele Shows. Es gibt zu viel Waste.«
Was er an der jungen Generation allerdings bewundere, sagt Stockhausen, sei ihr Mut zum Protest, was in gewisser Weise auch das Kaufverhalten der Menschen positiv beeinflusse: „Dieses Wachrütteln der Fridays for Future-Kids sorgt zumindest im Ansatz dafür, dass das Bewusstsein der Leute für das, was sie kaufen und tragen, ein wenig geschärft wird.“ Und er fügt hinzu: „Es gibt ohnehin zu viel Mode. Es gibt zu viele Shows. Es gibt zu viel Waste. Man weiß gar nicht, wohin man schauen soll. So langsam macht das alles keinen Sinn mehr. Letzte Woche zum Beispiel war ich zu einem Diner eingeladen, bei dem eine neue Kollaboration zweier Fashion-Labels gefeiert wurde. Im Ernst: noch eine?!“
Von Karl Lagerfeld stammt der Satz: „Mode ist der kürzeste Reflektor des Zeitgeists, und der ist ein verdammt launischer Geselle.“ Doch allein an der Aufgabe, so etwas wie Zeitgeist überhaupt zu erfassen, beißen sich seit jeher unzählige, oft selbsternannte Experten die Zähne aus. Unternehmen investieren Unsummen in Umfragen und Analysen, um zu verstehen, was die Gesellschaft gerade umtreibt, welchen Trends sie folgt und welches Werteverständnis dem Ganzen zugrunde liegt. Folgt man dem Urteil Sven Marquardts, dem Ostberliner Fotografen, der in seiner Person selbst ein bestimmtes Lebensgefühl unserer Zeit verdichtet, gehört Stockhausen zu den wenigen Menschen auf der Welt, die tatsächlich in der Lage sind, den Zeitgeist zu erfassen. Und dass ganz ohne Umfragen und Analysen, sondern allein mit seinem Gefühl, seinem Talent und einer enormen Neugier auf die Welt.

»Ich habe kein Problem damit, etwas immer wieder hemmungslos zu wiederholen.«
Dabei geht es Klaus Stockhausen bei seinen Stylings nicht darum, das Rad neu zu erfinden. „Bei mir ist es nie die Suche nach dem absolut Neuen oder dem nächsten großen Ding“, erklärt er. „Ich will eher das, was es gerade so gibt, mit dem verbinden, was es schon mal gab.“ In seinem Fundus, so erzählt er uns, befänden sich daher etliche Kleidungsstücke, die er schon seit langem mit sich herumschleppe und die sich über die Jahre in der Mode etabliert hätten. „Diese Sachen setze ich immer wieder ein, angefangen bei irgendwelchen Springerstiefeln oder Bomberjacken, die ja vor 30 Jahren noch nicht schön waren, bis zu irgendeinem Blumenkleid und Gummistiefeln.“ Sein Ziel sei es immer, so sagt er, mit etwas zu brechen und dabei etwas Neues einzubringen, von dem er denke, dass es richtig sei. „Im Grunde genommen ist das ein ständiges Samplen“, sagt er und fügt lächelnd hinzu: „Ich habe auch kein Problem damit, etwas immer wieder hemmungslos zu wiederholen.“
In unserer Alltagssprache wird der Begriff ästhetisch oft als Synonym für schön benutzt. Dabei steht er per Definition ganz allgemein für etwas, das unsere Sinne berührt: Schönes und Hässliches, Angenehmes und Unangenehmes. Für Stockhausen ist in seiner Arbeit vor allem das Berührende von Relevanz. „Wer wovon letztendlich berührt wird, ist eine hochindividuelle Angelegenheit“, erklärt er. „Ich für meinen Teil versuche immer, zusammen mit den Fotografen etwas zu entwickeln, was das Ganze emotional nochmal einen Schritt weiterträgt – etwa in Form einer verwirrten Ästhetik. Oder einer träumerischen, einer kaputten, einer martialischen oder was auch immer. Ziel ist doch, dass der Betrachter ein zweites Mal hinschaut, weil er einen Look vielleicht nicht sofort verstanden hat oder dieser ihn besonders ergreift. Das funktioniert zwar nicht immer, dennoch ist es bei jedem Job mein Anspruch.“


»Es würde mich nicht wundern, wenn plötzlich etwas völlig Neues in meinem Leben passieren würde.«
Die Menschen auf ganz unterschiedliche Art zu berühren, das gelang Klaus Stockhausen in seinem Leben schon immer, egal in welcher Rolle, egal an welchem Ort, egal in welcher künstlerischen Disziplin. Spricht man ihn auf seine Zukunftspläne an, könnte er sich sogar vorstellen, nach Musik und Mode nochmal ein ganz anderes Kapitel aufzuschlagen. „Allerdings müsste diese neue Tätigkeit zumindest ein klein wenig mit meinen Talenten zu tun haben“, wirft er ein, „und das sind nun mal visuelle und musikalische. Momentan wüsste ich nicht, was das sein könnte. Aber es würde mich auch nicht wundern, wenn plötzlich etwas völlig Neues in meinem Leben passieren würde. Wahrscheinlich müsste ich da nur irgendwie reinschlittern, wie sonst auch. Aber je älter man wird, desto schwieriger wird das.“
Während Stockhausen diese Worte spricht, macht sich ein leichtes Grinsen auf seinem Gesicht breit. Die grünblauen Augen stechen immer noch so neugierig und spitzbübisch hervor, als wäre ihr Wirt ein ungeduldiger Heranwachsender, der gerade darüber nachdenkt, wie er am besten die Welt erobern könnte. Als hätte er das nicht längst schon getan.

#klausstockhausen #zeitmagazin #maximiliankoenig #jonasmeyer #mypmagazine
Mehr von und über Klaus Stockhausen:
Text: Jonas Meyer
Fotografie: Maximilian König
maximilian-koenig.com
instagram.com/studio.maximilian.koenig
Mura Masa
Interview — Mura Masa
An Interconnective Thing
With »Raw Youth Collage,« Mura Masa has just released an album that reveals nothing less than big truths about living in our times. He manages to look at the world by looking at himself—equally indulging in nostalgia, describing the present, and facing the future. What’s more, he is supported by many striking British musical talents.
1. Februar 2020 — MYP N° 27 »Heimat« — Interview & Text: Jonas Meyer, Photography: Maximilian König

There are days in everyone’s life when you just don’t know what to think. Days on which the turmoil of your personal environment is tied so tightly with the complexity of this time that both can no longer be unraveled. You just stand helplessly in front of life and look at the world questioningly without really getting an answer. Such days leave a very strange feeling in everyone, and nobody really knows where to put it.
So, what can you do then? Music helps. Especially when it makes you feel like there is someone who understands you without asking. Someone who is able to pack your entire soul into melodies and lyrics and say things that you couldn’t have said better yourself.
From a journalistic point of view, the following statement is kind of daring, but Raw Youth Collage, the second album that has just been released by Mura Masa, a.k.a. British producer Alex Crossan, belongs to the kind of music that has the potential to really help—in particular on the days described above.
The special thing about Crossan’s new album is that R.Y.C. is primarily a look back—at a life that is extremely young at 23, but also extremely extraordinary, and extremely successful. The Guernsey-born musician and producer won a Grammy, was shortlisted for an Ivor Novello, appeared on Forbes‘ 30 Under 30, and sold more than half a million units of his debut album. If none of these accomplishments ring a bell, then at the very least you know who we’re talking about once you hear the remarkable song “Lovesick” feat. A$AP Rocky.
Alex Crossan is part of a generation that often claims to have no hope and orientation. It goes well with this that one of the first lines the young man sings on his new album is: “I don’t know who I’m supposed to be.” One of the eleven tracks on R.Y.C. is even called “No Hope Generation.” But how should such an album help, especially on days when you yourself no longer understand the world?
First, because it takes you on a musical roller coaster ride: from melancholy to nonchalance, from discouragement to confidence, from yesterday to tomorrow. Second, because Mura Masa is accompanied on R.Y.C. by a litany of young British music talents such as Clairo, slowthai, Tirzah, Georgia or Ellie Rowsell—striking artists that prove there’s a large dose of hope in the so-called no-hope generation.
On a cozy Sunday afternoon, we meet Alex for an interview and photoshoot in the almost deserted Berlin headquarters of Universal Music Germany.


»If you’re just doing the odd thing here and there, it’s hard to create something that lasts.«
Jonas:
With Raw Youth Collage, you present your second record. What does it mean to create an entire musical album in times when people collect single songs and put them into individual playlists?
Alex:
If you’re just making music for the sake of it, then it’s absolutely fine to do that with singles and stuff. But if you’re trying to write about a specific subject, I think it’s still important to make bodies of work—which is also, by the way, a nicer way to capture a little bit more of a wider kind of moment. If you’re just doing the odd thing here and there, it’s hard to create something that lasts.
Jonas:
Your album feels like there’s someone who is finally able to capture and summarize—in eleven tracks—how being a human in this world right now feels. It’s like reading a good book where you find a truth on every page that you can agree to. Has all the work on R.Y.C. left you more desperate or more hopeful in the end?
Alex:
Hmm. Personally, it left me feeling hopeful although I think some people might have a different reaction—I mean, there’s a song called “No Hope Generation” (smiles). That’s pretty cynical, maybe. But I hope that when people listen to it, they’re at least able to identify with the themes and get some emotional release. I think whenever you’re making art or music, it’s just a way of expressing yourself. And that can feel difficult at times and really good at other times. So, I think it isn’t really one of those two things you’ve said, it just is what it is.

»When we were location-scouting, we noticed that Serbia has that odd familiarity to England.«
Jonas:
Especially your song “Deal Wiv It” has the potential to stand for the reality of an entire generation, underlined by a sound that could be the beat of our challenging times. Did creating the video in Serbia add another significance and importance to the song?
Alex:
Yeah! The guy who directs most of my videos is a filmmaker called Yoni Lappin. We made a lot of them in London, but for this upcoming album, we wanted the videos to still have a kind of metropolitan or city feel. At the same time, we wanted the videos to play at places that seem more unfamiliar, just to better reflect the themes of the album. When we were location-scouting, we noticed that Serbia has that odd familiarity to England, but it’s a little bit different. That’s the reason why we really wanted to film there. And, for me, there’s also the sort of connotations of filming somewhere in Europe in times when its relation to Great Britain is kind of complicated. So, it definitely added some significance I would say.
»Yoni Lappin’s work is the perfect visual analogy of what my music is doing.«
Jonas:
As a filmmaker, Yoni Lappin has been with you for quite a while. How did you guys meet?
Alex:
A very long time ago, he made a video for a song of mine, called “U.” I think he was a friend of one of my managers. What Yoni was trying to do back then was to capture candid and truthful images of young people. Today, showing people very candidly and not too posed is a very common and ubiquitous thing in filmmaking. But at that time, no one was doing that and so he brought a very fresh feeling into the whole process.
Jonas:
What do you appreciate about his work? And what does his art add to your music?
Alex:
What I’m trying to do a lot with my music is to reflect my own experiences as a young person. And I feel that the images he creates really complement that. His work is the perfect visual analogy of what the music is doing.

»We’re starting to realize how complex society is, how complex people are, how complex opinions are.«
Jonas:
In the 1950s, people were totally fascinated by the future. They couldn’t wait for tomorrow, for new technologies to come, for flying to the moon. And today, we see that more and more people glorify the past and want to restore something that maybe never existed—the so-called good old times. What do you think: Why does there appear to be such a lack of confidence and joy for the future in our society?
Alex:
I think there’s this new fear of complexity now. We’re starting to realize a lot of impact due to the internet. We’re starting to realize how complex society is, how complex people are, how complex opinions are. And we’re still grappling and coming to grips with what it means to be overconnected in that way which is very closely linked to technology. I think the longer that cycle goes on, the more fearful people are. We’re already seeing some of the negative results of things like social media—and that doesn’t mean that it’s necessarily a bad thing—but we’re seeing that there’s an anxiety and kind of a worrying around it. That causes people to try and think about: When was the time that was simpler in my life? And the answer to that is: before all this happened, sometime in the past, like these good old days…

»We need to be able to learn from the past.«
Jonas:
Let’s make it “great again.”
Alex:
Exactly. It can be a very dangerous way of thinking. But what I’m trying to say on the album is just a recognition of what we’re doing as a society. What does that mean? How can we use that for good rather than, as you say, making something “great again” that wasn’t ever great? We need to not glorify ourselves, but rather we need to be able to learn from the past. We need to be able to tap into the good things about memory, nostalgia and things like that.
»I was trying to remember some of the things that made me who I am now.«
Jonas:
There’s a spoken track on your album, “A Meeting At A Known Oak Tree,” which is a very personal story told by a guy named Ned Green. He talks about climbing into his girlfriend’s window when he was a teenager and suddenly escaping when her dad was showing up. This part of R.Y.C. reminds me of the fact that each of us is carrying very special experiences and stories with us, but when we get older, we forget many of them. Did creating your album help you remember some personal stories that you already had forgotten?
Alex:
Yes, I think so. I was kind of digging into the past a lot and trying to remember some of the things that made me who I am now. But I was also realizing that, particularly with that track, there’s a kind of nostalgia, something that can be shared communally. The story that Ned tells on the album—climbing into his girlfriend’s window and stuff—that’s something that hasn’t happened to many people, I guess. But I’m sure we all can relate to the feelings around that experience and that makes it this communal, interconnective thing. And that’s an important part of our memory.
Jonas:
And Ned’s request for a banana at the very end of his story makes it unique!
Alex:
That was the perfect way of underlining his “fuck you” attitude when doing that.

»There’s a blurry line when you’re trying to figure out your place in the world.«
Jonas:
One of the very first lines you sing on your new record is “I don’t who I’m supposed to be.” I think that’s something a lot of people can identify with because they feel the same. I’m wondering if this is a phenomenon especially of our times, or if this search for oneself has always been an issue of every generation before us.
Alex:
The search to find out who you are isn’t necessarily a new thing, but now it’s extremely overcomplicated by how much we’re exposed to other people’s lives. It’s a lot harder to place yourself in this kind of virtual place that we’re living in. You know, what you see online isn’t necessarily reflecting what’s happening in real life. There’s a blurry line when you’re trying to figure out your place in the world and what it means to be alive. So, I think it’s a major problem that always existed, but now with a new challenge and difficulty around it.

»There’s a shift towards more vulnerability in pop music.«
Jonas:
Would you say that challenging times—like the ones we’re facing right now—are kind of a fertile soil for any kind of art, especially for music? Will we look back at the 2020s in a few decades, being thankful that these challenging times fostered creativity and put forth very influential artists and meaningful artworks?
Alex:
Yeah, I think we’re about to enter that very special decade. If you look back at the 1970s or 80s, it was the birth of punk music, it all happened around a lot of very difficult societal questions in very difficult times. In my opinion, such situations always give birth to good art.
Looking at today, we’ve been having a long time now that is shaped by pop music that is very shiny and centered around electronics—I’m talking “put your hands in the air like you just don’t care” and things like that. But I really think there’s a shift towards more vulnerability in pop music, you can see it in someone like Billy Eilish, a teenage girl who is writing very intensely about her experiences. The fact that something like that is so popular says to me that people are really determined to have honesty in music. That’s why I’m pretty sure that, in a decade or two, we’ll look back to where we are now, knowing that the years of the 2020s have been a very special time in music.

»Unfortunately, a lot of people are drifting apart from the here and now, including me.«
Jonas:
How do you look at your life right now? What is good, what is bad?
Alex:
I suppose I have a very strange life compared to my peers, being a musician (smiles). I’m starting to realize more and more what’s good about life is the people who are around you. Unfortunately, a lot of people are drifting apart from the here and now, including me. I don’t like to talk so much about social media, but due to the fact that it affects every part of our lives, I’m trying to sort of reconnect with what’s happening in the real world around me (pauses). And what’s bad about my life? Let me think about it…

»It’s a very anxious time to be alive.«
Jonas:
Working on Sundays?
Alex (laughs):
No, that’s lovely, I get to do this. But seriously: I think I’m more anxious than ever, it’s generally a very anxious time to be alive. Obviously, there’s a lot of massive problems in the world that we can’t face as individuals. Everyone’s trying to figure out solutions for only themselves, that’s quite stressful. But, again, I feel that is a shared experience that is at least something that we can be part of as a community.
Jonas:
Do you reflect from time to time if and how all the success, the attention, and the awards have an impact on you as a person?
Alex:
Yes, I think you have to do that from time to time…

»I just try to keep engrossed in the real world and in my work as much as possible.«
Jonas:
I’m sure that not everyone in your position does so.
Alex:
Perhaps, perhaps. I mean, I’m not a very emotionally open person, so I tend to not be trying to think about how all of that affects me. But I’m sure there’s inevitably a change in how one behaves when experiencing things like that. That’s why I just try to keep engrossed in the real world and in my work as much as possible.
Jonas:
Last question: Your new album doesn’t have a “Parental Advisory” sticker on the cover. Are you disappointed or relieved?
Alex:
It should have one! There’s a lot of swearing on it. A fuckin’ lot of swearing! But to be honest, I’m relieved. I really wouldn’t have liked it if they put a sticker on it—because I’m the one who designed the front cover. And that sticker wouldn’t fit.

#muramasa #ryc #rawyouthcollage #maximiliankoenig #jonasmeyer #mypmagazine
More about Mura Masa:
muramasa.me
instagram.com/the_mura_masa
facebook.com/muramasamusic
twitter.com/mura_masa_
Photography by Maximilian König:
maximilian-koenig.com
instagram.com/studio.maximilian.koenig
Production assistance by Frederike van der Straeten:
Interview & text by Jonas Meyer:
Editing by Benjamin Overton:
Rema
Interview — Rema
Der Auserwählte
Der nigerianische Sänger und Rapper Rema ist gerade einmal 19 Jahre alt, sorgt musikalisch aber schon für großes Aufsehen – nicht zuletzt dank der Hilfe von Michelle und Barack Obama, die seinen Song »Iron Man« zu ihren Lieblingen des Jahres 2019 gekürt haben.
16. Januar 2020 — MYP N° 27 »Heimat« — Interview & Text: Jonas Meyer, Fotos: Nis Alps

Im Hause Obama ist es jeden Sommer gute Sitte, dass Barack, 44. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, zusammen mit seiner Frau Michelle eine Liste mit Songs veröffentlicht, die sie als ihre ganz persönlichen Favoriten des jeweiligen Jahres bezeichnen. Entsprechend Baracks Rang in der US-amerikanischen Präsidentenfolge – man ahnt es bereits – zählt die sogenannte „Summer Playlist“ 44 Positionen.
Mit dieser Aufzählung gewährt das prominente Ehepaar nicht nur alle zwölf Monate einen intimen Blick in sein musikalisches Seelenleben, sondern stellt der Weltöffentlichkeit auch immer wieder Künstlerinnen und Künstler vor, von denen das Gros der Menschen bis dato noch nicht allzu viel gehört hatte. Ein präsidialer Geheimtipp mit größtmöglicher Reichweite sozusagen.
Als es im August 2019 für die Obamas wieder an der Zeit war, ihre Playlist zu verkünden, fand sich auf Platz 42 das Stück „Iron Man“. Interpret: ein gewisser Rema. Nie gehört?
Das sollte dringend nachgeholt werden, denn der 19-jährige Nigerianer, der mit bürgerlichem Namen Divine Ikubor heißt, verbindet auf spannende Art und Weise amerikanische Trap-Musik mit dem Afrobeat seiner Heimat. Sein Sound – und das ist das wirklich Besondere – kommt dabei gleichzeitig sorglos und melancholisch daher, ist ebenso lebendig wie nachdenklich, kann laut und im selben Moment sehr, sehr leise sein. Die Obamas hatten also keinen schlechten Riecher.
Aufgewachsen ist Rema in Benin City, an seiner musikalischen Karriere feilte er schon früh: Im Alter von elf Jahren spielte er in zwei Bands, mit 14 wurde er zum „Rap Nation Leader“ seiner Kirchengemeinde gekürt. Über Instagram wurde Anfang 2019 Afropop-Größe D’Prince auf Rema aufmerksam und nahm ihn unter seine musikalischen Fittiche. Wenige Monate später folgte dann die digitale Adelung durch die Obamas.
Ein echtes Glückskind? Das könnte man so sehen, wären da nicht die schweren Schicksalsschläge, denen sich dieser so talentierte Musiker bereits in jungen Jahren stellen musste. Als Rema acht war, verlor er seinen Vater, sieben Jahre später starb sein älterer Bruder. Ab diesem Moment musste sich Rema ganz alleine um seine Familie kümmern, da war er gerade 15.
Viel Licht und viel Schatten also für dieses noch so junge Leben – vielleicht die beste Voraussetzung, um daraus Musik zu machen. In Berlin haben wir Rema zum Interview getroffen.


»Ich würde nie einer Musik den Rücken zukehren, mit der ich aufgewachsen bin.«
Jonas:
Du bist mit dem Sound von Afrobeat aufgewachsen – ein Musikstil, der in Nigeria allgegenwärtig ist und zum Leben der Menschen gehört. Allerdings wolltest Du selbst nie diese Musik machen. Was ist der Grund dafür? Hattest du das Gefühl, dass es an der Zeit ist, in Deinem Land mit alten Mustern und Gewohnheiten zu brechen?
Rema:
Ich würde nie einer Musik den Rücken zukehren, mit der ich aufgewachsen bin! Ich glaube, dass jeder afrikanische Musiker den Vibe seiner Heimat so tief in sich trägt, dass er ihn gar nicht abschütteln könnte. Das ist meiner Meinung nach auch gar nicht das Ziel. Es geht vielmehr darum, diese Musik – diesen Musikstil – weiterzuentwickeln und dafür eine ganz individuelle Form zu finden. So jedenfalls verstehe ich meine eigene Rolle als junger nigerianischer Musiker und ich glaube, dass viele andere Vertreter meiner Generation eine ähnliche Rolle für sich gefunden haben. Dieses Mindset unterscheidet uns von all denen, die aus Prinzip immer beim Alten bleiben wollen.

»Eine gute Melodie ist attraktiv für alle Ohren, egal welche kulturellen Unterschiede es gibt.«
Jonas:
Deine Musik fühlt sich auf der einen Seite sehr lebendig und energetisch an, auf der anderen Seite schwingt in Deinen Liedern immer eine gewisse Melancholie mit. Das Video zu dem Song „Dumebi“ verdeutlicht das nochmal auf eine besondere Art und Weise: Zu sehen ist eine Gruppe nigerianischer Teenager, die in einem alten Bus unterwegs sind und eine gute Zeit miteinander haben. Begleitet wird diese sorgenfreie Ausgelassenheit von einem kraftvollen, aber dennoch leicht schwermütigen und introvertierten Sound. Braucht es für Dich beide Gefühlswelten, um Deine Musik authentisch erscheinen zu lassen?
Rema:
Ich habe es noch nie verstanden, wenn Musiker die gesamten drei Minuten eines Songs ausschließlich mit einer fröhlichen Melodie bespielen – oder mit einer traurigen. Warum muss ein Lied ausschließlich happy sein oder ausschließlich traurig? Meine Philosophie ist es, beide Emotionen in einem einzigen Song zusammenführen und miteinander zu vermischen. So gibt es in meinen Liedern Melodien, die dich gleichzeitig hoch- und runterziehen. Die meisten Musiker, die ich kenne, tun das mit Hilfe die Lyrics: lustige Melodie, trauriger Text, zum Beispiel. Oder umgekehrt. Aber was, wenn nicht jeder Mensch den Text versteht? Ich persönlich will das alleine über die Melodie schaffen. Eine gute Melodie erreicht gleichzeitig den Kopf und das Herz eines Menschen, eine gute Melodie ist attraktiv für alle Ohren, egal welche kulturellen Unterschiede es gibt. Das macht Musik wirklich mächtig. Als ich das verstanden habe, hat es fundamental den Prozess verändert, wie ich einen Song kreiere. Für mich ist es extrem interessant zu sehen, wie meine Musik Gefallen bei Menschen findet, die die Lyrics nicht verstehen.
»Ich kann mein Innerstes nicht von der Welt da draußen separieren.«
Jonas:
Trotzdem spielen auch in Deinen Songs die Lyrics keine unwichtige Rolle, man kann dort eine ähnliche Ambivalenz wie bei den Melodien heraushören: Auf der einen Seite sprichst Du in Deinen Texten über ganz persönliche Erfahrungen und Gefühle, auf der anderen Seite bringst Du wichtige gesellschaftliche Themen auf den Tisch – und verknüpfst sogar beides miteinander. Ist dies eine bewusste textliche Konstruktion oder einfach so passiert?
Rema:
Ich neige dazu, meine Musik mit allen möglichen Inhalten zu mixen. In meinem Song „Rewind“ beispielsweise spreche ich im ersten Teil über die vielen Probleme, mit denen Nigeria zu kämpfen hat, aber dann switche ich zu einer persönlichen Story über ein Mädchen, die ich unbedingt erzählen wollte. Beides gehört zu mir, beides beschäftigt mich, beides lässt mich leiden. Daher kann ich gar nicht anders, als meine Songs allein auf Basis meiner ganz individuellen Erlebnisse und meines persönlichen Verständnisses der Welt zu kreieren. So passiert es ganz automatisch, dass die Hörer am Ende des Songs das Gefühl haben, zwei Messages erhalten zu haben. Für mich selbst dagegen ist es immer nur ein einziges, mächtiges Gefühl, das ich zu erzählen habe, denn ich kann mein Innerstes nicht von der Welt da draußen separieren. Für mich ist Musik ohnehin immer dann am authentischsten, wenn es ihr gelingt, beide Gefühlswelten zu kombinieren – die innere und die äußere.

»Ich bin immer noch absolut überrascht davon, wie sich alles entwickelt hat.«
Jonas:
Du bist erst 19 Jahre alt, hast aber schon sehr viele außergewöhnliche Situationen in Deinem jungen Leben erlebt, negative wie positive. Einerseits hast Du bereits früh Deinen Vater und Deinen Bruder verloren, andererseits wurdest Du von einem bekannten Produzenten auf Instagram entdeckt und hast innerhalb kürzester Zeit eine beachtliche Karriere hingelegt – nicht zuletzt mit der indirekten Hilfe von Michelle und Barack Obama, die einen Deiner Songs auf ihre berühmte „Summer Playlist“ gepackt haben. Würdest Du dich als einen Menschen beschreiben, der eher Glück hatte im Leben? Oder überwiegt in Deiner Vita das Unglück?
Rema:
Ich bin wirklich gesegnet mit dem, was ich habe. Und ich bin immer noch absolut überrascht davon, wie sich alles entwickelt hat, vor allem in den letzten Monaten. Es ist noch nicht einmal ein Jahr her, dass ich meine ersten Songs veröffentlicht habe, und ich bin bereits jetzt so unendlich weit gekommen. Ich denke da an die vielen Bühnen, auf denen ich spiele, oder die Menge an Menschen, die ich mit meiner Musik erreiche. Das ist eine große Gnade, die mir zuteilwurde. Alles ist gut in meinem Leben.


»Für mich fühlt es sich so an, als sei ich ein Samen, den Gott auf fruchtbaren Boden gesetzt hat.«
Jonas:
Bist Du eine „What if“-Persönlichkeit? Denkst Du darüber nach, wie sich Dein Leben entwickelt hätte, wenn Du nicht auf Instagram entdeckt worden wärst? Wenn Dich die Obamas nicht auf ihre Playlist gepackt hätten? Wenn Vater und Bruder nicht so früh von Dir gegangen wären?
Rema:
Oh ja! Ich denke darüber sehr, sehr oft nach und gehe in Gedanken immer wieder die Ereigniskette von hinten nach vorne durch, Stück für Stück. Daher habe ich eben auch ganz bewusst gesagt, dass ich mich in meinem Leben gesegnet fühle. Ich glaube an Gott und bete viel. Für mich fühlt es sich so an, als sei ich ein Samen, den Gott auf fruchtbaren Boden gesetzt hat. Und jetzt sieht er dabei zu, wie sich aus dem Samen eine kleine Pflanze entwickelt, die immer größer wird.
Jonas:
Und was wäre gewesen, wenn es diesen fruchtbaren Boden nicht gegeben hätte?
Rema:
Mein Umfeld und die Umstände, in denen ich in Benin City aufgewachsen bin, haben mir nicht wirklich die Energie geben können, um all das zu tun, was ich in den letzten Monaten getan habe. Ich habe mich mehr und mehr ausgelaugt gefühlt und war kurz davor, depressiv zu werden. Aber dann passierten all die positiven Ereignisse – und Gottes Gnade zog mich aus dieser Situation heraus.

»Ich war plötzlich der einzige Mann in der Familie.«
Jonas:
Den eigenen Vater sowie den Bruder zu verlieren, gehört wohl zum Härtesten, was ein Mensch ertragen muss. Was hat Dir damals die Kraft gegeben, weiterzuleben und nicht aufzugeben?
Rema:
Ich war plötzlich der einzige Mann in der Familie und musste für meine Mutter und meine Schwestern da sein. Das hat mir auf sehr brachiale Art und Weise die Augen geöffnet und mir gezeigt, dass das Leben kein Spiel ist. Ich glaube, in dieser Zeit bin ich auch sehr spirituell geworden und meine Einstellung zum Leben hat sich völlig verändert. Damals habe ich mich gefragt, warum ich der einzige Mann in meiner Familie war, den der liebe Gott nicht zu sich geholt hat, und kam zu dem Schluss, dass er mir damit wohl eine besondere Aufgabe geben wollte. Ich habe mich entschieden, doppelt so hart zu arbeiten wie vorher, um dieser Aufgabe gerecht zu werden. Und hier sitze ich nun.

»Wer kennt schon diese Drei-Millionen-Stadt irgendwo in Nigeria?«
Jonas:
Interessanterweise hast Du in unserem Gespräch öfter das Wort Gnade benutzt, das auch in den Reden von Barack Obama immer wieder zu hören war. Wie hast du herausgefunden, dass der 44. Präsident der USA Deinen Song „Iron Man“ auf seine „Summer Playlist“ gepackt und Dich damit einer Weltöffentlichkeit vorgestellt hatte?
Rema:
Ich kam gerade von einer Reise aus Tansania zurück und mein damaliger Boss schickte mir den Link. Ich war total überrascht – und wurde gleichzeitig auch ziemlich still. Ich weiß noch, dass ich mich im ersten Moment gar nicht für mich selbst gefreut hatte, sondern für meine Stadt Benin City, der dadurch endlich mal eine gewisse Aufmerksamkeit zuteilwurde. Wer kennt schon diese Drei-Millionen-Stadt irgendwo in Nigeria?
Ganz davon abgesehen war ich zutiefst dankbar für die Wahl, die Michelle und Barack Obama getroffen hatten – auch weil „Iron Man“ ein eher sonderbarer Song ist, den man nicht so einfach versteht, wenn man aus einem völlig anderen Kulturkreis stammt. Das fand ich wirklich groß von den beiden und hat mich sehr bewegt. In den darauffolgenden Tagen schossen mir eine Menge Gedanken durch den Kopf und ich habe mich gefragt, was das wohl für mich und meine Leben bedeuten würde. Ich dachte: Wenn die Obamas meine Musik hören können, dann gibt es niemanden mehr auf der Welt, den ich nicht erreichen kann.
Jonas:
Das Pitchfork Magazine hat ein Interview mit Dir aus dem Juni 2019 mit folgenden Worten betitelt: „Rema Is Leading the Next Generation of Nigerian Pop.“ Verstehst du diesen Satz als Kompliment? Oder fühlt sich so eine Zuschreibung eher wie eine Bürde an?
Rema:
Das ist ein Kompliment, ganz klar! Gleichzeitig habe ich aber auch an jedem Tag, an dem ich aufstehe, das Gefühl, dass ich heute etwas erreichen muss – etwas Großes. Jeder in meinem Team nennt mich etwas scherzhaft „The chosen one“, dem versuche ich gerecht zu werden…

»Ich suche weder Ruhm noch Ehre, denn all das gebührt nur Gott.«
Jonas:
Das kann einem aber schnell zu Kopf steigen.
Rema (lacht):
Ich weiß, keine Sorge! Wie immer man mich auch nennt, ich lasse es nicht in meinem Kopf. Und wenn die Bezeichnung „The chosen one“ überhaupt irgendeine Gültigkeit hat, dann nur für die Art von Musik, die ich mache – und für die Reise, auf die ich mich dafür begebe. Ich suche weder Ruhm noch Ehre, denn all das gebührt ohnehin nur Gott. Ich bin ein junger Typ, der Musik macht, nichts weiter. Das Einzige, was ich will, ist meinen Sound irgendwie mit der Welt zu teilen und ihr ein bisschen mehr über das Land zu erzählen, aus dem ich komme.

»Ich sehe mich als Botschafter der jungen Generation in meinem Land.«
Jonas:
Siehst Du dich als eine Art Botschafter?
Rema:
Ja, aber weniger für Nigeria im Allgemeinen. Ich sehe mich eher als Botschafter der jungen Generation in meinem Land. Es wäre doch toll, wenn sich andere junge Menschen, die ihre Hoffnung verloren haben, ein wenig von meiner Geschichte und meiner Musik inspiriert fühlten und dadurch neuen Mut finden könnten. In meinem Song „Bad Commando“ übrigens beschreibe ich die Rolle, in der ich mich sehe, ganz genau: Ich bin ein einzelner Soldat in der großen Armee all derer, die in Nigeria für eine bessere Zukunft kämpfen. Nur dass ich in einer Disziplin antrete, in der ich am besten bin: der Musik.
#rema #obama #summerplaylist #nisalps #jonasmeyer #mypmagazine
Mehr von & über Rema:
Fotografie: Nis Alps
Interview & Text: Jonas Meyer
Lektorat: Kathrin Brandt
Gloria Blau
Interview — Gloria Blau
Wie man den Tod überlebt
Humor, Schmerz und eine Prise Vergnügungssucht: Sängerin Gloria Blau erzählt in modernen deutschen Chansons Geschichten von den kleinen Übeln der Liebe und von der unbegreiflichen Tragödie des Todes.
10. Januar 2020 — MYP N° 27 »Heimat« — Interview & Text: Katharina Weiß, Fotos: Ansgar Schwarz

„Deine Heimat“, so sagen Mütter und andere weise Menschen manchmal, „ist nicht auf einer Landkarte zu finden. Sondern in den Herzen derer, die dich lieben.“ Wenn wir diese Menschen verlieren, zieht es uns den Boden unter den Füßen weg. Und wir werden heimatlos im Herzen.
Die gebürtige Karlsruherin Gloria Blau musste sich in den letzten zwei Jahren mit genau diesem Verlust auseinandersetzen. Im Gespräch mit uns beschreibt sie, wie sie ihren Albtraum in schmerzlich-schöne Lieder gegossen hat, und präsentiert vor der Kamera ihre künstlerische Seite im charmanten Mix aus Galgenhumor, Koketterie und unverblümter Frechheit.


»Ich bin eine junge Frau, die leichtfüßig in die Welt hinausgehen und ihr Leben genießen möchte.«
Katharina Weiß:
Du hast einen tief berührenden Song mit dem Titel „Zwei Leben“ geschrieben. Wer das Lied zum ersten Mal hört, kann darin seiner verlorenen Beziehung nachspüren. Andere hören einen lang gefürchteten Abschied heraus. Aus welchem echten Verlust ist dieser Song entstanden?
Gloria Blau:
2018 ist mein Bruder an Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben, im selben Jahr hat sich mein Ex-Freund ganz unerwartet das Leben genommen. Dass sich einige der Lieder, die ich seitdem geschrieben habe, mit diesen unfassbaren Geschehnissen beschäftigen, liegt natürlich daran, dass ich noch im Verarbeitungsprozess stecke. „Zwei Leben“ floss mitten in der Nacht aus mir heraus. Er klingt nach der Zerrissenheit und der Ambivalenz der Trauer: Ich bin eine junge Frau, die leichtfüßig in die Welt hinausgehen und ihr Leben genießen möchte. Gleichzeitig wurde ich in dieses lähmende Vermissen hineingeworfen. Wenn ich aus diesem unermesslichen Schmerz noch etwas Wertvolles wie einen Song kreieren kann, dann hat er wenigstens in einer Hinsicht seine Daseinsberechtigung.
Katharina Weiß:
Versuchst Du, durch Deine eigenen Lieder auch die Deutungshoheit über das, was dir passiert ist, zurückzugewinnen?
Gloria Blau:
Total. Es geht um verstehen lernen. Und darum, was überhaupt abgeht. Viele denken, dass ich ein irre emotionaler Mensch bin. So sehe ich mich selbst aber nicht ausschließlich. Ich versuche, die Welt rational zu sehen und durch Einordnung zu verarbeiten. Und in einem dreiminütigen Song kann man vieles strukturiert zusammenfassen, das hilft mir sehr.

»Der Song schreibt mehr mich, als dass ich den Song schreibe.«
Katharina Weiß:
Wie kam es dazu, dass du Deine Liedtexte so autobiografisch gestaltest?
Gloria Blau:
Ich tue es nicht vorsätzlich. Ich überlege mir nicht, worüber ich schreiben möchte, sondern es passiert einfach. Wie Gefühle, die ich nur dadurch loslassen kann. Deshalb finde ich für mich vor allem Themen, die mich berühren, weil sie extrem traurig sind oder von intensivem Glück erzählen. Der Song schreibt mehr mich, als dass ich den Song schreibe.


»Ich würde nicht bis zum fünften oder sechsten Date warten, bis ich offen über meine Gefühle und meinen Schmerz rede.«
Katharina Weiß:
Gehst Du im persönlichen Gespräch auch so offen mit Deinen Narben um?
Gloria Blau:
Ja. Ich würde nicht bis zum fünften oder sechsten Date warten, bis ich mit meinem Rendezvous offen über meine Gefühle und meinen Schmerz rede. Wenn das schon zu doll ist, dann hätten wir ohnehin keine Chance. Tatsächlich sind mir in den letzten Monaten auch einige Freundschaften entglitten, weil sich Menschen in meinem Alter, die den Tod noch nicht erlebt haben, von diesem Thema abgrenzen wollten – allerdings nicht, weil ich ihnen ständig als Wrack entgegengetreten bin. Sondern weil es sich für sie so anfühlte, dass ihre negativen Erlebnisse – wie etwa Liebeskummer – im Vergleich zu meinen so profan seien. Und sie deshalb mit mir nicht mehr guten Gewissens darüber reden konnten.

»Ich werde noch ganz viel anderes sein als die Musikerin, die ihren Bruder verloren hat.«
Katharina Weiß:
Hast Du Angst, dass Deine Offenheit gegenüber der Presse zu einem Nachteil werden kann? Dass Dir dadurch ein Stempel aufgedrückt wird – die Sängerin, die ihren Bruder verloren hat?
Gloria Blau:
Ich habe diese Bedenken, denn meine letzten Veröffentlichungen hatten definitiv einen Trauerschwerpunkt, genauso wie die unmittelbar geplanten Werke. Aber es ist mir ein einfach ein riesiges Anliegen, meinen Beitrag zu leisten, um Schicksalsbewältigung und Depression mehr in die Öffentlichkeit zu bringen. Ich weiß, dass ich noch ganz viel anderes sein werde als die Musikerin, die ihren Bruder verloren hat.
Katharina Weiß:
Bringen verschiedene Arten von Kummer verschiedene Arten von Songs hervor? Gibt es Kummer, der produktiver ist?
Gloria Blau:
Bei Liebeskummer merke ich an der Art, wie ich das in einem Song verarbeite – ob als Randnotiz, flotten Spruch oder als ganzen Refrain –, wie ernst es mir mit dem Mann gewesen ist. In meinem Lied „Alleine sein“ stelle ich zum Beispiel fest, wie okay ich damit bin, plötzlich wieder Single zu sein. Und die erste Zeile lautet: „Ich hab‘ dir nie ein Lied geschrieben, zumindest keins für die großen Bühnen.“ Erst als ich das Lied fertiggestellt hatte, fiel mir auf, dass er mir wohl wirklich nicht so viel bedeutete, da ich wochenlang nicht das Bedürfnis verspürte, ihn in meiner Musik zu verarbeiten.


»Um Erfolg haben zu können, muss man sich zuerst persönlich gefunden haben, zumindest einigermaßen.«
Katharina Weiß:
Du hast vor über einem Jahr beschlossen, nicht mehr darauf zu warten, entdeckt zu werden – sondern die Aufnahme eines Albums und die Organisation einer Tour einfach selbst in die Hand zu nehmen. Warum denkst Du, dass das der richtige Schritt für Dich ist?
Gloria Blau:
Um Erfolg haben zu können, muss man sich zuerst persönlich gefunden haben, zumindest einigermaßen. Man muss erstens wissen, wo man hinwill. Und zweitens muss man realistisch einschätzen können, wie man das anstellen muss. Durch Therapie und sehr viele Gespräche mit anderen Künstlerinnen und Künstlern habe ich viel über mich gelernt. Zudem kenne ich mittlerweile das Musikbusiness und weiß, wo wichtige Stellen für mich sind.
Es wuchs so langsam alles zusammen, bis der Moment kam, in dem ich bereit war, ein paar tausend Euro in die Hand zu nehmen, um die ersten Videos und Songs aufzunehmen. Ich habe das Vertrauen in mich und meine Fähigkeiten gefunden und bin bereit, Schritt für Schritt das zu tun, was nun mal getan werden muss.
Katharina Weiß:
Welches Team steht hinter Gloria Blau?
Gloria Blau:
Ich schreibe alles selbst und spiele Piano und Saxofon. 2017 habe ich mein Musikstudium beendet. Daraus ging die Zusammenarbeit mit meinem ehemaligen Dozenten hervor, der jetzt mein Produzent ist. Er gehört zu einem Kernteam von vier Leuten, die mich auf und abseits der Bühne unterstützen.


»So tief ich in meine Trauer fallen kann, so hoch wirft mich meine Begeisterungsfähigkeit.«
Katharina Weiß:
Wie erlebt man dich in leichten Momenten?
Gloria Blau:
Über Helge Schneider lachend und irgendetwas Süßes essend, mit Spuren von Glitzer im Gesicht und Katze auf dem Schoß. Aller Melancholie zum Trotz bin ich wohl ein sehr optimistischer und weitgehend glücklicher Mensch. So tief ich in meine Trauer fallen kann, so hoch wirft mich meine Begeisterungsfähigkeit. Das war schon immer einer meiner stärksten Wesenszüge, der mir in den letzten Jahren erst richtig bewusst geworden ist.

#gloriablau #katharinaweiss #ansgarschwarz #mypmagazine #heimat
Mehr von und über Gloria Blau:
gloriablau.de
instagram.com/gloriablau
facebook.com/gloriablaumusik
Interview & Text: Katharina Weiß
Fotografie: Ansagr Schwarz
ansgarschwarz.de
facebook.com/AnsgarSchwarzFotografie
instagram.com/ansgarschwarz
Ludwig Trepte
Interview — Ludwig Trepte
Vom Reiz der Finsternis
In der Charlotte-Link-Verfilmung »Im Tal des Fuchses« spielt Ludwig Trepte einen labilen jungen Mann, der ein grausames Verbrechen begeht. Wir haben mit dem gebürtigen Ostberliner über Schuld, Heimat und Sehnsucht gesprochen.
2. Januar 2020 — MYP N° 27 »Heimat« — Interview & Text: Jonas Meyer, Fotos: Steven Lüdtke

Eine verträumte Hügellandschaft irgendwo in Wales, darin eingebettet ein kleiner, tiefblauer See, umrahmt von sattgrünen Wiesen und Wäldern. Unberührte Natur unter einem chronisch grauen, wolkenbehangenen Himmel. Die ersten Sekunden von „Im Tal des Fuchses“, der ARD-Verfilmung des gleichnamigen Kriminalromans von Bestseller-Autorin Charlotte Link, könnten auch einem Werbevideo der örtlichen Tourismusbehörde entsprungen sein.
Doch der Film, der im ersten Moment so pittoresk und unschuldig daherkommt, offenbart bereits nach wenigen Minuten ein grausames Verbrechen: Auf einem abgelegenen Parkplatz inmitten jener atemberaubenden Natur wird eine Frau gekidnappt und in eine Fuchshöhle verschleppt. Dort wird sie in eine Kiste gesperrt – und ihrem Schicksal überlassen.
Der Täter ist ein labiler junger Mann namens Ryan Lee, der kurz nach seiner Entführungstat wegen eines anderen Verbrechens verhaftet wird und für drei Jahre hinter Gitter kommt. Dass er eine Frau in einer Kiste gefangen hält, verschweigt er den Behörden – und fällt damit ihr Todesurteil. Die Frau gilt seitdem als verschollen. Doch als Ryan Lee drei Jahre später entlassen wird, erhält der ungelöste Fall eine unerwartete Dynamik – denn der Entführer trifft auf den verzweifelten Ehemann, der mit Hilfe einer befreundeten Journalistin eine erneute Suche nach seiner verschwundenen Frau startet.
Gespielt wird dieser Ryan Lee von Ludwig Trepte, jenem vielfach ausgezeichneten Schauspieler, der in den letzten zwei Dekaden in so vielen Produktionen mitgewirkt hat, dass sein Gesicht mittlerweile zum festen Inventar der deutschen Film- und Fernsehlandschaft gehört. Man denke nur an „Die neue Zeit“, „Tannbach“, „Unsere Mütter, unsere Väter“, „Deutschland 83“ oder „Bornholmer Straße“.
Kurz vor Weihnachten waren wir mit dem 31-Jährigen im Treptower Park im Osten Berlins unterwegs und haben mit ihm über Schuld, Heimat und Sehnsucht gesprochen.

»Es sind doch die persönlichen Erfahrungen eines jeden Einzelnen, die uns prägen und verändern.«
Jonas:
„Im Tal des Fuchses“ handelt von einem grausamen Verbrechen, das von Deiner Figur Ryan Lee begangen wird. Fällt es Dir schwer, nach so einer Rolle noch an das Gute im Menschen zu glauben?
Ludwig:
Nein, denn ich glaube, dass jeder einen guten Kern in sich trägt. Auch der Dalai Lama sagt, dass die Fähigkeit zur Empathie und zum Miteinander grundsätzlich in jedem angelegt ist. Es sind doch die Umstände, Schicksalsschläge und persönlichen Erfahrungen eines jeden Einzelnen, die uns prägen und verändern. Ich habe mal in einem Buch ein Zitat gelesen, das ich sehr schön finde: „Nicht das Denken verändert das Leben, sondern die Art zu leben verändert das Denken.“

»Ryan Lee ist ein junger Mann, der seinen Platz im Leben sucht.«
Jonas:
Als was für einen Charakter hast Du diesen Ryan Lee kennengelernt? Wie würdest Du seine Persönlichkeit beschreiben?
Ludwig:
Ryan Lee ist ein junger Mann, der seinen Platz im Leben sucht und sich vor allem nach einem besseren Leben sehnt, da er sich gesellschaftlich ausgegrenzt fühlt. Er trifft allerdings die falschen Entscheidungen und verstrickt sich aus Angst vor Konsequenzen immer tiefer in eine Situation, die ihn letztendlich vom Opfer zum Täter macht.
Jonas:
Das Besondere an der Figur Ryan Lee ist, dass sie so alltäglich wirkt – ein ganz normaler junger Mann, der einem nicht weiter auffallen würde, wenn man ihm auf der Straße begegnen würde. Schaust Du – nach all den Rollen, die Du in den vielen Jahren gespielt hast – mit anderen Augen auf die Menschen in Deiner Umgebung? Theoretisch könnte ja jeder ein dunkles Geheimnis in sich tragen…
Ludwig:
Ich glaube, jeder Mensch hat Gedanken, Sehnsüchte und/oder Phantasien, die er für sich behält. Geheimnisse haben alle – das macht sie ja auch so spannend und anziehend. Das Wort Geheimnis hat scheinbar Martin Luther ins Deutsche eingebracht, als Übersetzung von Mysterium.

»Auch ich habe Menschen mit Worten und Taten verletzt.«
Jonas:
Als Ryan Lee vor Gericht steht und bei seiner Verurteilung gefragt wird, ob er noch irgendetwas zu sagen habe, verschweigt er ganz bewusst die Entführung der Frau. Damit überlässt er das Opfer seinem Schicksal – dem sicheren Tod. Spätestens hier wird für die Zuschauer die Größe seiner Schuld fast unerträglich. Geht es Dir da ähnlich? Wie blickst Du selbst auf diese Schuld?
Ludwig:
Ich kenne das Gefühl von Schuld und somit auch Scham, da auch ich Menschen mit Worten und Taten verletzt habe. Ich weiß sehr genau, wie es sich anfühlt, wenn das Herz brennt, schreit und wie ein Wasserfall überläuft. Das ist unerträglich und daher ist die Frage immer, wie man mit Schuld umgeht.
Jonas:
Was hättest Du getan, wenn Du selbst in Ryan Lees Situation gewesen wärst? Hättest Du auch geschwiegen?
Ludwig:
Ich hätte erst gar keinen Menschen lebendig begraben.
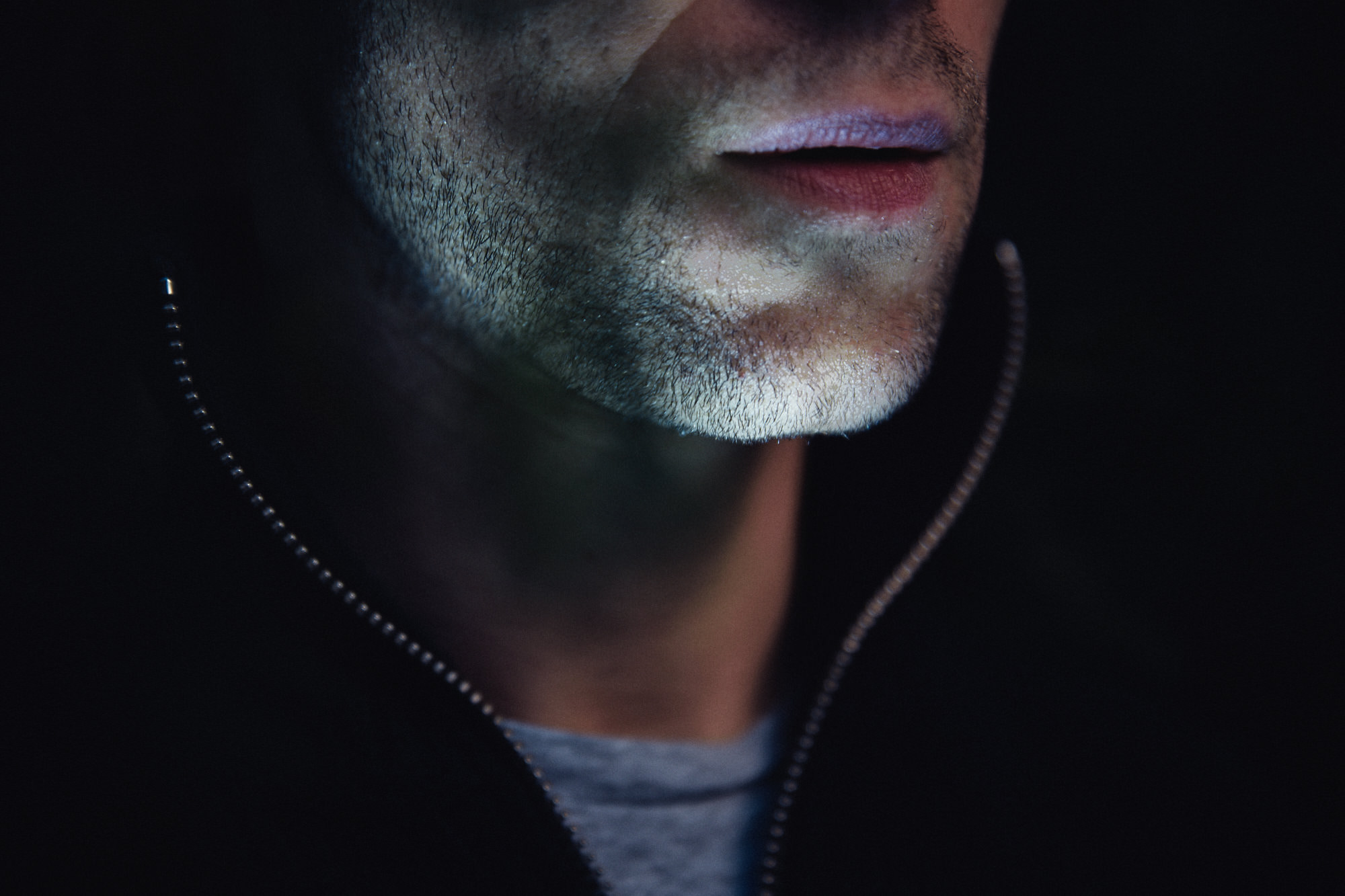
»Ich glaube, jeder Mensch hat die Fähigkeit, sich zu ändern.«
Jonas:
Als Ryan Lee nach drei Jahren aus dem Gefängnis entlassen wird, fängt er an, in einem kleinen Copyshop zu arbeiten. Der Besitzer weiß um Ryans Haftstrafe, sagt aber: „Ich finde, jeder Mensch verdient eine zweite Chance.“ Das ist im Übrigen auch die Idee unseres Rechtssystems. Aber hat so jemand wie Ryan Lee tatsächlich eine zweite Chance verdient?
Ludwig:
Ich glaube, jeder Mensch hat die Fähigkeit, sich zu ändern – und hat somit auch eine zweite Chance verdient.
Jonas:
Als ich „Im Tal des Fuchses“ gesehen habe, musste ich an zwei Filme denken, in denen Du als Jugendlicher mitgewirkt hast. Zum einen an „Keller – Teenage Wasteland“ aus dem Jahr 2005, weil es darin um ein ähnliches Verbrechen geht: die Entführung einer Frau. Zum anderen habe ich mich an „Ihr könnt euch niemals sicher sein“ aus dem Jahr 2005 erinnert gefühlt. Darin spielst du den 17-jährigen Oliver, der von seinem Umfeld als potenzieller Amokläufer wahrgenommen wird. Der Film endet mit einem Rap-Song, in dem Oliver immer wieder folgenden Satz spricht: „Ich bin ein Entscheider.“ Würdest Du Ryan Lee ebenfalls als einen Entscheider charakterisieren – als jemanden, der die Macht hat, mit seinem Handeln bewusst über das Glück und Unglück anderer Menschen zu richten?
Ludwig:
Ryan hat sich bewusst entschieden, einem Menschen lebendig zu begraben. Das ist ganz klar und steht außer Frage. Dass er allerdings vorzeitig wegen eines anderen Delikts inhaftiert wird, bevor er wie geplant die Frau wieder befreien kann, wollte er nicht. Jetzt zu wissen, dass sein Opfer sterben wird, wenn er diese Tat nicht zugibt, ist auch wieder eine Entscheidung – und das quält ihn. Die Angst vor einer zu langen Haftstrafe lähmt ihn und lässt ihn falsche Entscheidungen treffen, weil er glaubt, alles noch in die richtige Bahn lenken zu können.

»Wenn ein Charakter mit sich selbst ringt, wird es für mich spannend.«
Jonas:
Was hat dich schauspielerisch an dieser Rolle interessiert?
Ludwig:
Für mich muss eine Figur grundsätzlich ein gewisses Konfliktpotenzial in sich tragen und eine innere und/oder äußere Reise durchleben. Wenn ein Charakter mit sich selbst ringt, die Kontrolle über sich verliert oder Geheimnisse hat, die ihm auf der Seele lasten, wird es für mich spannend – und ich werde regelrecht gepackt. Das war auch bei Ryan Lee so.
Jonas:
Auch wenn sich in Eurem Film alles um das begangene Verbrechen dreht, gibt es immer wieder Szenen, die unterstreichen, dass das Leben weitergehen muss. An einer Stelle wird sogar eine Cover-Variante des Black-Songs „Wonderful Life“ eingespielt. Jetzt bist Du Vater zwei Kinder. Wie bereitest Du die beiden auf eine Welt vor, in der es neben dem Guten auch das Böse existiert und in der das Leben – bei all dem Übel – immer weitergehen muss?
Ludwig:
Die Frage nach richtig und falsch, nach Gut und Böse ist ja immer eine sehr subjektive. Dennoch gibt es natürlich ein moralisches Bewusstsein, ein moralisches Verständnis, das ich versuche, meinen Kindern zu vermitteln. Viel wichtiger ist mir aber, den beiden klarzumachen, dass Entscheidungen Konsequenzen haben – und dass man mit diesen Konsequenzen leben muss.

»Und plötzlich schrien all diese Leute: ›Macht die Mauer auf!‹«
Jonas:
Du hast in den letzten 20 Jahren in unzähligen Filmen mitgespielt, viele davon beschäftigen sich mit wichtigen Ereignissen der jüngeren deutschen Geschichte. Gibt es ein Thema, das Dir in besonderer Erinnerung geblieben ist?
Ludwig:
Stimmt, wenn man darüber nachdenkt, habe ich wirklich schon viel Geschichtliches zusammengerockt. Leider bleibt am Ende nur wenig kleben – auch weil sich nach meinem Empfinden der gesellschaftliche Blick auf diese Themen ständig verändert. Die Meinungen sind immer anders.
Was sich mir aber definitiv ins Gedächtnis gebrannt hat, ist unser Dreh zum Film „Bornholmer Straße“ aus dem Jahr 2014, in dem ich einen Grenzsoldaten spiele. Für den Film wurde auf einem Feld bei Magdeburg dieser berühmte Grenzübergang nachgebaut, an dem am Abend des 9. November 1989 die Mauer fiel. Da habe ich zum allerersten Mal nicht nur in einer Kulisse jener Zeit gestanden, sondern wirklich das Gefühl gehabt, dieses historische Ereignis wirklich mitzuerleben.
Das lag auch daran, dass meine Kollegen Charly Hübner, Milan Peschel und Max Hopp wie ich aus dem Osten stammen und dementsprechend am Set auch so quatschen konnten. Außerdem gab es 500 Komparsen, das heißt, man hat vor lauter Menschen nichts mehr links und rechts von sich gesehen. Und plötzlich schrien all diese Leute: „Macht die Mauer auf!“ Ich stand da am Schlagbaum, völlig gelähmt in diesen Requisiten, in denen man nichts mehr von der Gegenwart erkennen konnte, und bin fast umgekippt. Das war gigantisch und eine der spannendsten Erfahrungen, die ich je gemacht habe.

»Ich merke, dass die Tonalität in östlichen Regionen eine andere ist – und dass ich damit leichter umgehen kann.«
Jonas:
Haben diese und andere Rollen Deinen persönlichen Bezug zum Begriff Heimat in irgendeiner Form beeinflusst oder verändert?
Ludwig:
Heimat war für mich schon immer der Osten. Auch wenn ich ganz Deutschland sehr gerne mag, weil ich hier an so vielen Orten gedreht habe, hat speziell der Osten für mich eine besondere Bedeutung. Und das nicht nur, weil ich dort geboren wurde und aufgewachsen bin. Nach der Wende sind meine Eltern mit uns Kindern viel durch den Osten gereist, damit verbinde ich viele schöne Erlebnisse – und auch viel Nostalgisches. Das hat mich schon sehr früh in meinem Leben geprägt.
Jonas:
Der Fall der Mauer liegt mittlerweile 30 Jahre zurück. Stellst Du noch irgendwelche Unterschiede zwischen „Ostlern“ und „Westlern“ fest?
Ludwig:
Ich drehe mit so vielen kulturell unterschiedlich geprägten Menschen, dass ich eigentlich keinen Unterschied wahrnehme. Ich merke aber, dass die Tonalität in östlichen Regionen wie etwa Sachsen eine andere ist – und dass ich damit leichter umgehen kann als manch andere Menschen, die ich kenne. Ich wohne ja selbst im Osten und muss sagen, dass das für mich einfach eine vertraute Umgebung ist, in der ich mich gerne bewege. Ein Beispiel: Mein Schwiegervater, der in Freiburg aufgewachsen ist, stand mit mir mal in Pankow beim Fleischer vor der Theke und sagte: „Ich hätte gerne zu meinem Schnitzel Soße.“ Antwort des Fleischers (Ludwig erhebt seine Stimme und berlinert lautstark): „Dit ham‘ wa hier nich!“ Mein Schwiegervater war total überfahren, ich glaube, der geht nie wieder in diesen Laden. Ich selbst falle allerdings auch ganz gerne in diese Tonalität zurück, wenn ich möchte.

»In der DDR mangelte es oft an Material – und so entstand aus der Not das kreativste Zeug.«
Jonas:
Begegnen Dir in Deinem Alltag noch typische Ost-West-Klischees?
Jonas:
Mein Vater hat immer erzählt, dass der Zusammenhalt im Osten ein anderer gewesen sei als im Westen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da etwas dran ist. Außerdem komme ich aus einer Familie, wo alle wahnsinnig gut mauern können, die kloppen ganze Häuser hoch. Ich glaube, die Leute im Osten haben alle gewisse handwerklichen Fähigkeiten und sind sehr erfinderisch, wenn es darum geht, Dinge zu reparieren. In der DDR mangelte es oft an Material – und so entstand aus der Not das kreativste Zeug. Daher kenne ich auch Sprüche wie „Der Westler ruft die Hausfrau an, wenn dem mal der Reifen platzt.“
Jonas:
Dein Vater, Stephan Trepte, war in der DDR ein bekannter Rockmusiker. Gibt es in seiner Vita Stationen, bei denen Du das Gefühl hast, dass man diese mal verfilmen müsste?
Ludwig:
Ja, da gibt es sehr viele. Ich denke da etwa an seine Reisen durch die Mongolei, das muss eine wahnsinnig tolle Erfahrung gewesen sein. Im Leben meines Vaters finde ich auch die frühen Siebziger sehr spannend, als sein musikalischer Erfolg losging, ebenso die Nachwendezeit. Damals versuchte er, sich irgendwie über Wasser zu halten – mit allen Mitteln. Da ging es stellenweise richtig heiß her.

»Wenn wir einen Musikfilm machen würden, wäre das für meinen Vater etwas spannender.«
Jonas:
Geht es Deinem Vater heute gut? Konnte er sich in seinem Leben neu einrichten?
Ludwig:
Ja, ihm geht’s recht gut. Er musste allerdings in den letzten Jahren relativ oft umziehen. Prenzlauer Berg ist mittlerweile hochsaniert, alles wird teurer und teurer und man treibt die Leute raus, die sich die Mieten nicht mehr leisten können, dort aber schon vor dem Fall der Mauer gelebt haben. Das sorgt für einen großen Groll, nach wie vor. Daher ist bei ihm auch so ein bisschen Frustration eingekehrt. Mittlerweile lebt er am Rand von Berlin. Ich hoffe, dort kann er endlich mal ankommen.
Jonas:
Dein Vater ist Jahrgang 1950 und hat viele der Zeiten, in denen sich Deine Filmfiguren bewegen, persönlich erlebt. Konnte er Dir – als familiärer Zeitzeuge – bei der Vorbereitung Deiner Rollen in irgendeiner Form helfen?
Ludwig:
Mein Vater ist mir immer ein guter Ratgeber gewesen, aber man am Set hat man meistens historische Berater, die sich mit dem Thema genau auseinandergesetzt haben. Ich glaube, wenn wir einen Musikfilm machen würden, wäre das für meinen Vater etwas spannender – so wie „Gundermann“ beispielsweise (Ludwig lächelt).

»Die Gefahr ist viel zu groß, dass man sein eigenes Selbstbild nur noch durch die äußeren Erfolge formt.«
Jonas:
In einem Interview mit den Kollegen des ZEIT Magazin hast Du vor kurzem erzählt, dass Du dich als Schüler nach etwas gesehnt hättest, was Dich interessiert. Wonach sehnst Du dich heute?
Ludwig:
Man ist ja immer so unzufrieden mit dem, was man hat. Erfolg und Anerkennung sind Dinge, die eigentlich völlig an einem vorbeischaukeln. Der einzige Moment, in dem einem das alles wirklich bewusst wird, ist, wenn man zum ersten Mal über den roten Teppich läuft und die Leute den eigenen Namen schreien. Wenn 40 Fotografen vor einem stehen und ständig rufen: „Ludwig! Ludwig!“ Das ist wie Adrenalin, das einem in den Kopf knallt, und man hat in dem Moment das Gefühl, wahnsinnig bedeutend und jemand ganz Besonderes zu sein. Das macht süchtig, man will das immer wieder.
Aber das geht natürlich nicht. Denn weder ist der Kick beim nächsten Mal so geil, noch hat man immer Lust. Daher muss man aufpassen, dass man sich mit dieser kurzzeitigen Anerkennung nicht allzu sehr identifiziert. Die Gefahr ist viel zu groß, dass man sein eigenes Selbstbild nur noch durch die äußeren Erfolge formt. Hat man Erfolg, wird man mit allem überflutet: Autos, Schuhe, Klamotten. Aber bleibt dieser Erfolg mal aus und einem wird das alles wieder weggenommen, fällt man sofort in ein Loch – weil man denkt: „Scheiße, ich bin nichts mehr wert. Die Leute applaudieren nicht mehr.“ Ich persönlich glaube daher, dass es wichtig ist, irgendwann die Kurve zu kriegen und sich selbst nicht so viel Bedeutung zuzumessen. Um also deine Frage zu beantworten: Meine Sehnsucht bezieht sich heute darauf, glücklich zu sein – und zwar ohne diesen ganzen Wahnsinn, ohne diese Schauspieler-Bubble, in der man sich immer wieder aufhält.
#ludwigtrepte #charlottelink #ard #mypmagazine #jonasmeyer #stevenluedtke
Mehr von und über Ludwig Trepte:
Fotos: Steven Luedtke
Interview & Text: Jonas Meyer
Samuel Martínez
Editorial — Samuel Martínez
Sun & Sand & Salt
Spanish photographer Samuel Martínez loves capturing the beauty of his homeland, the maritime area around Huelva on the Atlantic coast. For us, Samu has put together a small editorial that lets us dream of sun, sand, and salt.
27. Dezember 2019 — MYP N° 27 »Heimat« — Photography & text: Samuel Martínez

People change, places change, everything changes constantly over time. That’s why I love these photos of my homeland. They give me the possibility to look at them in a few years and to feel, at least for a second, that nothing has changed.
That’s the beautiful lie of photography. Enjoy!



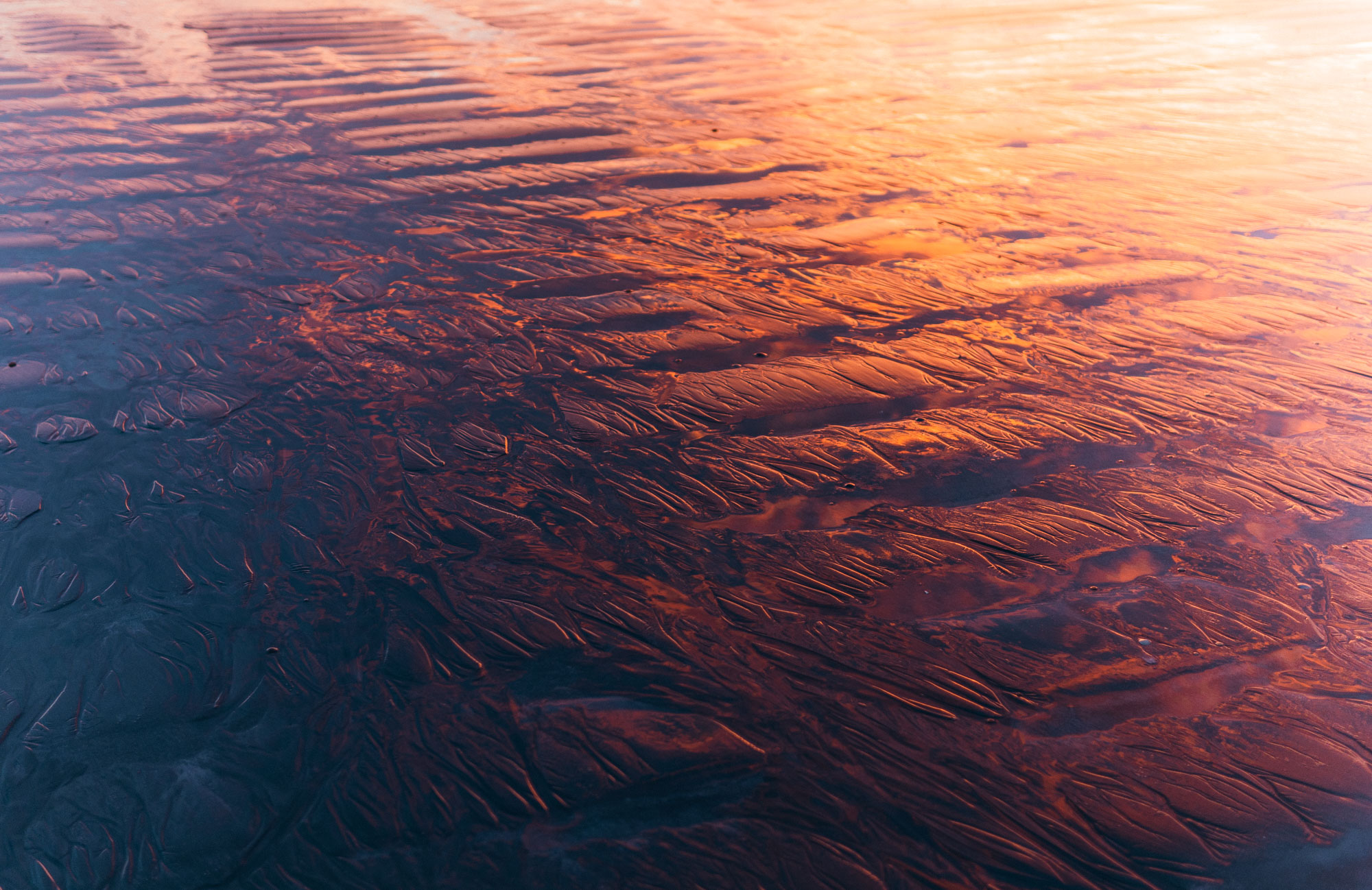





#samuelmartinez #sun #sand #salt #spain #mypmagazine
Photography & text by Samuel Martínez:
Britta Steffenhagen
Interview — Britta Steffenhagen
Eine Berliner Königin
Schauspielerin, RBB-Moderatorin und Kiez-Ikone Britta Steffenhagen lebt in wilder Ehe mit ihrer Heimatstadt Berlin. Die Kabarettkönigin reist mit uns durch die Stationen der Liebesgeschichte zwischen ihr und der Spreemetropole und erzählt von einer Kindheit an der Mauer.
17. Dezember 2019 — MYP N° 27 »Heimat« — Interview & Text: Anna Kasparyan, Fotos: Steven Lüdtke

„Oh Berlin, Berlin, Berlin, du bist aller Städte Queen.“ Diese Zeile aus dem berühmten Lied von Nina Hagen, „Berlin (ist dufte)“, wird seit 1991 generationenübergreifend von (Wahl-)Hauptstädtern geschmettert, die viel Berliner Luft und noch mehr Lokalpatriotismus verspüren. Eine Regung, die auch Moderatorin und Schauspielerin Britta Steffenhagen nicht fremd ist. Bekannt wie ein bunter Hund, verkörpert sie die Kabarettkultur der Stadt, in der sie geboren wurde und nach eigenen Angaben auch sterben wird.
In ihrer Live Show auf Radio Eins, die Sie zusammen mit Magnus von Keil moderiert, fängt die 43-Jährige den Puls der Hauptstadt ein. Daneben erfindet sie, als Teil des Ensembles des Neuköllner Heimathafens, altes Berliner Mundart-Repertoire neu – mit einer endlosen Energie und ihrer rotzfrechen Großstadtmädchen-Attitüde. Ihre Leidenschaft des Lebens, sagt sie, sei der Witz. Denn Menschen zum Lachen zu bringen mache die Welt erträglicher.
Britta Steffenhagen, Enfant terrible und Anarchistin par excellence, trifft uns auf dem Dach des Kreuzberger Urban Krankenhauses. Wir flanieren von ihrem Geburtsort bis zur Stammbühne in Neukölln und lassen uns von ihr ein paar Geheimnisse aus dem Leben und Lieben einer Kiezikone erzählen.
»Ich würde meine Familie als kreative, gebildete Arbeiterklasse bezeichnen.«
Anna Kasparyan:
Du bist in einem Kreuzberger Haushalt aufgewachsen, einen Deiner Opas hast du mal „den König vom Kiez“ genannt. Dich selbst bezeichnest du als eine Berliner Pflanze: Welches Sippengemälde kannst du uns malen?
Britta Steffenhagen:
Ich würde meine Familie als kreative, gebildete Arbeiterklasse bezeichnen. Macher, immer Macher! Alles Berliner. Konditormeister. Elektromeister… Einer meiner Opas war Mitgründer der Taxiinnung, der andere war Fliesenleger. Nachdem er in Stalingrad ein Bein verloren hatte, studierte er an der Sporthochschule und arbeitete im Versehrtensport. Dieser Opa hat mir das Schachspielen beigebracht. In meiner Familie war ohnehin immer viel los. Meine Mutter hatte ein Atelier in Kreuzberg, mein Vater war eine Zeit lang Stadtschreiber, veröffentlichte mehrere Gedichtbände veröffentlicht und nahm Hörbücher auf. Er war zudem im Arbeitskreis „Literatur der Arbeiterwelt“: Arbeiter schreiben für Arbeiter. Da waren wir Kinder auch bei Geheimtreffen mit Literaten in Ostberlin dabei, also in der damaligen DDR. Wir wurden von Anfang an auch zu Erster-Mai- und Friedensdemos mitgenommen.


»Von meinem Vater habe ich alles über Humor gelernt, von meiner Mutter alles andere.«
Anna Kasparyan:
Was davon hat Dich am nachhaltigsten geprägt?
Britta Steffenhagen:
Von meinem Vater habe ich alles über Humor gelernt, von meiner Mutter alles andere. Sie brachte mir vor allem eine warme Anarchie bei. Generell hat dieses „Berlinsein“ meinen Humor sehr geprägt. Und ich habe wenig Hörigkeitsbewusstsein. Man hört, was jemand sagt und wie er es sagt – und nicht, wer das sagt. Das ist etwas, das mir sehr von meinen Eltern mitgegeben wurde. Ich beschreibe sie immer gerne als konservative Achtundsechziger: wertkonservativ, wenn jemand Hilfe braucht – dann ist man da für die Gemeinschaft. Ansonsten wird an der Freiheit zu sich selbst gearbeitet. Aber stets eine Freiheit in dem Bewusstsein, dass du eine Verantwortung für die Gesellschaft hast. Ein Grundgefühl, dass du dich nicht allein in der Gesellschaft bewegst. Das ergibt eine Spannung zwischen Anarchie und Verantwortung. Es ist vielleicht etwas abgedroschen, dieses „Herz mit Schnauze“, aber das gibt es wirklich, finde ich.

»Nach Berlin gehst du, um was zu werden.«
Anna Kasparyan:
Du bist Aushängeschild des RBB und Teil des Gründungsensembles des Berliner Heimathafens. Was macht die Kultur der Hauptstadt aus?
Britta Steffenhagen:
Nach Berlin gehst du, um was zu werden. Und wenn du was bist, gehst du woanders hin. Hier macht es jeder nach seiner Façon. Auch wenn es früher noch rentabler war, ist es im Städtevergleich immer noch so: Du kannst hier günstig leben und dir etwa aufbauen. Dabei triffst du auf Gleichgesinnte, die ebenfalls irgendetwas basteln und irgendwie schräg drauf sind. Die ganze Stadt singt im Chor: Mach dein Ding!
Anna Kasparyan:
Hast du manchmal Angst, dass du den Lokalkolorit irgendwann satthast?
Britta Steffenhagen:
Nee. Nee!


»Ich weiß, dass Berlin mich nicht fallen lassen wird.«
Anna Kasparyan:
Du würdest Berlin niemals verlassen?
Britta Steffenhagen:
Niemals. Ich habe an anderen Orten studiert und gelebt. Ich bin in Kanada zur Schule gegangen, habe lange in London gelebt und ein Jahr in Dublin verbracht. Ich habe immer noch viele Freunde im Ausland. Ich liebe es zu reisen. Aber woanders leben? Dafür mache ich zu viel und zu gerne Projekte in meiner eigenen Sprache: Hörbücher lesen und synchronisieren, Theaterstücke selber schreiben. An Sprache interessieren mich Rhythmus, Akzente und Dialekte. Für mich liegt im Berliner Dialekt ein besonderer Witz, den ich an einem anderen Ort nicht ausleben könnte.
Mir wird es in Berlin nie langweilig. Immer wieder laufe ich irgendwo vorbei und denke mir: Ah, ich liebe es! Ich habe vor einer Weile ein Hörspiel darüber geschrieben, dass ich wirklich in die Stadt verliebt bin – wir haben so eine richtig coole, heiße Affäre. Oder vielleicht eher eine wilde Ehe! Ich würde Berlin um nichts in der Welt fallen lassen und ich weiß auch, dass Berlin mich nicht fallen lassen wird.

»Humor macht es leichter, das Dasein auszuhalten.«
Anna Kasparyan:
Deine Fans lieben dich für deine ungefilterte, exaltierte Persönlichkeit. Wie siehst du dich selbst?
Britta Steffenhagen:
Ich bin schon eher laut. Extrovertiert wohl. Meine Hauptmotivation ist es, die Menschen zum Lachen zu bringen. Wenn mir ein lustiger Gedanke kommt, dann äußere ich ihn auf der Elternversammlung in der Schule genauso wie auf der Redaktionskonferenz. Das ist oft anstrengend für meine Mitmenschen, aber viele lachen eben auch. Meine Aufgabe im Leben ist: Finde den Witz! In jeder Situation.
Ich glaube, ein Witz kann gesellschaftskonstituierend sein. Es ist doch absurd, als denkender Affe leben zu müssen. Du weißt oft nicht, was du hier sollst, wieviel Zeit Du noch hast und wann du gehen musst. Das ist schwer auszuhalten. Und da geht es uns allen gleich. Der andere steckt da genauso in der Bredouille wie du. Selbstironie speziell hilft zu sehen, wie absurd das Leben ist. Humor macht es leichter, das Dasein auszuhalten. Eigentlich bin ich grundmelancholisch, aber das wäre mir als Lebenshaltung zu langweilig.

»Menschen, die ihre Sexualität erkannt haben und ausleben, sind besser in der Welt.«
Anna Kasparyan:
Aber nicht pessimistisch?
Britta Steffenhagen:
Nein, überhaupt nicht. Ich würde es nicht zulassen, dass die Traurigkeit mich lähmt. Zudem bin ich total romantisch. Ich glaube, dass Liebe sehr beim Überleben hilft. Und Sex – Humor, Liebe und Sex. Letzterer ist ein sehr guter Lebensmotor. Ich glaube, dass Menschen, die ihre Sexualität erkannt haben und ausleben, besser in der Welt sind. Sie können oft besser kommunizieren und dadurch fällt es ihnen leichter, andere und sich selbst zu akzeptieren.
Anna Kasparyan:
Wie erlebt man Dich in ruhigen Momenten oder in Situationen, in denen das Energielevel niedriger ist?
Britta Steffenhagen:
Klar verausgabe ich mich. Aber die Leute unterschätzen auch immer wieder, dass meine Kollegen und ich viel von den Zuschauern zurückbekommen. Es ist ein Geben und Nehmen. Es gibt diesen klaren Moment nicht, in dem meine Energie erschöpft ist, weil davor schon wieder drei Witze kommen. Wenn man etwas macht, das einem grundsätzlich nicht liegt und keinen Spaß macht, dann verausgabt man sich wirklich.


»Wahrscheinlich werde ich mal so eine richtig bekloppte Alte.«
Anna Kasparyan:
Hast Du schon immer mit so viel Leidenschaft gespielt, gearbeitet und geliebt?
Britta Steffenhagen:
Ich glaube schon, ja.
Anna Kasparyan:
Spielt für Dich Alter überhaupt eine Rolle?
Britta Steffenhagen:
Pff, wir leben zum Glück in Zeiten, in denen das ziemlich verschwimmt. Mir ging es nie besser als jetzt. Die Beziehungen, die ich habe, und die Tatsache, dass ich zwei Kinder bekommen konnte, das hat mich eher fitter gemacht. Ich werde auch nicht ruhiger oder weniger verrückt. Wahrscheinlich werde ich mal so eine richtig bekloppte Alte.

»Ich war gewohnt, dass regelmäßig die Erde zitterte, wenn die Panzer an mir vorbeifuhren.«
Anna Kasparyan:
Und wie war deine Kindheit?
Britta Steffenhagen:
Als Kind habe ich mir mehr Zeit für mich alleine genommen, stromerte beispielsweise mit der Blockflöte durch den Wald und habe Nüsse gesammelt, in von mir hergestellten Beutelchen. Das war so eine einsiedlerische Elfennummer. Sieben Monate im Jahr lebten wir in einer großen Stadtwohnung in Schöneberg. Aber im Sommer lebten wir etwas weiter draußen in Rudow, weil wir dort den Garten meiner Urgroßmutter hatten, mit einem richtigen Steinhaus drauf. Ich wuchs also an der Mauer auf. Von diesem Garten wurde nach dem Krieg ein Teil abgetrennt, weil die Alliierten eine Straße bauen wollten, um mit Panzern auf der anderen Seite der Mauer patrouillieren zu können. Ich war gewohnt, dass regelmäßig die Erde zitterte, wenn die Panzer an mir vorbeifuhren.
Neben der Straße befand sich die Uferböschung entlang des Landwehrkanals und auf der anderen Seite lagen der Mauerstreifen und die Mauer, mit einem schmalen Streifen Brachland davor. Da war nichts außer Blumen, Obstbäumen und Unkraut, Kilometer um Kilometer um Kilometer. Ein wilder Spielplatz. Wir Kinder aus der Gegend wussten: Ah, jetzt sind die Himbeeren reif! Da hinten gibt es Walnüsse! Hinter der Ecke ist das Höhlenbauen am besten!
Oft wurden wir dabei von den Grenzern beobachtet. Wir kletterten zum Beispiel auf einen Baum, um Kirschen zu pflücken. Aber wenn der Baum zu nah an der Mauer stand, haben uns die Grenzer vom Wachturm aus mit dem Maschinengewehr bedroht und wir musstest runter. Ein beliebtes Spiel war auch: „Wer traut sich, die Mauer anzufassen?“ Vom Westen aus ging das ja.
Anna Kasparyan:
Wie hast du 1989 den Mauerfall erlebt?
Britta Steffenhagen:
Ich fand das toll! Endlich war die Mauer weg! Wahnsinn, erstmal Freiheit für alle. Aber um meinen wilden Spielplatz tat es mir leid. Jetzt war es weg, mein Paradies. Mein kilometerlanges „Wo-keiner-dir-was-konnte“ war dahin. Heute ist genau an dieser Stelle eine Autobahn.


»Bis vor ein paar Jahren habe ich mich für Feminismus in dem Sinne nicht interessiert.«
Anna Kasparyan:
Du hast Dich entschieden, mit Deinem Mann und Deinen beiden Kindern in Kreuzberg sesshaft zu werden. Wie stark wirst Du in deinem Umfeld mit der Frage konfrontiert, wie Du Kinder und Karriere unter einen Hut bekommst?
Britta Steffenhagen:
Das wird schon öfter gefragt. Aber ich bin nicht alleine mit den Kindern. Mein Mann und ich teilen uns da ziemlich paritätisch auf. Warum auch nicht: Ich bin Mutter und Bühnenarbeiterin, er ist Vater und Jurist. Ein Mann, der zwei Kinder hat und einen Vollzeitjob, wird immer noch viel seltener gefragt: „Wie schaffen Sie das denn, den Job und die Familie?“
Ich bin Neu-Feministin, das heißt: Bis vor ein paar Jahren habe ich mich für Feminismus in dem Sinne nicht interessiert. Ich habe mein ganzes Politikwissenschaft-Studium an der Freien Universität ohne ein einziges Feminismus-Seminar geschafft und war noch stolz drauf.
„Oh, wo ist das Problem, Männer sind doch geil und wir sind doch alle Menschen,“ das war mein großer, vollmundiger Spruch mit 18. Und je mehr ich dann in Strukturen gearbeitet und die vergangenen Jahre beim RBB erlebt habe, wurde mir klar: Ey, das ist der Wahnsinn! Ich hab‘ da Sachen gehört und erlebt, bei denen ich nie gedacht hätte, dass es die noch gibt. Da ist mir die Blase, in der ich davor gelebt und gearbeitet hatte, erst bewusst geworden.

»In der Unterhaltung ist es nicht lustig als Frau, wenn du die Fresse aufreißt.«
Anna Kasparyan:
Als Frau in einer sehr männerdominierten Branche zu arbeiten, ist sicherlich nicht einfach, zumal Frauen in der Unterhaltung immer wieder gegen Vorurteile ankämpfen müssen. Wie siehst Du das? Wie würdest Du deinen Weg bis hierhin beschreiben?
Britta Steffenhagen:
In der Unterhaltung ist es nicht lustig als Frau, wenn du die Fresse aufreißt. Da bist Du schnell hysterisch, während Männer mal sagen, was Sache ist. Als ich anfing, die RBB-Abendshow zu moderieren, war ich erstaunt, dass keiner von den CVDs (Anmerkung der Redaktion: Chefs vom Dienst, die die Sendung verantworten) eine Frau war. Auch der Redaktionsleiter war ein Mann und im Redaktionsstab sah ich wenige Frauen. Die Bestimmer sind halt nach wie vor oft Männer, das fand ich schwierig.
Beim Heimathafen Neukölln, bei den „Rixdorfer Perlen“, läuft es ganz anderes. Wir sind ein Frauenteam, das gesagt hat: „Wir haben kein Bock mehr auf diese männlichen Bühnen. Wir machen jetzt Theater in einer Bezirksecke, wo es kein Theater mehr gibt – von Berlin, für Berlin.“ Der Heimathafen ist Volkstheater im guten Sinne. Da muss man vorher kein Reclam Buch gelesen haben und es geht trotzdem um aktuelle Politik und um „schwierige“ Themen.

»Dieser Ton geht bei uns gar nicht.«
Anna Kasparyan:
Gegen welche Vorurteile musst Du immer wieder ankämpfen?
Britta Steffenhagen:
Wenn man als Künstlerin – wobei ich den Begriff „Künstler“ oft sehr abgehoben finde – in so ein amtliches Gefüge gerät, hört man schnell: „Dieser Ton geht bei uns gar nicht.“ Wobei ich meine anarchistischen Umfragen gemacht habe und die meisten Mitarbeiter weniger Probleme mit mir hatten als die Chefs. Da hieß es beispielsweise: „Vor den Technikern kannst du so nicht reden!“ Mit den Technikern habe ich mich aber am besten verstanden. Die haben dann auch gesagt: „Na, wir sind doch eine Familie, wir wissen doch, wie Du tickst.“
Anna Kasparyan:
Wie blickst Du in die Zukunft?
Britta Steffenhagen:
Machen. Arbeiten. Die Message herausarbeiten. Weiter die Fresse aufreißen.


»Die Aufgabe des Öffentlich-Rechtlichen ist, jedem einzelnen Zuschauer Mut zu machen.«
Anna Kasparyan:
Sowohl deine frühere „Abendshow“ als auch deine „Radioshow“ gehören zum Öffentlich-Rechtlichen. In der guten alten BRD war dieses TV-Konzept ein Heimatschaffendes für das Nachkriegs-Westdeutschland. Welche Rolle kann das Öffentlich-Rechtliche heute noch spielen und wie denkst du über die Debatten zur Abschaffung des Pflichtbeitrags?
Britta Steffenhagen:
Die Aufgabe des Öffentlich-Rechtlichen ist – gerade bei Unterhaltungsformaten – nicht einzuschläfern und abzulenken, sondern jedem einzelnen Zuschauer Mut zu machen und nah an den Leuten zu sein. Daher habe ich eigentlich immer gerne für den RBB gearbeitet. Immerhin sind meine Eltern nach Brandenburg gezogen, ich kann den Bogen also von der Hauptstadt bis in die Provinz spannen. Auf dem Weihnachtsmarkt in Lehnin wurde ich genauso angesprochen wie in der U-Bahn in Berlin. Ich glaube gar nicht, dass die Brandenburger und die Berliner so unterschiedlich sind. Der Humor ist auf jeden Fall derselbe.

»Weißt du eigentlich, für wieviel andere Scheiße du Geld zahlst?«
Anna Kasparyan:
Und die Debatten zur Abschaffung des Pflichtbeitrags findest Du in diesem Kontext überflüssig?
Britta Steffenhagen:
Wenn ich das höre, „Ey, für diese Scheiße habe ich jetzt Geld bezahlt!“, dann denke ich mir: Weißt du eigentlich, für wieviel andere Scheiße du Geld zahlst? Ich sag‘ das jetzt mal so platt links: Mit deinen Steuergeldern werden Subventionen für die Superreichen gezahlt. Dann gibt es noch Euroatom, die institutionelle Förderung von Atomkraft. Die Automobil-Lobby macht einen guten Job, umweltschädliche Subventionen zu protegieren, die wirklich das Gemeinwohl schädigen. Deshalb finde ich: Wenn man dafür nur halbwegs ein Gefühl entwickelt hat, dann sind die Rundfunkgebühren die geringste Abgabe.
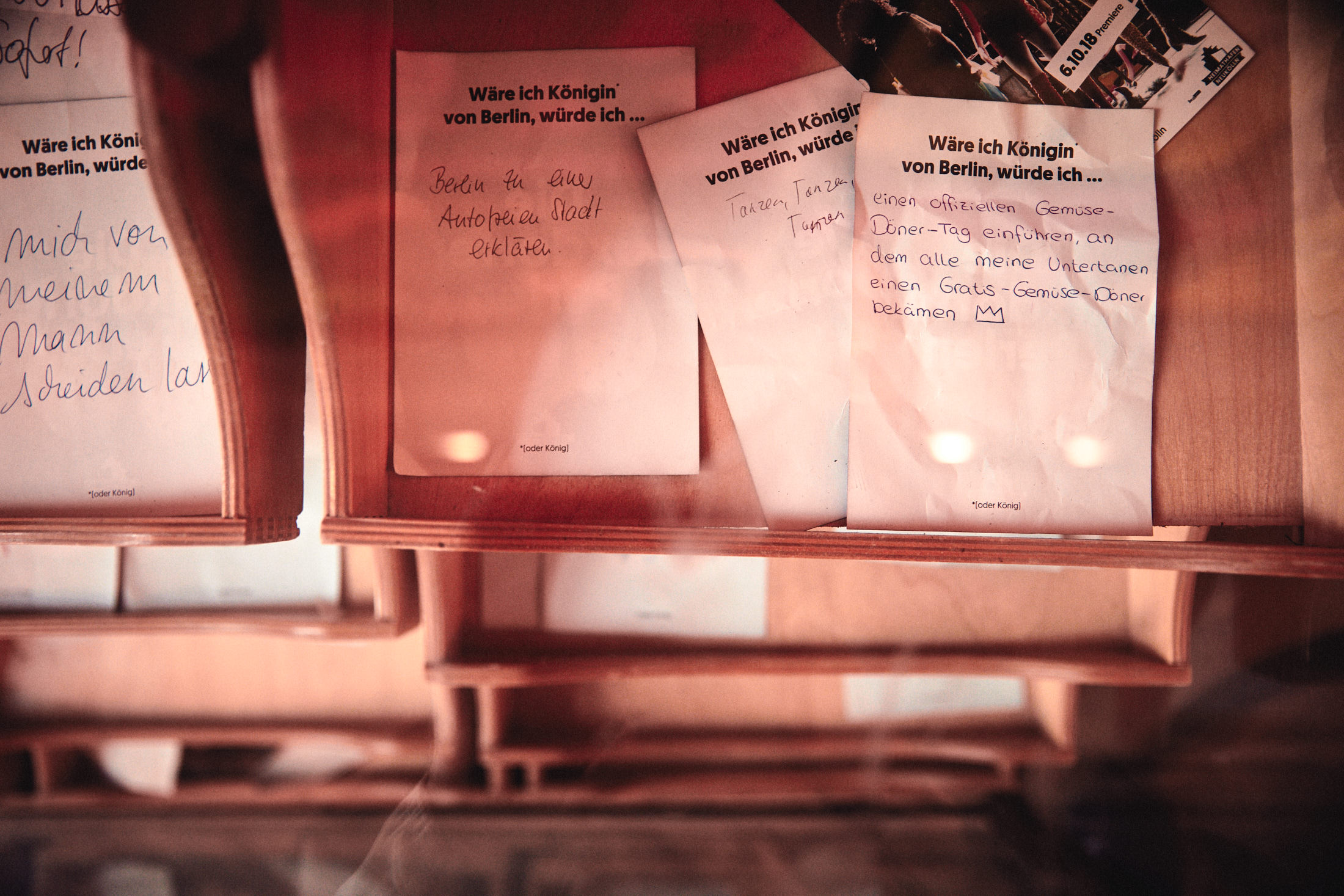
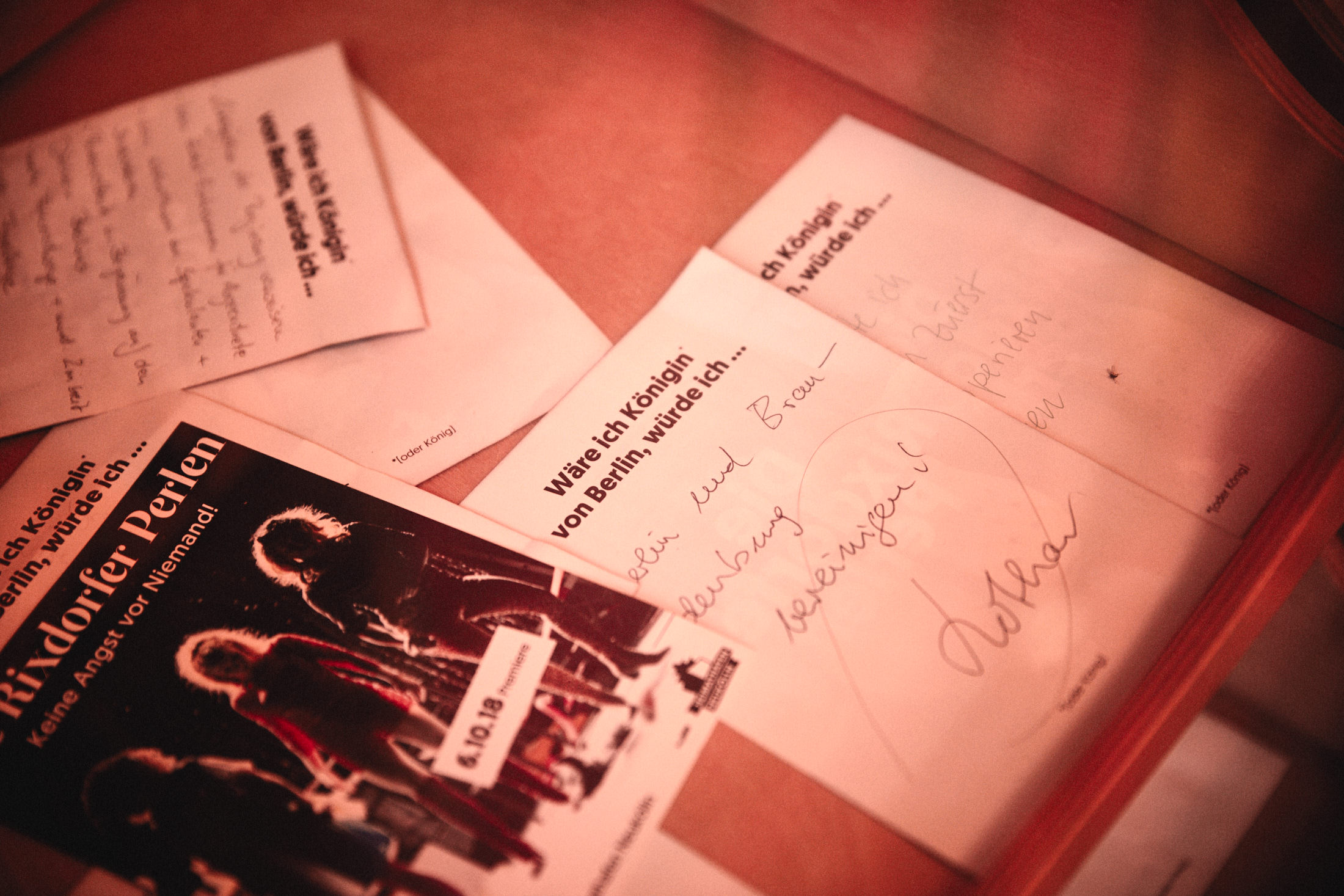
»Der Glanz von Berlin hat viel mit dem Ermächtigen von Kreativen zu tun.«
Anna Kasparyan:
Wie siehst Du die Entwicklung Deiner Stadt? Gerade in Berlin finden zur Zeit massive Demonstration statt, etwa für Enteignungen und gegen Mieterhöhungen. Hast du Angst, dass Deine Stadt ihren Glanz verlieren könnte?
Britta Steffenhagen:
Das impliziert, dass niedrige Miete gleich Glanz bedeutet. Ich glaube, der Glanz von Berlin hat viel mit dem Ermächtigen von Kreativen zu tun. Es ist diese Grundstimmung: „Mach ruhig dein Ding, mach ich auch.“ So eine Grundstimmung muss ermutigen und die Individualität fördern – und keine Angst davor haben. Westberlin zum Beispiel war unter den Alliierten ganz schön verspießt. Ich habe erst vor kurzem einen interessanten Artikel gelesen, in dem es hieß, dass sich die Westberliner viel mehr an die Amis und die Franzosen – also an die Besatzer-Mächte – assimiliert hätten, als sich die Ossis an die Russen angepasst hätten. Und trotzdem hat jene Zeit auch Nischen und Gegenbewegungen befördert. Ich glaube, in beiden Teilen der Stadt gab es immer dieses spezielle, typisch berlinerische Autoritätsverhältnis. Auch wenn der Turbokapitalismus seine Schneisen in die Stadtseele schlägt…

»Wir als Bewohner müssen eine Vision davon haben, wo die Stadt hinsoll.«
Anna Kasparyan:
Ist Berlin gerade in Gefahr?
Britta Steffenhagen:
Na ja. Berlin ist das, was wir daraus machen. Hier gibt es Extinction Rebellion, Hausbesetzer, es gibt die Diskussion zum Mietendeckel und irgendwie glaube ich auch daran: Wenn’s zu viel ist, wird hier alles lahmgelegt. Beim Klimastreik waren in Berlin die meisten Menschen auf der Straße, verglichen mit anderen deutschen Städten – das hat mich gar nicht überrascht. Wir als Bewohner müssen eine Vision davon haben, wo die Stadt hinsoll. Tatsächlich wundere ich mich deshalb, warum von Berlin aus nicht mehr gesellschaftliche Innovation kommt. Zum Beispiel das Experiment eines bedingungslosen Grundeinkommens.

»Den Begriff Heimat dürfen wir nicht den Wichsern überlassen.«
Anna Kasparyan:
Was denkst Du über die aktuelle Debatte um den Heimatbegriff? Und was bedeutet für Dich Heimat?
Britta Steffenhagen:
Ich finde, den Begriff Heimat dürfen wir nicht den Wichsern überlassen. Deshalb bin ich auch beim Heimathafen dabei. Heimat ist der Hafen – und die Seefahrer kommen von überall. Man selbst war auch überall, man ist Kosmopolit, trotzdem weiß man, wo der eigene Anlegeort ist. Und deshalb verträgt sich aus dieser Sicht der Begriff Heimat überhaupt nicht mit Fremdenfeindlichkeit oder Angst!
Anna Kasparyan:
Was ist Dein letztes Statement?
Britta Steffenhagen:
Machen ist wie Wollen, nur krasser… und vielleicht noch Ficken für den Feminismus!
Britta Steffenhagen ist regelmäßig als eine der „Rixdorfer Perlen“ im Heimathafen Neukölln zu sehen, außerdem begegnet man ihr in diversen Kiezkneipen in und um Kreuzberg.
#brittasteffenhagen #rixdorferperlen #rbb #heimathafen #interview #annakasparyan #stevenluedtke #mypmagazine
Mehr von & über Britta Steffenhagen:
brittasteffenhagen.de
instagram.com/brittasteffenhagen
heimathafen-neukoelln.de
Interview & Text: Anna Kasparyan
Fotografie: Steven Lüdtke
Flume
Interview — Flume
A Modern Play
The way Flume stages his live shows breaks with all the usual clichés about electronic music. We met the Australian artist in the morning after his performance in Berlin, talking about his show style, the meaning of home, and the simple things in life.
8. Dezember 2019 — MYP N° 27 »Heimat« — Interview & Text: Jonas Meyer, Photography: Steven Lüdtke

“Sitting in KFC carpark by myself in trackies. Life is good”—that’s the short but expressive caption to the oldest photo that can be found on the official Instagram account of electronic music artist Harley Edward Streten, better known as Flume. This very photo shows a box full of junk food, held on Harley’s thighs, which stretch under the steering wheel of a car. On the left side of the picture you can see his hand grabbing a can of lemon soda. And indeed, looking at that scene, the caption to the photo couldn’t be more appropriate: Life is good.
This culinary still life was posted on Instagram on July 4, 2012, almost exactly four months before the day that would finally put Harley aka Flume in the international limelight. On November 9, 2012 (the young Australian had just turned 21) his self-titled debut studio album, “Flume,” was released, topping the ARIA Albums Chart shortly thereafter and reaching double-platinum accreditation in Australia. What followed was a meteoric rise. The talented musician started remixing songs from such artists as Lorde, Sam Smith, Arcade Fire, Hermitude, and Disclosure, and it was not long before you could hear his catchy tunes all over the world. In May 2016 he released his second record, “Skin,” that won the “Best Dance/Electronic Album” category at the 2017 Grammy Awards. The success just didn’t want to stop. And it lasts until today.
Fast forward to October 30, 2019. With a cup of tea and some delicious pastries, we sit with Harley in the Berlin Hotel de Rome, one of the most luxurious hotels in the city. The night before, he played a concert at the Tempodrom hall—sold out, of course. Besides a couple of well-known songs, he presented tracks from his new album entitled “Hi This Is Flume (Mixtape),” which he had already published in March.
Thinking about artists of the electronic music genre, one is inclined to assume that their shows always run according to the same pattern: A musician (most often male) stands behind a desk of turntables, plays a little on the equipment and smashes his fists in the air in staccato, grinning happily all the time. For accentuating that event, there’s lots of pyrotechnics, glitter, and laser lights. A standard recipe for every electronic music show, one might think.
For almost every show, that is. If you visit a Flume gig for the very first time, you will be pleasantly surprised. and maybe a bit confused at the beginning. Here the artist is not standing behind a desk—because there simply is none. He plays the whole stage, and plays is the right word, because Harley acts more like the main actor in a modern play. It may be that, being in the audience, you don’t always understand what’s really going on. But it absolutely doesn’t matter, because you always find yourself very well entertained.
The sentiment appears to be shared. At least as far as the recent performance in the Tempodrom was concerned, there were happy faces all around—a mood that seems to have been directly transferred to Harley, sitting here in the hotel now, having tea and pastries. Life is good.


»I’m very grateful to be in the position I am.«
Jonas:
Harley, when I see the huge amount of people following you on social media, when I see all these young people coming to your show, hugging and kissing each other while listening to your music like they did last night, it seems that you’re hitting the nerve of an entire generation. Are you sometimes surprised—or even overwhelmed—by your own success and the impact you have?
Harley:
It’s all a little surreal, honestly. It’s just been growing and growing, and I guess I’m just kind of hanging on, seeing what happens, riding it out. I think I’m really lucky and fortunate. And I’m very grateful to be in the position I am—because it’s still a lot of fun.
Jonas:
Talking about that right now, you seem like you can’t really believe what happened over the last few years…
Harley:
Yeah, because it’s just been a wild and crazy ride.


»I have way more fun testing the limit than just doing a safe show.«
Jonas:
Speaking of a wild and crazy ride, your last night’s show seemed to be exactly like that. To me—who was witnessing one of your shows for the very first time—it seemed more like a modern theater play than a concert. What is the biggest challenge for you to present electronic music live on stage?
Harley (sighs):
Look, I myself go to a lot of electronic shows and it always seems to be someone standing in the middle of the stage all the time and doing stuff that no one even understands. You know, twiddling nobs, moving sliders, and so on. I just got bored by that and thought: Why not make it more interesting? What can I do to avoid being in the same spot for the whole show? Maybe I could play a little from here, then from over there, maybe I could do some things to take it away from the classic DJ show and turn it into something different, trying to give it some drama. And honestly, it’s been really enjoyable to just kind of test what I can do in terms of what people like and how they respond. I have way more fun testing that limit than just doing a safe show.
Jonas:
Can it go wrong sometimes?
Harley (laughs):
Yeah, absolutely! But that’s cool because there are infinite possibilities how the show can develop, and it’s still growing.


»I want to do the opposite of what people expect.«
Jonas:
Talking with your assistant Harry about last night’s show a couple of minutes ago, he said you guys “like it weird” and that you use to say, “Make it weirder!” when you’re planning your shows. What kind of weirdness are you looking for?
Harley:
If I personally went to a concert, I would want to see something different. I wouldn’t like seeing an artist who is so protected standing behind a big booth. That’s the reason why I thought, in my case, it could be much more interesting for the audience to see the full length of me—which makes me more vulnerable, by the way. I try to make it more personal and less like me as a little dot on a big rise-up. I want to do the opposite of what people expect. I think a lot of artists in my position are building huge spaceships with their shows and everyone tries to build an even bigger thing next time. In my opinion that’s like a big dick-swinging contest, that’s something that made me go crazy. At some point I asked: Why don’t we just not play that game? And then I started just running around on stage, doing all sorts of stuff and trying to tell a story. That’s different and definitely weird, but it’s going well so far.
»The thing I miss most is experiencing things for the first time.«
Jonas:
In your new song, “Pushing Back,” there are the following lyrics: “Sometimes I dream about going back, keeping all the things I left behind.” Did you personally ever feel that way? Did you ever feel the desire of going back?
Harley:
All the time! The thing I miss most is experiencing things for the first time—with all the joy, the excitement and the rush that come with that. And the older I get, the more I miss that. That’s the reason why I try to recreate that feeling, for example, when I’m traveling by myself. Or when I’m writing. When I want to experience something for the very first time, I need to put myself in situations that are not so comfortable. And that’s especially inspiring, to be honest.


»At home, I have a van with a bed in the back. That’s my happy place.«
Jonas:
The oldest post I found on your official Instagram channel is a photo showing you sitting in the car holding a soda and junk food in your hands. Caption: “Sitting in KFC carpark by myself in trackies. Life is good.” Have these precious moments become rare in your life? Or do you still treat yourself with this kind of “luxury” from time to time?

Harley:
Rare? This? Believe me, I make sure to have time to do that. When I go back home, I’m living the simple life. Not as complex as this (letting his eyes wander through the luxurious hotel lobby). At home, I have a van with a bed in the back. I bring my surfboards and drive up and down the coast. That’s my happy place.

»I had been working as a waiter at a Hard Rock Cafe, and I hated it.«
Jonas:
The photo I’ve talked about was posted in July 2012, which means four months before you released your very first album. What memories come to your mind when you think back to that time?
Harley:
That was a very exciting time. A few months before, I had been working as a waiter at a Hard Rock Cafe, and I hated it. It was around the time when I created “Sleepless” and a few other tracks sitting on my computer. I linked up with the Future Classic record company, they made an EP out of my tracks, and when it came out, I was able to quit my job.


»I think about going home most days.«
Jonas:
It seems that, by now, you’ve seen nearly every corner of the world. Do you ever feel homesick?
Harley:
I think about going home most days, I definitely think about my simple life in Australia. The surfboards, my van. So, I would say a little bit homesick. But I also find exciting what’s going on right now, I love this situation.
Jonas:
When you’re traveling a lot and you can’t be at home, have you created—over time—a different personal understanding of the word home?
Harley:
Yes, I feel like I have a few homes now: in the States, in Australia, but also having my dog with me. I’m relatively young, so I’m gonna do this now because I have time to live the simple life later on. Right now, I just want to seize the opportunity and see as much of the world as possible.


»It’s the simple things in life.«
Jonas:
In a few days, you’re going to celebrate your birthday. What do you wish for?
Harley:
Oh, geez! What date is it today?
Jonas:
30th October. Tomorrow is Halloween.
Harley:
We’re going to play in Amsterdam on my birthday. I think I’m just gonna get a massive joint there to relax (laughs). We’ll see.


Jonas:
There are the words “true beauty” written on your shirt. What does true beauty mean to you?
Harley:
It’s the simple things in life. Having this hot tea right here and right now, for example, this is true beauty. Or Percy, my dog. This guy right here (Harley presents the background photo of his smartphone). He’s with a friend right now, but I miss him a lot. But I have to be honest, I don’t even know. I just picked the shirt somewhere.

#flume #hithisisflume #mypmagazine #jonasmeyer #stevenluedtke
More about Flume:
Photography by Steven Luedtke:
Interview & text by Jonas Meyer:
Editing by Benjamin Overton:









