Jonas Nay
Interview — Jonas Nay
Gespielte Geschichte
In »Deutschland 89«, der dritten Staffel der beliebten deutsch-deutschen Spionageserie, schlüpft Jonas Nay wieder in die Rolle des DDR-Agenten Martin Rauch – diesmal zu Zeiten des Mauerfalls. Im Interview erklärt der Schauspieler, warum die Hauptfigur nicht immer so handelt, wie man das aus der eigenen Moralvorstellung heraus vermuten würde. Und er beschreibt, was er durch die Serie über unsere Gesellschaft gelernt hat.
9. Oktober 2020 — MYP N° 30 »Gemeinschaft« — Interview & Text: Jonas Meyer, Fotos: Maximilian König

Die Karl-Marx-Allee im Osten Berlins hat schon viel erlebt. Die kilometerlange Trasse zwischen Alexanderplatz und Frankfurter Tor, die einst Große Frankfurter Straße hieß, ist nicht nur eine der ältesten Verkehrsadern der Stadt. Sondern auch eine ihrer ältesten Zeitzeuginnen.
Anfang des 18. Jahrhunderts als sogenannter Heerweg errichtet, war sie über die letzten 300 Jahre immer wieder Schauplatz dramatischer Ereignisse. Wie etwa in den Revolutionsjahren 1848 und 1919, als auf und neben ihr erbitterte Barrikadenkämpfe tobten. Oder am 16. Juni 1953, als die Beschäftigten der umliegenden Großbaustellen ihre Arbeit niederlegten und über die mittlerweile Stalinallee genannte Straße in Richtung Stadtzentrum marschierten. Sie protestierten gegen eine zuvor vom SED-Regime angeordnete Erhöhung der Arbeitsnormen. Die Bewegung entwickelte sich in kürzester Zeit zu einem Volksaufstand in der gesamten DDR, der bereits wenige Stunden später, am 17. Juni, von sowjetischen Panzern gewaltsam niedergeschlagen wurde.
Acht Jahre später, da stand bereits die Berliner Mauer, wurde der westliche Teil der repräsentativen Stalinallee in Karl-Marx-Allee umbenannt, der östliche Teil hieß ab sofort Frankfurter Allee – man wollte den Namen „entstalinisieren“. Knapp drei Jahrzehnte blieb es danach still. Doch dann trugen die Bürger der DDR ihren Unmut erneut auf die Straßen, auch auf diese. Am Ende stand der Fall der Mauer am 9. November 1989.

Mit diesem historischen Ereignis startet nun, dreißig Jahre nach der Wiedervereinigung, „Deutschland 89“, der dritte und vorerst letzte Teil der preisgekrönten Erfolgsserie, den man seit dem 25. September auf Amazon Prime anschauen kann. Wie „Deutschland 83“ und „Deutschland 86“ erzählt auch Staffel 3 die fiktionale Story um einen DDR-Agenten, deren inhaltlicher Rahmen von realen Ereignissen der deutsch-deutschen Geschichte und des Kalten Krieges gesetzt werden.
Im Mittelpunkt steht der Charakter Martin Rauch, der in der ersten Staffel als Spion in die Bundeswehr eingeschleust wird und nicht weniger als einen Atomkrieg verhindert. Eine Staffel später findet er sich inmitten eines afrikanischen Stellvertreterkonflikts wieder und avanciert im Laufe der Episoden zum Doppelagenten. In seiner ostdeutschen Heimat am anderen Ende der Welt wächst derweil das Chaos. Die DDR steht kurz vor dem finanziellen Kollaps und man versucht krampfhaft, an dringend benötigte Devisen zu kommen.
Wieder eine Staffel später, wir schreiben mittlerweile das Jahr 1989, geht es um den Zusammenbruch der DDR und ihres Gesellschaftssystems nach dem Fall der Mauer. Die Hauptverwaltung Aufklärung, der Auslandsnachrichtendienst der DDR, steht dabei ebenfalls vor der Auflösung. In dieser Gemengelage gerät Martin Rauch zwischen die Fronten sich fundamental verschiebender Machtverhältnisse – und droht sich dabei selbst zu verlieren.
Gespielt wird die Figur von Jonas Nay, der vor wenigen Tagen 30 Jahre alt geworden ist. Für seine Rolle in „Deutschland 83“ wurde der Schauspieler 2016 mit dem Deutschen Fernsehpreis sowie dem Grimme-Preis ausgezeichnet.
Wir treffen den gebürtigen Lübecker vor einem Café in der Karl-Marx-Allee, nur wenige Meter entfernt vom Rosengarten – jenem Ort, an dem am 16. Juni 1953 die Proteste der Ostberliner Bauarbeiter begannen. Ihre Losung damals: „Kollegen reiht Euch ein, wir wollen freie Menschen sein!“

»In der dritten Staffel erleben wir Martin Rauch als einen Charakter, der deutlich traumatisiert ist.«
MYP Magazine:
Martin Rauch ist seit mittlerweile sechs Jahren Teil Deines Lebens. Wie hat sich diese Figur über die drei Staffeln entwickelt?
Jonas Nay:
Martin hat sich im Laufe der Zeit extrem verändert, alleine weil die Geschichten, die wir erzählen, so viele menschliche Abgründe und Extremsituationen beinhalten. Daneben ist er permanent einem extrem hohen Stress ausgesetzt, unter anderem, weil er mit allen Mitteln versucht, nicht als Spion aufzufliegen. Oder im Bürgerkriegsgeschehen in Afrika in irgendeiner Form überleben will. All das formt seinen Charakter sehr.
In der ersten Staffel starten wir mit einem Martin, den wir als eher entspannten Menschen kennenlernen. Er ist noch sehr jung, unschuldig und naiv – ein junger DDR-Grenzsoldat, der sein Leben in Kleinmachnow lebt, ein liebevolles Verhältnis zu seiner alleinerziehenden Mutter pflegt, eine Freundin hat und in seiner Freizeit nackt baden geht. Oder kurz gesagt: Die Figur befindet sich am Anfang der Serie noch in einer relativ stabilen, unspektakulären Lebenssituation.
Der Horror geht erst richtig los, als er gegen seinen Willen zu einem Spion im Westen gemacht wird. Das verändert Martin sehr schnell und er wird zu einer Person, die weiß, dass sie niemandem mehr trauen darf – und sich dementsprechend nicht mehr öffnet. Im nächsten Schritt entwickelt sich Martin zu jemandem, der nicht mehr nur eine, sondern eine Doppelrolle spielt, um seine Identität zu wahren. In der dritten Staffel schließlich erleben wir ihn als einen Charakter, der deutlich traumatisiert ist.

»Mir persönlich hat es sehr wehgetan, was diesem Charakter im Laufe der Zeit passiert ist.«
MYP Magazine:
Welche Beziehung hast Du selbst zu der Figur Martin Rauch entwickelt?
Jonas Nay:
Grundsätzlich bedeutet jede Staffel für mich ungefähr ein halbes Jahr Vorbereitung und Drehzeit, wenn nicht sogar mehr. Das heißt, ich habe bisher in meinem Leben fast zwei Jahre nur mit diesem Charakter verbracht. Ich bin gerade 30 geworden, da fühlen sich diese zwei Jahre meines Lebens nach einer sehr langen und intensiven Zeit an.
Insgesamt ist mir Martin schon früh ans Herz gewachsen. Ich mag seine trockene Art und Weise, seinen Humor, seinen Pragmatismus. Auch wenn er immer wieder in die absurdesten, schlimmsten Situationen geschmissen wird, findet er irgendwie stets einen Weg. Er lässt sich nicht unterbuttern, sondern hat die Einstellung, aus allem das Beste zu machen.
Martin Rauch ist mir immer ein extremer Sympath gewesen, daher hat es mir persönlich auch sehr wehgetan, was diesem Charakter im Laufe der Zeit passiert ist. Außerdem hat er in den drei Staffeln durchaus ambivalente Entscheidungen getroffen, die ich zwar inhaltlich nachvollziehen konnte, bei denen ich aber gerne persönlich interveniert hätte und ihm zugerufen hätte: Martin, lass mal!

»Im Jahr 1989 lebt Martin auf einmal das einfache Leben in der DDR.«
MYP Magazine:
Die einzelnen Staffeln der Serie schließen inhaltlich nicht nahtlos aneinander an, sondern weisen in der Erzählung immer eine zeitliche Lücke von drei Jahren auf. Spielt Ihr ein bisschen mit dem geschichtlichen Wissen der Zuschauer, die durch die Erzählform gezwungen sind, diese nichterzählte Zeit mit ihren persönlichen Erinnerungen zu füllen?
Jonas Nay:
Ein wenig schon. Nur kann ja keiner der Zuschauer wissen, was mit den Charakteren der Serie in ihren fiktionalen Strängen in der Zwischenzeit geschehen ist. Für mich als Schauspieler ist es daher immer eine große Herausforderung, diese zeitlichen Gaps für die Figur zu füllen. Mit jeder Staffel stellt sich erneut die Frage: Wo wollen wir starten und wohin entwickelt sich der Charakter?
Grundsätzlich bedeuten diese drei Jahre für Martins Leben immer einen großen Umbruch. Wenn ich etwa daran denke, dass er zu Beginn der zweiten Staffel plötzlich im Exil ist, in einem Waisenheim in Angola hängt, dort Deutschunterricht gibt und dabei seinen dreijährigen Sohn Max noch nie gesehen hat – da musste ich mir selbst auch erst mal im Kopf eine mögliche Story zusammenbauen, wie es dazu gekommen sein könnte.
Eine Staffel später, im Jahr 1989, lebt Martin auf einmal das einfache Leben in der DDR, arbeitet bei Robotron und ist alleinerziehender Vater seines mittlerweile sechsjährigen Sohnes. Max‘ Mutter, die sich bis dahin um das Kind gekümmert hatte, ist nun plötzlich in Moskau für den KGB tätig.

»Ich bin mit Martin mehr oder weniger in Echtzeit mitgewachsen.«
MYP Magazine:
Inwiefern hat die Figur Martin Rauch Deine eigene Entwicklung der letzten sechs Jahre geprägt und beeinflusst?
Jonas Nay:
Ich bin mit Martin mehr oder weniger in Echtzeit mitgewachsen. Wie bei ihm ist auch in meinem persönlichen Leben in all den Jahren wahnsinnig viel passiert – zwar nichts so Traumatisierendes wie das, was die Figur erlebt hat. Aber alleine die Veränderung meines eigenen Lebens hat mir als Inspirationsbasis geholfen, um das glaubhaft zu erzählen, was in Martins Vita passiert.
MYP Magazine:
Bist Du wie Martin auch misstrauischer geworden?
Jonas Nay:
Ja, das bin ich tatsächlich – leider. Aber ich befürchte, dass wird jeder Mensch irgendwann im Laufe seines Lebens, je mehr Vertrauensbrüche er erlebt und je mehr Leute er kennenlernt. Ich bin in den letzten Jahren nicht per se zum Menschenfeind geworden, aber es dauert lange, bis ich jemandem vertraue. Das war zwar schon immer so, aber hat sich mit der Zeit deutlich verstärkt.

»Es ist nicht der Plan einer solchen Serie, einen Charakter immer nur so handeln zu lassen, wie man das mit seiner persönlichen Moralvorstellung vermuten würde.«
MYP Magazine:
In Rumänien ermordet Martin ohne Not einen Securitate-Agenten. Wie blickst Du auf dieses Ereignis?
Jonas Nay:
Dieser Moment ist wahrscheinlich der größte Bruch in seiner Persönlichkeit. Hatte er vorher immer nur aus Notwehr getötet, ist das nun sein erster Mord. Für dieses Situation hätte es sicherlich auch andere Lösungsmöglichkeiten gegeben.
MYP Magazine:
Inwiefern?
Jonas Nay:
Tatsächlich war das eine Szene, über die wir lange diskutiert haben im Kreis der Autoren und Regisseure. Das war ein absoluter Entfremdungsmoment für mich – aber das war auch gut so. Es ist nicht der Plan einer solchen Serie, einen Charakter immer nur so handeln zu lassen, wie man das als Außenstehender mit seiner persönlichen Moralvorstellung vermuten würde.
MYP Magazine:
War diese Mordszene der einzige Entfremdungsmoment, den Du erlebt hast?
Jonas Nay:
Ich würde es anders ausdrücken: Ich hatte mit Martin immer wieder Reibungspunkte, im Großen wie im Kleinen. Ich weiß noch, dass ich mit Samira Radsi, der Regisseurin der drei letzten Episoden von Staffel 1, sehr lange diskutiert habe, ob Martin wirklich vor dem Haus des Bundeswehrgenerals dessen Tochter küssen soll – übrigens sein erster Seitensprung. Für mich persönlich war das ein Riesenthema. Aber Samira sagte einfach nur: „Jonas, solche Dinge passieren einfach. Hör mal auf zu diskutieren.“

»So ganz loswerden werde ich meinen Martin nie.«
MYP Magazine:
Sind solche Entfremdungsmomente wie der Mord in Rumänien wichtig, um eine Rolle irgendwann wieder loszuwerden?
Jonas Nay:
Ich glaube, so ganz loswerden werde ich meinen Martin nie. Ich würde eher sagen, dass solche Momente der Entfremdung eher hinderlich sind, um an der Rolle dranzubleiben. Martin erschießt den Securitate-Agenten im zweiten Drittel der neuen Staffel. Das bedeutet, dass ich von da an noch einen ganz schön weiten Weg mit ihm gehen werde. Von daher verstehe ich den Mord eher als eine Sollbruchstelle, an der ich mich beim Dreh gefragt habe: Wenn mein Charakter so einen Knacks bekommt und ich eine so deutliche Entfremdung spüre, wie kann es mir gelingen, daran wieder anzudocken und die Figur für mich weiterzuführen? Wie kann ich erzählen, dass sich die Figur in dem Moment von sich selbst entfremdet und es für sie dennoch einen Weg geben kann, wieder zu sich selbst zu finden?

»Jonas, Du kennst Martin viel besser als ich – erzähl mir von ihm!«
MYP Magazine:
Immerhin hat Martin das große Glück, dass ihm seine Freundin, die Grundschullehrerin, am Ende vergibt.
Jonas Nay (lächelt):
Tja. Auch darüber gab es viele Diskussionen. Aber das ist auch das Schöne an der Serie. Wir sind da als Schauspielerinnen und Schauspieler sehr involviert in die Art und Weise, wie sich die Charaktere entwickeln und wie die Szenen gestaltet werden. Anna und Jörg Winger, die die Serie geschrieben und produziert haben, legen sehr viel Wert darauf, dass wir unseren persönlichen Input einbringen. Bereits lange bevor die Drehbücher geschrieben werden, sind wir im engen Austausch mit den beiden und sitzen immer wieder zusammen, um die Dinge durchzuarbeiten. Es macht die Serie wirklich besonders, dass es keine so absolutistische Haltung gibt und sich vieles eher – im positiven Sinne – nach Projektarbeit anfühlt.
MYP Magazine:
Das klingt sehr demokratisch.
Jonas Nay:
Nein, am Ende liegt die finale Entscheidung natürlich immer noch bei Anna und Jörg – und am Set hat für mich als Schauspieler die Regie das letzte Wort. Aber dass sich die beiden überhaupt so öffnen und diesen Input von uns einfordern, ist bemerkenswert. Schon während der ersten Staffel hat Anna immer zu mir gesagt: „Jonas, Du kennst Martin viel besser als ich – erzähl mir von ihm!“
Ich schreibe gerade zusammen mit Nikola Kastner an einer Serie und kann aus eigener Erfahrung sagen, wie schwer es ist, sich Kritik von außen zu öffnen, wenn man seinen eigenen Stoff entwickelt. Man hat sich bei allem ja irgendwas gedacht. Von daher sind Anna und Jörg zwei absolute Positivbeispiele für mich, weil sie mit dem eigenen geschriebenen Plot sehr flexibel sind. Das ist eine Qualität, die ich als Schauspieler sehr genießen durfte. Und es hat dazu geführt, dass – selbst wenn es so einen Entfremdungsmoment wie den Mord gab – ich nie meinen Charakter verloren oder zu ihm zu viel Distanz aufgebaut habe.

»Die Macher der Serie wollten nicht nur den deutsch-deutschen Mikrokosmos als Spielfeld des Ost-West-Konflikts erzählen.«
MYP Magazine:
Während Staffel 1 in Ost- und Westdeutschland spielt und sich auf Ereignisse und Thematiken bezieht, die man als Otto Normalzuschauer geschichtlich noch halbwegs präsent hat, erzählt die zweite Staffel einen Stellvertreterkrieg zwischen Ost und West am anderen Ende der Welt – ein Stoff, der vielen Deutschen wahrscheinlich eher unbekannt ist…
Jonas Nay:
Ja, tatsächlich sind das Konfliktszenarien, über die man in unserem Dunstkreis wohl eher seltener gestolpert ist. Aber soweit ich weiß, war genau das auch eine bewusste Entscheidung von den Machern der Serie. Ihre Idee war, die zweite Staffel zu nutzen, um das Big Picture des Kalten Krieges zu erzählen – und nicht nur den deutsch-deutschen Mikrokosmos als Spielfeld des Ost-West-Konflikts.
MYP Magazine:
Dafür geht es in Staffel 3 zurück nach Deutschland – und nach Rumänien…
Jonas Nay:
Ich persönlich finde es sehr spannend, dass Martin 1989 wieder hauptsächlich in Deutschland agiert – und zwar deshalb, weil diese dritte Staffel inhaltlich nicht auf den Fall der Mauer zusteuert, wie man vielleicht vermutet hätte. Ganz im Gegenteil: Sie startet mit diesem Ereignis und zieht ihren Plot aus dem Umstand, dass sich alle Charaktere ab dem Moment des Mauerfalls in einem Vakuum befinden. Alle versuchen, in irgendeiner Form ihre eigene Haut zu retten, ihren Platz zu suchen und sich in irgendeiner Form neu zu erfinden.

»Ich kenne die Achtziger, in denen ich gar nicht gelebt habe, besser als die Neunziger, das Jahrzehnt meiner Kindheit.«
MYP Magazine:
Würdest Du sagen, dass Du heute einen anderen Blick auf die deutsch-deutsche Geschichte hast als vor Beginn der Dreharbeiten im Jahr 2014?
Jonas Nay:
Auf jeden Fall! In der Serie ploppen ja immer wieder reale Daten und Ereignisse auf, an denen sich der fiktionale Strang entlanghangelt. Daran habe ich mich enorm festgebissen. Beim Lesen der Drehbücher ist es mir ständig passiert, dass ich an einem bestimmten Sachverhalt hängen geblieben bin und gedacht habe: Moment mal, war das wirklich so? Was steckt da denn dahinter? Ich konnte in dem Moment nicht weiterlesen und musste erst mal anfangen zu recherchieren. Dadurch habe ich sehr viel gelernt, was ich ohne die Serie vielleicht nie erfahren hätte. Ich würde zwar nicht behaupten, dass ich dadurch zum wandelnden Lexikon geworden bin, aber ich habe mich wirklich sehr intensiv mit den 1980er Jahren in Ost- und Westdeutschland auseinandergesetzt – und das auf verschiedensten Ebenen: von Politik bis Popkultur, von Terrorismus bis Friedensbewegung, von Maueröffnung bis Wiedervereinigung. Ich würde sogar behaupten, dass ich die Achtziger, in denen ich gar nicht gelebt habe, besser kenne als die Neunziger, das Jahrzehnt meiner Kindheit.
MYP Magazine:
Hättest Du den Fall der Mauer gerne persönlich miterlebt?
Jonas Nay:
Na, selbstverständlich! Die Tatsache, dass es einer friedlichen Bürgerbewegung gelungen ist, ein autoritäres Regime zu stürzen und die Öffnung einer Mauer zu erzwingen, ist so einzigartig und beispiellos in der Geschichte der Menschheit, dass ich diesen Moment natürlich gerne miterlebt hätte.

»Wer in unserer Serie einen pädagogischen Ansatz sucht, muss sich mit anderen Formaten befassen.«
MYP Magazine:
Die Serie erzählt immer wieder Themen, deren Tragik und Dimension man heute kaum mehr Beachtung schenkt. So wird zum Beispiel der AIDS-Krise und den damit verbundenen Schicksalen ein großer erzählerischer Raum gegeben. Oder es wird gezeigt, dass es in der DDR durchaus üblich war, regimeuntreuen Eltern ihre Kinder zu entziehen und sie zur Adoption freizugeben. Oder es geht darum, wie durch das Militärmanöver „Able Archer 83“ aus Versehen ein Atomkrieg hätte entfacht werden können. Welche Verantwortung hat die Serie gegenüber ihren Zuschauern? Oder anders gefragt: Siehst Du in ihr einen pädagogischen Auftrag?
Jonas Nay:
Mit Pädagogik tue ich mich an dieser Stelle eher schwer, da die Serie in erster Linie einen unterhaltenden Anspruch hat. Sie arbeitet mit popkulturellen Elementen, ist sehr schnell erzählt und besitzt eine ganz eigene Form von Ironie. Der Humor, den sie in sich trägt, ist eher schwarz und wirkt stellenweise fast kafaesk, wie ich finde. Das alles strebt einem pädagogischen Ansatz entgegen. Wer den sucht, muss sich mit anderen Formaten befassen, etwa von den Öffentlich-Rechtlichen.
Nichtsdestotrotz ist unsere Erzählweise kein Hindernis dafür, dass die Serie dazu anstoßen kann, sich generell mit der Politik und gesellschaftlichen Themen von damals zu beschäftigen. Klar, ich selbst, der die Rolle darzustellen hat, bin wahrscheinlich viel interessierter als jemand, der die Serie nur schaut, um sich unterhalten zu lassen. Aber wenn ich meinen eigenen Medienkonsum als Beispiel nehme, finde ich schon, dass Filme und Serien, die sich mit realen Ereignissen, Personen oder Zeiten beschäftigen, immer den Effekt haben können, dass man sich mit der Thematik noch weitergehend auseinandersetzt. Oder dass man vielleicht sogar einen Bezug zum aktuellen Zeitgeschehen herstellt. Wenn unsere Serie alleine das leistet, haben wir viel erreicht.

»Auf dem Weg zur Wiedervereinigung gab es keine gleichberechtigte Verschmelzung.«
MYP Magazine:
Welche Themen von heute könnten das sein?
Jonas Nay:
Etwa der wieder aufflammende Ost-West-Konflikt zwischen den NATO-Staaten und Russland. Oder die Lage in Belarus, wo es seit Wochen Massenproteste gegen ein autoritäres Regime gibt. Oder die strukturellen Unterschiede, die man in Deutschland nach wie vor zwischen Ost und West identifizieren kann. Oder die Tatsache, dass auf dem Weg zur Wiedervereinigung im Wesentlichen der Osten in den Westen eingegliedert wurde und es keine gleichberechtigte Verschmelzung gab.
Wenn man sich alleine bei diesem Thema bewusst macht, was das Ende der DDR für die Menschen und ihre dort funktionierenden Leben bedeutet hat, kann man sehr viel für sich selbst mitnehmen. Ob „Deutschland 89“ es schafft, das wirklich im Detail zu erklären, weiß ich nicht. Aber ich glaube, wenn einen etwas emotional erreicht – und das tut unsere Serie meiner Meinung nach auf jeden Fall –, bleibt am Ende inhaltlich immer etwas hängen.

»Ein Youtuber hat sich mal darüber echauffiert, dass in der Serie eine Tapete zu sehen sei, die nicht in den Achtzigern produziert wurde, sondern in den Siebzigern.«
MYP Magazine:
In der neuen Staffel wird gezeigt, wie die HVA-Mitarbeiter den Mauerfall live im TV miterleben. Als Generalmajor Schweppenstette sieht, wie der Schlagbaum an der Grenze hochgeht, schreit er voller Schrecken: „Oh Gott!“ Das Ganze wirkt fast wie eine Slapstick-Nummer, da der Mauerfall in unserer kollektiven Wahrnehmung als etwas überaus Positives wahrgenommen wird. Sind Dir persönlich mal Zeitzeugen begegnet, die diesen „anderen“ Blick auf den Mauerfall haben?
Jonas Nay:
Nein, noch nie. Zumindest haben sich diese Stimmen mir gegenüber noch nicht zu erkennen gegeben… (schweigt einen kurzen Moment) Ich wurde immer eher für Details kritisiert. Ich werde beispielsweise nie vergessen, wie ich mal einem Youtuber ein Interview geben sollte, der – wie sich herausstellte – aus der ehemaligen DDR stammt. Vor dem Gespräch hat er sich erst mal ausführlich darüber echauffiert, dass in der Serie an einer Stelle eine Tapete zu sehen sei, die scheinbar nicht in den Achtzigern produziert wurde, sondern in den Siebzigern. Seiner Meinung nach es sei es total untypisch gewesen, in jener Zeit im Plattenbau noch so eine Tapete an der Wand zu haben. Das mitzuteilen war ihm ein dringendes Anliegen.

»Martins moralischer Kompass ist etwas, woran ich mich immer wieder gut festhalten kann.«
MYP Magazine:
Am Ende der dritten Staffel wirft Lenora, Martins Tante, ihrem Neffen vor, er wisse einfach nicht, wie die Welt funktioniert. Würdest Du ihr da zustimmen? Immerhin sagt Martin ja kurz nach dem Mauerfall: „Die Ära der Autokraten ist ein für alle Mal vorbei.“ Und wie wir wissen, stimmt das nicht so ganz. In vielen Ländern der Welt haben Autokraten gerade ziemlich Konjunktur.
Jonas Nay:
Das ist leider wahr. Was die Serie betrifft, kann ich die Aussage vor allem aus Lenoras Perspektive verstehen. Martin ist in dieser festgefahrenen Spionage-Welt zwar jemand, der auf beiden Seiten der Mauer eine ziemlich ungefärbte Sicht auf die Dinge entwickelt hat. Aber aus Lenoras Sicht handelt er zu wenig aus einer sozialistischen Ideologie heraus, sondern ist vielmehr von seinem Egoismus und seiner persönlichen Moral getrieben. Und das trifft auch definitiv zu.
Anna und Jörg Winger betonen immer wieder, dass sie den Charakter Martin Rauch als eine Heldenfigur angelegt haben, die auf ihren ganz eigenen moralischen Kompass hört. Auch wenn alle versuchen, ihn in verschiedene Richtungen zu ziehen, verfolgt er stoisch seine eigene Agenda und vertraut auf diesen ihm gegebenen moralischen Kompass – was für ein schönes Wort übrigens.
Dieser Kompass ist etwas, woran ich mich bei Martin immer wieder gut festhalten kann. Selbst wenn es diese Entfremdungsmomente gibt, über die wir eben gesprochen haben, versuche ich, ihn immer wieder auf den rechten Weg zu bringen und ihm seinen moralischen Kompass zurückzugeben – und zwar so, dass man ihm als Zuschauer wieder folgen mag.

»Es erstaunt mich immer wieder, wie oft sich die Menschen in Deutschland alleine im 20. Jahrhundert neu erfinden mussten.«
MYP Magazine:
Lenora ist eine Person, der es um höhere Ideale geht – das jedenfalls sagt sie von sich selbst. Diese Ideale spricht sie dem Westen ab. Würdest Du ihr da ein Stück weit zustimmen? Glaubst Du auch, dass uns in unserer modernen westlichen Welt ein höheres, gemeinsames Ziel fehlt?
Jonas Nay:
Für mich persönlich ist dieses gesellschaftliche Ziel ganz klar formuliert: das Streben nach einer sozialen Demokratie. Natürlich weiß ich, dass noch ein weiter Weg vor uns liegt. Gerade im Moment erleben wir ja zunehmende Entzweiung, Demokratiefeindlichkeit und diverse autokratische Bestrebungen – und das nicht nur bei uns, sondern auch in anderen europäischen Staaten oder in den USA. Für mich ist immer noch das Ziel, an dieser Demokratie zu arbeiten, weil ich glaube, dass dies das beste System ist, um Chancengleichheit unter den Menschen anzustreben. Zwar sind wir noch weit entfernt von einem wirklich sozialen System, in dem niemand durchs Raster fällt. Aber wir sollten es auf jeden Fall immer weiter versuchen. Ein Umsturz der Systeme, wie ihn einige fordern, wäre da ganz sicher nicht der richtige Weg.
MYP Magazine:
Wenn man auf Deine Rollen der letzten fünf Jahre schaut, scheint es, als wärst Du inhaltlich in fast jedes Jahrzehnt der jüngeren deutschen Geschichte eingetaucht. Hast Du das Gefühl, dadurch ein besonderes Gespür für unsere Gesellschaft entwickelt zu haben?
Jonas Nay:
Ich würde schon sagen, dass ich heute wesentlich sensibilisierter für die letzten Jahrzehnte deutscher Geschichte bin, als ich es vorher war. Und wenn ich mich mit Ausschnitten dieser Geschichte befasse, erstaunt es mich immer wieder, wie oft sich die Menschen in Deutschland alleine im 20. Jahrhundert neu erfinden mussten. Ich denke da beispielsweise auch an die Großmutter von Martin, die sagt, sie habe in ihrem Leben vier Systeme erlebt: die Kaiserzeit, die Weimarer Republik, die Nazi-Diktatur und schließlich die DDR. Diese Biografie ist total bezeichnend für unzählige andere Menschen – und da ist das wiedervereinigte Deutschland noch gar nicht mitgerechnet. Es ist doch sehr spannend, wieviel es in dieser jüngeren deutschen Geschichte zu entdecken und lernen gibt. Das ist wirklich einzigartig und ich befasse mich ausgesprochen gerne damit. Vielleicht ist das auch der Grund, warum ich so viele historische Stoffe gedreht habe.

»Vielleicht würde Martin Rauch ja mit Honecker in der chilenischen Botschaft sitzen.«
MYP Magazine:
Wenn man die Geschichte Eurer Serie weiterspinnt, hätte Staffel 4 den Titel „Deutschland 92“. Was könnte darin inhaltlich passieren? Welche Aufgabe könnte Martin Rauch zufallen? Immerhin ist in dem Jahr ja einiges passiert, zum Beispiel: Das Gesetz über die Stasi-Unterlagen trat in Kraft. Auf dem Balkan tobten zwei Kriege. Mit dem Vertrag von Maastricht wurde die EU gegründet. Erich Honecker, der in die chilenische Botschaft in Moskau geflogen war, wurde nach Berlin ausgeflogen und festgenommen. Petra Kelly, Gründungsmitglied der Partei Die Grünen, starb zuhause unter mysteriösen Umständen.
Jonas Nay:
Oha! Da war ja wirklich was los… (überlegt kurz) Vielleicht würde Martin Rauch ja mit Honecker in der chilenischen Botschaft sitzen.
MYP Magazine:
Und für wen würde er arbeiten?
Jonas Nay:
1989 wird Martin mit drei Optionen konfrontiert: Entweder er wechselt die Seiten und wird Spion für einen anderen Geheimdienst, etwa den BND oder die CIA. Oder er wird verhaftet. Oder umgebracht. Auch wenn er in der dritten Staffel nach einer vierten Option sucht, sprich Flucht und eine neue Identität, glaube ich, dass er irgendwann wieder als Geheimdienstler tätig würde. Er hat einfach den inneren Drang, in Aktion zu treten oder an irgendwelchen Stellschrauben zu drehen, wenn er die Möglichkeit dazu hat. Insofern könnte ich mir vorstellen, dass er für die CIA weiterarbeitet. Aber das ist nur so ein Bauchgefühl. Vielleicht sitzt er aber auch irgendwo am Strand und trinkt Daiquiris.

»Die frühen Neunziger waren eine Zeit, in der ein extrem steigender Fremdenhass um sich schlug.«
MYP Magazine:
Mit dem Jahr 1992 hast Du dich in Deiner Karriere schon einmal auseinandergesetzt, und zwar im Film „Wir sind jung, wir sind stark“, der die entsetzlichen Ereignisse von Rostock-Lichtenhagen aufgreift. An einer Stelle in „Deutschland 89“ heißt es: „Das dunkle Deutschland erwacht.“ Hat Dich der Satz an Deine Arbeit an „Wir sind jung, wir sind stark“ erinnert?
Jonas Nay:
Jörg Winger hat mir erzählt, dass es wohl schon bei der Kohl-Rede 1990 in Leipzig zu rechten Hetzjagden am Rande dieser Veranstaltung gekommen sein muss. Diese Thematik sollte ursprünglich auch in der dritten Staffel aufgegriffen werden, wurde dann aber wieder verworfen.
Die frühen Neunziger waren eine Zeit, in der ein extrem steigender Fremdenhass um sich schlug. Das ging damals schon los – und heute haben wir es wieder. Dass sich immer wieder Gruppierungen in unserer Gesellschaft dem Rechtsradikalismus zuwenden, hört scheinbar nie auf. Gerade in unserem Land mit unserer Geschichte ist das sehr beschämend.
»Ich bin voller Sorge um das, was gerade auf der Welt passiert.«
MYP Magazine:
Am Ende der dritten Staffel ertönt der Song „It’s The End Of The world As We Know It”, hinterlegt mit Bildern der Treuhand-Gesellschaft, Schlangen von Arbeitslosen, aber auch von Donald Trump und einer Grafik zur EU-Flüchtlingspolitik. Ist Dein persönlicher Blick in die Zukunft ein zuversichtlicher oder eher ein skeptischer?
Jonas Nay:
Ich versuche immer, optimistisch zu bleiben, auch weil ich mir wirklich wünsche, dass wir noch Jahrzehnte in Frieden leben können – hier in unserer Europäischen Union. Insbesondere dafür ist sie ja 1992 gegründet worden. Es ging bei dieser Gründung darum, ein friedliches Beieinander auf diesem Kontinent zu ermöglichen. Ziel war es nicht, sich abzuschotten oder eine Dritte Welt zu erschaffen, die wir jahrzehntelang ausbeuten. Ich hoffe, dass wir uns alle auf die Grundwerte der Europäischen Union zurückbesinnen können, weil es so eine große Errungenschaft ist, in Europa friedlich miteinander zu leben, mit offenen Grenzen, in Freiheit und geschützt von Menschenrechten. Ich hoffe sehr, dass bald wieder mehr europäische Flaggen geschwungen werden und die Menschen öfter den Mund aufmachen, um das alles nicht zu gefährden.
Nichtsdestotrotz bin ich auch voller Sorge um das, was gerade auf der Welt passiert. Gerade habe ich ein flaues Gefühl im Magen, wenn ich etwa auf den 3. November schaue, der Tag, an dem der US-Präsident gewählt wird – hoffentlich ein election day und kein re-election day. Dieser Tag wird wohl den Grundpfeiler für die weltweite Diplomatie der nächsten Jahre setzen. Aber ganz egal, wie es ausgeht: Ich wünsche mir, dass die Staaten der EU näher zusammenrücken und Menschen nicht mehr zu Tausenden auf Inseln horten, sondern versuchen, die wirklichen Fluchtursachen zu bekämpfen. Das wäre dringend notwendig, damit wir alle irgendwann wieder in den Spiegel schauen können.
#jonasnay #deutschland89 #gemeinschaft #jonasmeyer #maximiliankoenig #mypmagazine
Mehr von und über Jonas Nay:
Interview & Text: Jonas Meyer
Fotografie: Maximilian König
Narges Rashidi
Interview — Narges Rashidi
Von der Vermenschlichung des Bösen
In der opulenten Sky-Produktion »Gangs of London« ist Schauspielerin Narges Rashidi gerade in der Rolle der Untergrundkämpferin Lale zu sehen. Das Besondere an der Serie: Sie sieht nicht nur aus wie eine Bond-Produktion, sondern bildet auch die Realität einer modernen, diversen Gesellschaft ab – mit all ihren Errungenschaften und Problemen. Ein Gespräch über Familienbande, Brutalität und die Frauenquote in der Unterwelt.
1. Oktober 2020 — MYP N° 30 »Gemeinschaft« — Interview & Text: Jonas Meyer, Fotos: Steven Lüdtke

Als Francis Ford Coppola am 15. März 1972 seinen Film „Der Pate“ auf die US-amerikanischen Leinwände brachte, rannten die Menschen regelrecht die Kinos ein. Die Verfilmung des gleichnamigen Mafia-Romans von Mario Puzo spielte allein am ersten Wochenende über 300.000 Dollar ein, wurde für insgesamt elf Oscars nominiert und ergatterte am Ende drei davon. Und mit einem Gesamterlös von 245 Millionen Dollar weltweit rettete er – ganz nebenbei – die Firma Paramount vor dem Ruin.
Dass am Sujet der kriminellen Familienbande etwas dran sein muss, was das Publikum regelrecht in seinen Bann zieht, zeigt nicht nur der Erfolg von „Der Pate“ und seinen beiden Fortsetzungen. Über die folgenden Jahrzehnte entstanden immer neue Filme und Serien, die in der düsteren Welt der organisierten Kriminalität spielen. Addiert man zu dem Plot einen mächtigen Familienclan, der aus der Unterwelt heraus die Gesellschaft und ihre Regeln unterwandert, ist das fast so etwas wie ein Erfolgsgarant. Denn wie hieß es schon bei Goethe: „Zu Zeiten der Not bedarf man seiner Verwandten.“
Mafia-Stoffe sind heute ein fester Teil der Popkultur. Und so wundert es nicht, dass auch die großen Streaming-Plattformen auf den Geschmack gekommen sind. Ob „The Irishmen“, „Peaky Blinders“ oder „4 Blocks“, der unersättliche Hunger des Online-Publikums verlangt nach immer neuen Storys, die an immer neuen Orten und zu immer neuen Epochen spielen.
Eines der jüngsten Mitglieder dieses illustren Ensembles ist „Gangs of London“. Die Serie des Streaming-Anbieters Sky, die am 23. April in Großbritannien startete, ist seit wenigen Wochen auch in Deutschland verfügbar. Gedreht wurde sagenhafte 175 Tage lang an fast 100 verschiedenen Drehorten in Großbritannien. Qualitativ hat sich dieser Aufwand definitiv ausgezahlt, die neun Episoden der ersten Staffel fühlen sich an wie eine Bond-Produktion.
Doch das Besondere an der Serie ist nicht unbedingt ihre visuelle Opulenz. Das können andere auch, wenn sie nur genügend Geld ausgeben. Es ist vielmehr das, was auch das Lexikon des internationalen Films über Coppolas „Der Pate“ schreibt: „Ein gewaltiger Gangsterfilm, der zeitgenössische Probleme […] transparent macht und in reißerischer Verpackung als perfekte Unterhaltung anbietet. Der überlange Film ist nicht ohne detaillierte Grausamkeit, wird aber vornehmlich sehenswert wegen des brillanten Spiels der Hauptdarsteller und interessiert auch als Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Verhältnissen.“
Mittendrin in dieser opulenten Gangsterserie ist die 40-jährige Schauspielerin Narges Rashidi. Sie verkörpert die kurdische Untergrundkämpferin Lale, die aus London heraus versucht, durch kriminelle Geschäfte ihre PKK-Leute in der Heimat zu unterstützen. Dieses Engagement geht so weit, dass sie irgendwann gezwungen ist, das Wohl ihrer Familie gegen das ihrer Heimat abzuwägen.


Dabei würde bereits Narges‘ eigene Vita genug Stoff liefern, um ein spannendes Drama zu erzählen. Geboren wurde sie 1980 in der westiranischen Stadt Chorramabad. In jenem Jahr brach auch der Iran-Irak-Krieg aus, auch Erster Golfkrieg genannt, der insgesamt acht Jahre andauern sollte.
1987 floh Narges mit ihrer Familie über die Türkei nach Deutschland, wo sie in dem beschaulichen Städtchen Bad Hersfeld landete. Nach dem Abitur zog sie nach Berlin, wo sie eine Schauspiel-Ausbildung absolvierte und erste Rollen in Independent-Filmen ergatterte. Ihren Durchbruch erreichte sie mit dem Hollywood-Blockbuster Aeon Flux, der 2006 in die deutschen Kinos kam.
2015 spielte sie die Hauptrolle im Horrorfilm „Under the Shadow“ von Babak Anvari. Das Drama erzählt in bedrückender Weise die Geschichte einer jungen, selbstbewussten Frau und ihrer Familie zum Ende des Ersten Golfkriegs im Iran – eine Rolle, die Narges Rashidi hautnah an ihre eigene Familiengeschichte brachte.
Heute lebt die Schauspielerin mit ihrem Mann in Los Angeles, gerade dreht sie in Deutschland für die siebenteilige Justiz-Drama-Miniserie „Ferdinand von Schirach – Glauben“. Nahe des Weinbergsparks in Berlin-Mitte treffen wir sie zum Interview.

»Nur weil jemand kriminell ist, heißt das nicht, dass er oder sie das Herz nicht an der richtigen Stelle haben kann.«
MYP Magazine:
Neben „Gangs of London“ ist in den letzten Jahren eine ganze Reihe erfolgreicher Filme und Serien erschienen, in denen es um Clan-Kriminalität geht. Was ist Deiner Meinung nach das Faszinierende an dem Thema?
Narges Rashidi:
Ich glaube, das hat sehr viel damit zu tun, was man im Englischen als the humanizing of the villain bezeichnen würde: die dramaturgische Darstellung von Bösewichten als normale Menschen. Für die Zuschauer entsteht ein besonderer Reiz, wenn die Hauptprotagonisten eines Films oder einer Serie nicht als strahlende Helden angelegt sind, sondern eher als antiheroes. Diese Figuren sind uns normalen Menschen viel ähnlicher – zwar nicht in Bezug auf ihre kriminelle Energie oder Kaltblütigkeit, sondern weil sie Schwächen und Abgründe offenbaren, die in jedem von uns schlummern. Und wie jeder gute Mensch dunkle Seiten hat, so hat in der Regel auch jeder schlechte Mensch zumindest ein paar gute. Nur weil jemand kriminell ist, heißt das nicht, dass er oder sie das Herz nicht an der richtigen Stelle haben kann. Im Prinzip ist ein Mafiaboss ja trotzdem auch ein Vater oder Ehemann. Diese Widersprüchlichkeit finde ich total spannend. Und ich glaube, das ist es auch, was die Zuschauer so gut an dem Thema finden.

»Auch in Mafiaclans geht es um Themen, die sich in ganz normalen Familien abspielen.«
MYP Magazine:
Darüber hinaus herrscht in diesen Clan-Familien ein ganz besonderer Zusammenhalt…
Narges Rashidi:
Stimmt, diese Familien unterscheiden sich lustigerweise gar nicht so stark von denen aus Telenovela-Geschichten. Auch in Mafiaclans geht es irgendwann um Themen, die sich genauso in ganz normalen Familien abspielen. Damit kann sich jeder identifizieren ¬– und es trägt zusätzlich zur sogenannten Vermenschlichung des Bösen bei.
Überhaupt steht „Gangs of London“ für eine recht neuartige Form des Erzählens. Noch vor wenigen Jahrzehnten wäre es undenkbar gewesen, dass die Hauptfiguren einer solchen Story nicht die gute Seite repräsentieren, sondern als Antiheld auf der anderen Seite stehen. Und man hätte auch nie den Übergang von Gut zu Böse so diffus gezeichnet, wie wir das tun – da musste alles ganz klassisch in Schwarz und Weiß aufgeteilt sein.


»Die Brutalität, die in der Londoner Unterwelt stattfindet, ist nicht wirklich weit entfernt von dem, was wir in der Fiktion zeigen.«
MYP Magazine:
„Gangs of London“ ist an vielen Stellen überaus brutal. Auch Deine Figur Lale schreckt nicht davor zurück, Gewalt anzuwenden und zu ertragen. Was ist Deiner Meinung nach der Grund, dass in der Serie Gewalt auf so eine ausführliche – und man muss leider sagen kreative – Art und Weise erzählt wird? Welcher inhaltliche Mehrwert wird dadurch geschaffen?
Narges Rashidi:
Bevor ich angefangen habe, die Serie zu drehen, habe ich sehr viel zur Londoner Unterwelt recherchiert. Und ganz ehrlich: Die Brutalität, die dort stattfindet, ist nicht wirklich weit entfernt von dem, was wir in der Fiktion zeigen. Nur dass wir sie dort natürlich in besonderer Weise inszenieren und überdramatisieren. Ich denke da etwa an die Szene, wo Elliot Finch im Pub mit einem Dartpfeil acht Männer ausschaltet. Aus meiner Perspektive versucht „Gangs of London“ zwei Anforderungen gerecht zu werden: Sie stellt einerseits den Bezug zur Realität her und liefert gleichzeitig einen gewissen Spannungs- und Unterhaltungswert. Dabei ist unsere Serie übrigens nie gewaltverherrlichend – diesen Eindruck habe ich an keiner Stelle.
MYP Magazine:
Diese Gewalt findet auch immer wieder in unmittelbarer Nähe von Kindern statt, ohne dass sie dem Ganzen entfliehen können. An einer Stelle werden sie sogar in die Ausübung von Gewalt mit einbezogen…
Narges Rashidi:
Wenn Eltern sich in so einer Welt bewegen und zulassen, dass ihre Kinder ein Teil davon sind, ist es schwer, sie letztendlich davor zu beschützen.


»Irgendwann wird der Krieg Teil des Alltags.«
MYP Magazine:
Erinnern Dich diese Szenen in gewisser Weise an Deinen Film „Under the Shadow“? Auch dort wird auf bedrückende Art und Weise gezeigt, wie Gewalt und Brutalität zur alltäglichen Normalität von Kindern gehören kann.
Narges Rashidi:
Es gibt da einen grundlegenden Unterschied. Die Kinder in „Gangs of London“ wachsen in einer Welt der Kriminalität auf. In „Under the Shadow“ aber erlebt das kleine Mädchen Krieg, und das über einen langen Zeitraum. Wenn Du so willst, war ich dieses kleine Mädchen im Iran in den Achtzigern. Und tatsächlich wird selbst so ein Krieg, wenn er lange genug andauert, irgendwann zur Normalität – auch wenn so etwas natürlich nicht normal ist. Aber irgendwann wird der Krieg Teil des Alltags. In meinem eigenen Leben gab es eine Situation, die ich nie vergessen werde. Ich lag auf dem Schoß meiner Mutter und habe geschlafen, als ich plötzlich von einem lauten Geräusch geweckt wurde. Ich habe sie gefragt, was das gewesen sei. Sie antwortete: „Ach, das war nur eine Bombe. Schlaf weiter.“
»Ich habe mich gefragt, wie ich diese Figur anlegen kann, damit man mir glaubt, dass ich gegen die Jungs gewinne.«
MYP Magazine:
Dein Charakter Lale scheint von allen Gangstern die Abgeklärteste und Härteste zu sein. Gleichzeitig ist sie die einzige, die ihr kriminelles Handeln unter ein höheres Ziel stellt. Während andere von reiner Profit- oder Rachsucht angetrieben werden, versucht sie als kurdische Freiheitskämpferin, im Londoner Exil Geld für ihre Landsleute zu erwirtschaften. Wie blickst Du persönlich auf diese Figur? Wie war es für Dich, ihr beim ersten Lesen des Drehbuchs zu begegnen?
Narges Rashidi:
Ich fühle mich grundsätzlich zu starken Frauenfiguren hingezogen – das ist übrigens auch etwas, was es im Film und in Serien noch nicht allzu lange gibt. Aber bei Lale ist es so, dass sie im Vergleich zu den weiblichen Charakteren, die ich bisher kannte, noch einen draufsetzt. Sie ist wahnsinnig stark und wie alle anderen auch eine Antiheldin. Diese Dreidimensionalität der Rolle hat mich extrem gereizt. Und davon abgesehen ist sie sehr, sehr gut geschrieben.
Für mich bestand die größte Herausforderung in der Frage, wie ich diese Figur anlegen kann, damit man mir glaubt, dass ich gegen die Jungs gewinne? Dass ich physisch und mental so stark bin, dass ich so viele Männer plattmache? Gleichzeitig ging es auch darum herauszufinden, wo die sentimentalen Momente sind, wo sie Mensch ist – vor allem in den Situationen, in denen sie das Leben aufs Spiel setzt. Ich wollte nachempfinden, was es mit dieser Figur macht, wenn sie ihre Schwester und Nichten in Lebensgefahr bringt für das große Ganze. Diese Ambivalenz hat mich wirklich gepackt. Es war toll, das zu spielen.
MYP Magazine:
Du spielst auf die Szene am Flughafen, wo Lale bewusst wird, dass sie gerade ihre Familie für einen Geldtransport nach Kurdistan geopfert hat. In diesem Moment läuft es einem als Zuschauer eiskalt den Rücken herunter, weil dort ihre gesamte Abgeklärtheit offenbar wird.
Narges Rashidi:
Ja, aber sie bricht kurz darauf zusammen. Auch wenn sie eine Entscheidung getroffen und diese in die Tat umgesetzt hat, merkt sie letztendlich, dass es doch etwas mit ihr macht, ihre Familie und ihr persönliches Glück für die große Sache zu opfern. In diesem Moment ist sie nicht abgeklärt, es tut ihr extrem weh.

»Wenn man durch die Straßen Londons läuft, sieht man so viele interessante Menschen verschiedenster Herkunft und Hautfarben. Das spiegelt sich sehr in dieser Serie wider.«
MYP Magazine:
Neben all der Dunkelheit und Brutalität zeigt sich „Gangs of London“ auch von einer sehr progressiven und modernen Seite, und zwar in Bezug auf die Art und Weise, wie dort gesellschaftliche Diversität abgebildet wird: Es gibt viele spannende weibliche Charaktere, von denen man immer wieder überrascht wird, wenn sie nach und nach die Bühne betreten; die Homosexualität eines Gangstersohnes, der schwule Orgien feiert, wird nicht – wie früher noch – als etwas Problematisches erzählt, sondern als etwas völlig Normales; ein Mann mit pakistanischen Wurzeln wird Bürgermeister von London – ganz wie in der Realität…
Narges Rashidi:
Das ist London! Wenn man dort durch die Straßen läuft, sieht man so viele interessante Menschen verschiedenster Herkunft und Hautfarben, die alle möglichen Sprachen sprechen. Und wenn man an Restaurants vorbeigeht, riecht man die unterschiedlichsten und exotischsten Gewürze. Das spiegelt sich sehr in dieser Serie wider.

»Das, was man hier im Fernsehen sieht, spiegelt selten das Stadtbild wider, das einem im Alltag begegnet.«
MYP Magazine:
In den letzten Jahren waren es vor allem britische oder amerikanische Produktionen, die sich in Sachen Diversität geöffnet haben. Wie blickst Du aus dieser Perspektive aktuell auf die deutsche Produktionslandschaft?
Narges Rashidi:
Natürlich ist das in den USA und in Großbritannien immer noch ein Thema. Und auch dort ist lange noch nicht alles so, wie es sein könnte oder sollte. Aber ich habe den Eindruck, dass Deutschland da noch viel weiter zurück ist. Das, was man hier im Fernsehen sieht, spiegelt selten das Stadtbild wider, das einem im Alltag begegnet. Ich habe es vor Kurzem schon in einem Interview gesagt: Ich bin in einer Kleinstadt mit 30.000 Einwohnern aufgewachsen, in der ich seit 20 Jahren nicht mehr wohne. Und selbst damals war unser Stadtbild schon bunter als heute im Fernsehen. Dabei ist das Stadtbild in Bad Hersfeld und überall sonst in Deutschland noch viel diverser. Ich selbst hatte auch vor diesem Beruf nie das Gefühl, anders zu sein. Das kam erst mit der Schauspielerei und den Angeboten in Deutschland. Zwar ändert sich das gerade, aber eben langsam. Sehr langsam.

»Im Laufe der Story kommen etliche starke weibliche Figuren dazu. Dennoch ist die Serie männerdominiert – ein Abbild des wahren Lebens.«
MYP Magazine:
Bei all der Diversität in „Gangs of London“ ist Lale ganz am Anfang der Serie die einzige Frau am großen Tisch der Gangsterbosse. Glaubst Du, dass wir tatsächliche Gleichberechtigung erst erreicht haben, wenn selbst in der Unterwelt ein Frauenanteil von 50 Prozent herrscht?
Narges Rashidi (lacht):
Das weiß ich nicht. Zur Ehrenrettung von „Gangs of London“ muss ich sagen, dass man bei so einer Serie die Figuren nach und nach einführen muss, damit die Zuschauer nicht überfordert sind und sich eine gewisse Dramaturgie aufbaut. So kommen im Laufe der Story etliche starke weibliche Figuren dazu, wie etwa die Mutter oder die Polizistin. Und ganz am Ende tritt die Frau von Gangsterboss Luan immer stärker in Erscheinung und zeigt, dass sie diejenige ist, die die Hosen anhat und ihrem Mann sagt, was er zu tun hat. Dennoch ist die Serie natürlich männerdominiert – auch ein Abbild des wahren Lebens. Daher dürften es für meinen Geschmack gerne noch ein paar Frauen mehr sein (grinst).


»Für Schwarze und Iren war in der feinen Londoner Gesellschaft kein Platz.«
MYP Magazine:
Auf der Beerdigung des Gangsterbosses Finn Wallace erklärt Ed Dumani, selbst ein etablierter und mächtiger Gangster, dass es sein einziges Ziel gewesen ist, dass es in London keine Tür mehr gibt, die nicht für ihn offensteht – für ihn, der sich wie Finn aus einer unterprivilegierten Minderheit in der kriminellen Welt nach oben gearbeitet hat…
Narges Rashidi:
… „no Irish, no Black”. Für Schwarze und Iren war in der feinen Londoner Gesellschaft kein Platz.
MYP Magazine:
Exakt. Und dann erklärt Ed Dumani, wie er seine Aufgabe als mächtiger Unterwelt-Geschäftsmann versteht: „We’re giving opportunities to the disadvantaged“ – auch das entspricht der Auffassung realer Mafia-Organisationen. Glaubst Du, dass solche kriminellen Strukturen verschwinden würden, wenn unsere Gesellschaft eine solidarischere wäre?
Narges Rashidi:
Das ist eine sehr romantische Vorstellung von der Welt. Ich fände es schön, wenn dem so wäre. Aber ob ich daran glaube? Eher nein. Dafür bin ich zu sehr Realistin.

»Unser ganzes System ist fragil, unsere Demokratie, unsere Welt, unsere Gesellschaft.«
MYP Magazine:
Gutes Stichwort. Was „Gangs of London“ letztendlich so realistisch erscheinen lässt, ist, dass die Serie wie die Momentaufnahme einer modernen, urbanen, westlichen Gesellschaft unserer Zeit wirkt – mit all ihren Errungenschaften, aber auch mit all ihren Problemen. Neben der Zweiklassengesellschaft, die Minderheiten ausgrenzt, finden auch Themen wie Gentrifizierung, Verdrängung oder archaische Machtstrukturen statt, etwa wenn der junge Alexander Dumani zu seinem Vater Ed sagt: „Your generation is like a virus.“ Und als wäre das nicht genug, kann man dabei zusehen, wie die Konflikte dieser Welt stellvertretend in der Stadt London ausgetragen werden. Man könnte fast den Eindruck gewinnen, die Fiktion werde von der Realität immer öfter vor sich hergetrieben…
Narges Rashidi:
Das zeigt uns doch, wie fragil unser ganzes System ist, unsere Demokratie, unsere Welt, unsere Gesellschaft. Und dass wir nie aufhören dürfen, daran zu arbeiten. Man muss sich nur immer wieder bewusst machen, was Menschen im Laufe der Jahrzehnte und Jahrhunderte imstande waren, anderen Menschen anzutun.
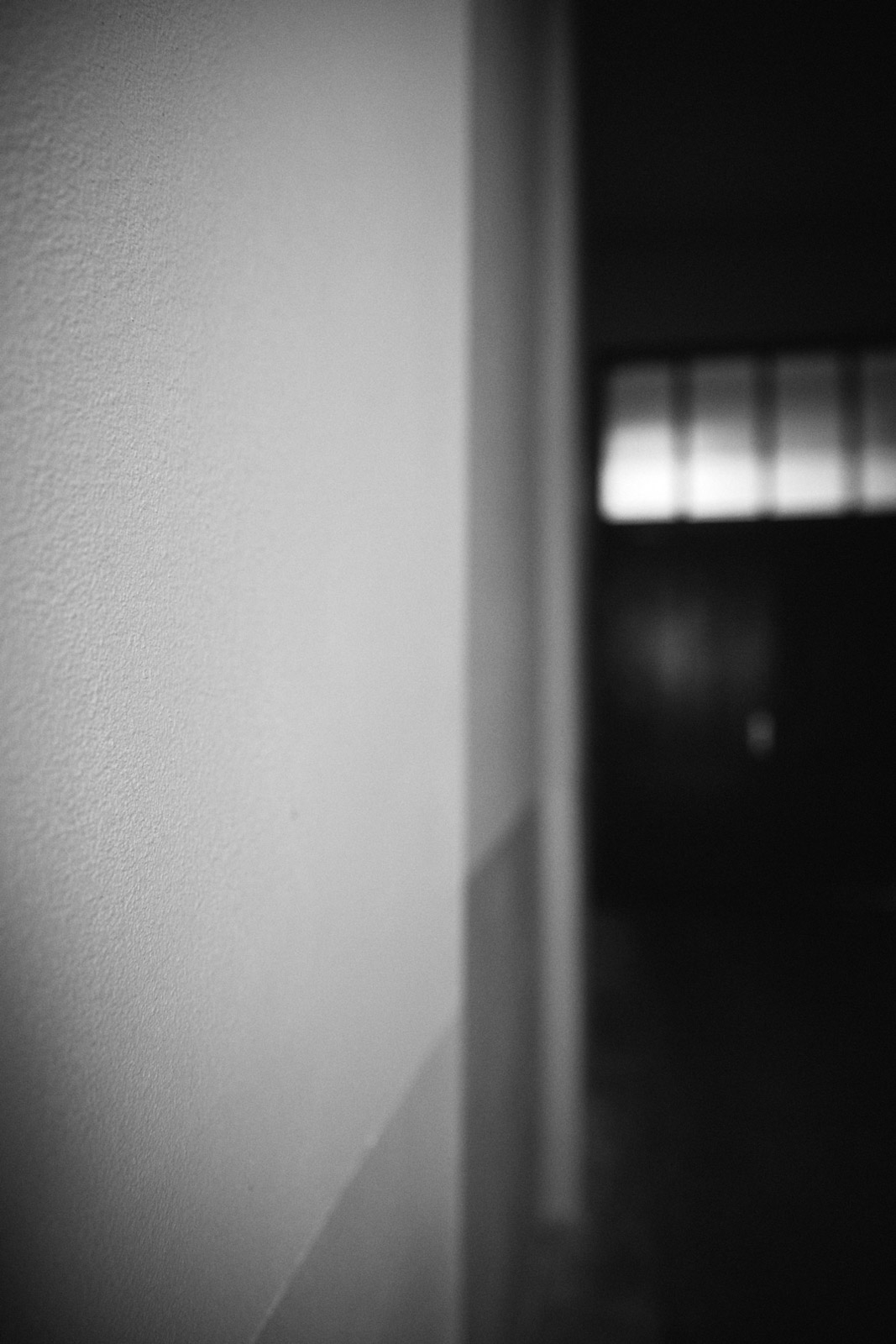

»Wir müssen wirklich aufpassen, was wir alles zulassen. Und wen wir wählen.«
MYP Magazine:
Im Trailer des Films „Aeon Flux“ aus dem Jahr 2005 – der erste Kinofilm, in dem Du mitgespielt hast – spricht die Off-Stimme folgende Worte: „We are in the last city on earth. Some call it the perfect society. But others know better. Government control is total. People disappear as though they never existed.” War hier die Fiktion der Realität voraus, wenn man auf das Weltgeschehen im Jahr 2020 blickt?
Narges Rashidi:
Das, was da geschildert wird, ist nicht exklusiv unserer Zeit vorbehalten. Das hat es immer gegeben und wird es noch weiterhin eine ganze Weile geben – leider. Ich kann dazu nur meine Antwort von eben wiederholen: Unsere Welt und unsere Demokratie sind sehr fragil. Wir müssen wirklich aufpassen, was wir alles zulassen. Und wen wir wählen.
MYP Magazine:
Am 3. November finden in den USA die Präsidentschaftswahlen statt. Wirst Du davor oder danach wieder nach L.A. zurückfliegen?
Narges Rashidi:
Soweit ich weiß, geht mein Flug am 3. November. Das Schlimme ist, dass ich schon 2016 genau an dem Tag im Flugzeug saß, als in den USA der neue Präsident gewählt wurde. Ich erinnere mich noch genau, wie ich im Flieger die erstens Ergebnisse mitbekommen habe. Danach habe ich den Rest des Flugs nur geweint. Ich hoffe nicht, dass es dieses Jahr wieder so kommt.

»Die Herzlichkeit und Wärme der Iraner, die Höflichkeit der Engländer, das Selbstbewusstsein der Amerikaner und die Ehrlichkeit der Deutschen.«
MYP Magazine:
Lass uns von den Dystopien zu den Utopien schwenken. Du gehörst zu den Menschen, die das große Privileg haben, bereits in ganz unterschiedlichen Gesellschaften gelebt und diese erlebt zu haben – vom Iran über die Türkei bis nach Deutschland und die USA. Und durch den Dreh an „Gangs of London“ hast Du auch eine gewisse Zeit in Großbritannien verbracht. Welche Aspekte dieser so verschiedenen Gesellschaften würdest Du wählen, wenn Du dir eine perfekte Community zusammenbauen könntest?
Narges Rashidi (lacht):
Ich würde mir in erster Linie von überall sehr viel Kulinarisches mitnehmen – ich esse unfassbar gerne. Aber Spaß beiseite. Wie würde ich mir eine perfekte Community zusammenbauen? Ich glaube, ich würde die Herzlichkeit und Wärme der Menschen aus dem Iran nehmen, gepaart mit der Höflichkeit der Engländer, dem Selbstbewusstsein der Amerikaner und der Ehrlichkeit der Deutschen.
MYP Magazine:
In einem Interview mit den Kollegen von Ajouré hast Du darüber gesprochen, dass Deine Eltern im Iran mit Euch Kindern immer viel gelacht hätten, um sich nichts von den Schrecken des Krieges anmerken zu lassen – dabei hatten sie selbst wahrscheinlich größte Angst um Euch. Gehst Du heute als erwachsener Mensch ähnlich mit Extremsituationen um?
Narges Rashidi:
Wenn es wirklich hart auf hart kommt, bleibe ich äußerst ruhig – ich glaube, das ist so ein gewisses Ur- oder Gottvertrauen, das ich von meinen Eltern habe.

»Ich war lange sehr damit beschäftigt, eine perfekte Deutsche zu werden.«
MYP Magazine:
Hast Du durch die intensive Vorbereitung auf „Under the Shadow“ erst in vollem Umfang realisiert, wovor deine Eltern Dich und Deine Brüder damals beschützt haben?
Narges Rashidi:
Ich würde sagen, ja. Als ich damals mit meinen Eltern aus dem Iran ausgewandert bin, war ich gerade einmal sieben Jahre alt. In Bad Hersfeld musste ich dann in relativ kurzer Zeit nicht nur eine neue Sprache lernen, sondern auch eine neue Kultur. Ich war lange sehr damit beschäftigt, eine perfekte Deutsche zu werden. Daher hat sich für mich als Jugendliche und junge Frau die Auseinandersetzung mit meiner Vergangenheit erst mal nicht ergeben. Ich war einfach zu sehr mit meinem Deutschwerden beschäftigt. Die iranische Seite von mir konnte ich da nicht wirklich leben. Mit „Under the Shadow“ habe ich mich aber tatsächlich wieder in diese Zeit zurückgesetzt gefühlt und ich musste mich mit den Ereignissen von damals auseinandersetzen. Durch diesen Film habe ich ein Stück weit zurück zu meinen Wurzeln gefunden, das war ein großes Geschenk – das letzten Endes auch einen überaus reinigenden Effekt hatte.


»Als erwachsener Mensch hat man sich hoffentlich soweit gefunden und geht mit den Dingen anders um.«
MYP Magazine:
Ist Dir so etwas später in Deinem Leben noch einmal passiert? Hast Du beispielsweise in den USA versucht, eine perfekte Amerikanerin zu werden?
Narges Rashidi:
Nee, als Kind ist das eine andere Sache, weil man mehr dazugehören will zu einer Gruppe oder Gemeinschaft. Als erwachsener Mensch hat man sich hoffentlich soweit gefunden und geht mit den Dingen anders um. Deshalb versuche ich nicht, die perfekte Amerikanerin zu sein. Ich versuche einfach, ich zu sein. Dennoch ist es natürlich so, dass man geprägt wird von all den Orten, an denen man lebt, und von den Menschen, denen man begegnet. Dazu gibt es den berühmten Satz von Motivationstrainer Jim Rohn: „You are the average of the five people you spend the most time with.“ Wenn man diese Theorie auf mein Leben bezieht, bedeutet das: Wenn man im Iran gelebt hat, in der Türkei, in Bad Hersfeld, in Berlin, in London und in L.A., mit all den Menschen, denen man im Laufe der Zeit dort begegnet ist, wird man am Ende so etwas wie ein Medley aus alledem.

»Heimat ist ein schönes Wort, ein wirklich schönes.«
MYP Magazine:
Kannst Du mit dem deutschen Begriff Heimat etwas anfangen?
Narges Rashidi:
Heimat ist ein schönes Wort, ein wirklich schönes.
MYP Magazine:
Ist Heimat für Dich ein bestimmter Ort?
Narges Rashidi:
Für mich ist Heimat eher ein Gefühl. Und dieses Gefühl begegnet mir immer wieder, wenn ich an die Orte zurückkehre, die besondere Stationen meines Lebens waren. Ich fühle mich beispielsweise hier in Berlin sehr zuhause, weil sich alles noch so vertraut anfühlt. Aber genauso fühle ich mich auch in L.A. zuhause, das merke ich immer, wenn ich wieder dort ankomme. Los Angeles hat für mich einen ganz bestimmten Geruch, es riecht sehr kalifornisch – ich weiß leider nicht, wie ich das anders beschreiben soll. Und ein ähnliches Gefühl habe ich auch immer noch, wenn ich nach Bad Hersfeld fahre.
#nargesrashidi #gangsoflondon #gemeinschaft #jonasmeyer #stevenluedtke #mypmagazine
Mehr von und über Narges Rashidi:
Interview & Text: Jonas Meyer
Fotos: Steven Luedtke
Maske: Karla Meirer
Mit besonderem Dank an Bonaparte Films, die uns während der Fotoproduktion ihre großzügigen Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt haben:
MYP30 – Prolog »Gemeinschaft«
Prolog — MYP Magazine N° 30
Über das, was uns prägt
MYP-Herausgeber Jonas Meyer über die neue, dreißigste Ausgabe unseres Magazins mit ihrem Themenschwerpunkt »Gemeinschaft«.
1. Oktober 2020 — MYP N° 30 »Gemeinschaft« — Text: Jonas Meyer, Fotografie: Maximilian König

»Es geht uns um das Woher und das Wohin. Und vor allem um das Wieso.«
Wenn dieses Land in den nächsten Tagen das 30. Jubiläum seiner Wiedervereinigung feiert, wird es wohl ein gewisses Rauschen geben. Man wird zurückblicken auf die letzten drei Jahrzehnte und die davor. Man wird das Gemeinsame betonen, nicht selten auch das Trennende. Man wird erzählen, was man bereits geschafft hat und noch schaffen will.
Wir wollen den 30. Geburtstag dieses wiedervereinigten Landes zum Anlass nehmen, um uns generell damit auseinanderzusetzen, wie wir geprägt werden durch die Gemeinschaften, in denen wir aufwachsen und leben. Gemeinschaften, die wir bewusst wählen. Oder in die wir ohne Zutun hineingeworfen werden. Mit denen wir uns arrangieren. Oder fremdeln.
Es geht uns gleichermaßen um das ganz Kleine wie das große Ganze, um das Woher und das Wohin. Und vor allem um das Wieso.

»Wir treffen Menschen, die sich gemeinsam in eine Zeitkapsel begeben.«
Natürlich beleuchten wir dabei auch die Deutsche Einheit, etwa in einem ausführlichen Gespräch mit Jonas Nay, dem Hauptdarsteller der Erfolgsserie „Deutschland 89“. Aber wir schauen auch auf die kleinstmögliche Größe einer Gemeinschaft, etwa die der Zwei-Mann-Combo Beranger. Oder verfolgen das Gespräch zweier guter Freunde, die kaum jünger sind als das wiedervereinigte Deutschland und noch ihren Platz in der Gesellschaft suchen, Stichwort „schwarz und schwul“.
Wir treffen Menschen, die sich gemeinsam in eine Zeitkapsel begeben und zurückschießen in die Goldenen Zwanziger, musikalisch wie stilistisch. Wir portraitieren einen jungen Mann, der erst der Enge seines Dorfes entfliehen musste, um zu sich selbst zu finden. Und wir werfen ein Licht auf die Situation queerer Menschen in Polen.

»Die Sky-Serie bildet eins zu eins die Realität einer modernen, diversen Gesellschaft ab.«
Los geht es aber mit einem ausführlichen Interview mit der Schauspielerin Narges Rashidi, die gerade in der opulenten Sky-Produktion »Gangs of London« in der Rolle einer kurdischen Untergrundkämpferin zu sehen ist. Das Besondere an der Serie: Sie bildet die Realität einer modernen, diversen Gesellschaft ab – mit all ihren Errungenschaften und Problemen.

»Weil er im Januar 1982 als 20-Jähriger aus der DDR ausreisen wollte, wurde er von der Stasi verhaftet.«
Ich persönlich denke in diesen Tagen um den 3. Oktober oft an Michael Bradler. Weil er im Januar 1982 als 20-Jähriger aus der DDR ausreisen wollte, wurde er von der Stasi verhaftet. Ein Dreivierteljahr lang saß er anschließend im Gefängnis, davon mehrere Monate in Isolationshaft. Heute führt er als Zeitzeuge durch die ehemalige Haftanstalt des Ministeriums für Staatssicherheit in Berlin-Hohenschönhausen.
An diesem menschenunwürdigen Ort hatte bereits 1946/47 die sowjetische Besatzungsmacht ihr zentrales Untersuchungsgefängnis für Deutschland eingerichtet. Im Keller gab es einen Trakt mit 68 fensterlosen, bunkerartigen Zellen, genannt das „U-Boot”. Diesen Teil des Gebäudekomplexes zeigen die hier abgebildeten Fotos.

Ich bin Michael Bradler zum ersten Mal im Jahr 2008 begegnet, im Rahmen einer privaten Führung. Zehn Jahre später habe ich ihn erneut getroffen und durfte seine Geschichte für unser Magazin aufschreiben. Zwei Erlebnisse, die mich nachhaltig geprägt haben. Und die mich seitdem genauer auf die Gemeinschaften blicken lassen, in denen wir und andere leben.
Ich wünsche viel Spaß bei der Lektüre unserer 30. Ausgabe, die wir in den nächsten drei Monaten sukzessive mit Artikeln rund um das Thema Gemeinschaft befüllen werden!
Jonas Meyer
Herausgeber
#gemeinschaft #community #jonasmeyer #maximiliankoenig #mypmagazine
Text: Jonas Meyer
Fotografie: Maximilian König
Erkan Acar
Portrait — Erkan Acar
Frischer Wind im deutschen Film
Mit der Polizeikomödie »Faking Bullshit« hat Erkan Acar gerade sein neuestes Werk ins Kino gebracht. Der 42-jährige Filmemacher, der schon in Berlin-Neukölln einen eigenen Späti besaß, setzt auf ungewöhnliches Storytelling – und auf neue Gesichter statt auf Klischeebesetzungen und Einheitsbrei. Das wird in der deutschen Filmlandschaft auch langsam Zeit.
18. September 2020 — MYP N° 29 »Vakuum« — Text: Katharina Weiß, Fotos: Steven Lüdtke

Es gibt Filme, die man nicht erklären kann, ohne sie gesehen zu haben. Die abenteuerliche Buddy-Komödie „Ronny & Klaid“ von Erkan Acar gehört zweifelsfrei dazu. Das Besondere an dem Streifen, der 2018 auf dem Filmfest München seine Premiere feierte: Acar erzählt darin seine ganz persönliche Vergangenheit als Neuköllner Spätibesitzer. Außerdem führte er bei dem Projekt nicht nur Regie, sondern fungierte auch als Drehbuchautor und Produzent.
Und in der Tat: Die humoristische Eigenart und das multinational inspirierte Storytelling des 42-jährigen Urberliners bereichern das Baukastensystem des deutschen Kinos um eine erfrischende Alternative. Und so ist es nicht verwunderlich, dass bereits Anfang nächsten Jahres eine Fortsetzung der Geschichte gedreht werden soll.
Aber bleiben wir im Hier und Jetzt. Wir treffen Erkan Acar an seinem Arbeitsplatz, der geschichtsträchtiger nicht sein könnte: Auf dem Gelände der Babelsberger Filmstudios in Potsdam liegen die Büroräume von Mavie Films, Acars Produktionsfirma. Das Unternehmen legt nach eigenen Worten großen Wert darauf, Newcomer*innen einen Ort der kreativen Freiheit zu geben und sie darin zu fördern, ihre eigene Stimme zu finden.

»Selbst mal ein Filmschaffender zu sein war stets ein Traum, der mir unendlich weit entfernt vorkam.«
Damit hat Acar aus einem gefühlten Vakuum heraus, das der Filmbranche in diesem Land anheftet, genau den Raum erschaffen, nach dem er sich als filmbegeisterter Jugendlicher immer gesehnt hat: „Egal ob Deutsches Kino, Bollywood, die asiatischen Martial-Arts-Streifen oder türkische Filme: Ich habe sie alle geliebt,“ erzählt er und fährt fort: „Mit zwölf Jahren habe ich damit angefangen, eigene Kurzfilme aufzunehmen. Aber selbst wirklich mal ein Filmschaffender zu sein war stets ein Traum, der mir unendlich weit entfernt vorkam.“
So machte Acar zuerst eine bodenständige Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann und nahm anschließend eine Stelle bei der in den frühen Nullerjahren ultrahippen Jeansmarke Diesel an. Stammkunde dort war ein Produzent, der ihm eines Tages eine kleine Nebenrolle für den Sat1-Film „Ein Koala-Bär allein zuhaus“ anbot.

»Ich spielte meistens den Quotenkanaken.«
Die Arbeit machte dem jungen Berliner Spaß und er bemühte sich um weitere Möglichkeiten, nebenberuflich ein bisschen Filmluft zu schnuppern. Acar, Jahrgang 1978, begriff schnell, dass für nichtweiße Darsteller vorrangig Nebenrollen aus dem kriminellen Milieu vorbehalten waren. „Es gab nur Schlägertypen oder Drogendealer,“ erinnert er sich. „Ich spielte meistens den Quotenkanaken.“
Als eine Agentin auf ihn aufmerksam wurde, stellte sie ihm die Frage, die seinen Werdegang für immer verändern sollte: „In welchem Film, der jemals in Deutschland gedreht wurde, hättest du gerne die Hauptrolle gespielt?“ Ab dem Moment befasste Acar sich intellektuell mit dem Deutschen Film, durchforstete die Archive und kam mit einer Antwort zu seiner Agentin zurück: „Es gibt keinen einzigen.“ Sie entgegnete: „Erkan, dann kannst du lange warten, bis jemand dich anruft und dir eine Hauptrolle auf den Leib schneidert.“ Seine Schlussfolgerung: „Na gut, dann schreibe ich ab jetzt meine eigenen Filme.“
Aus der anfänglichen Ohnmacht emanzipierte Acar sich mit autodidaktischem Feingefühl und jeder Menge Energie. Die Anekdote über einen Verleih, der kürzlich eines von Acars Filmprojekten ablehnte, weil die beiden Hauptfiguren Migranten waren, versetzt ihn eher in amüsierte Rage. Solche Momente kann er heute leichter loslassen: Er ist es gewohnt, für mutige Ideen und ebenso mutige Besetzungen zu kämpfen.


»In den USA genügt die Antwort ›Ich bin Filmemacher‹.«
Die Frage, ob er sich eher als Darsteller, Drehbuchautor, Regisseur oder Produzent sieht, schmeckt dem vielseitigen Künstler gar nicht: „Das ist eine Frage, die ich ausschließlich aus dem deutschen Raum kenne. In den USA genügt die Antwort ‚Ich bin Filmemacher‘.“ Es werde dort viel seltener von einem erwartet, dass man sich für eine Berufsbezeichnung entscheiden müsse. Denn wer die Chance ergreife, eigene Filme ins Leben zu rufen, werde aus innerem Antrieb unweigerlich zum Mädchen für alles.
Dennoch wirkt Acar weniger wie ein chaotischer Künstler, der von genialen Geistesblitzen lebt. Er hat eine angenehme, pragmatische Art und macht insgesamt den Eindruck eines verlässlichen Geschäftsmanns. Über seine Arbeitsroutinen sagt er: „Zwei Monate im Jahr ziehe ich mich kreativ zurück und schreibe alles auf. Dann mache ich mir Gedanken darüber, wie man die rohe Idee umsetzten und finanzieren kann. Daraufhin starte ich Gespräche mit Schauspielern, Technikern oder Verleihern. Erst dann gehe ich auf die Jagd nach Geldgebern und Kreativpartnern.“
Im Rücken hat Acar dabei stets seine Filmfamilie. Dazu gehören unter anderem Drehbuchautor Arend Remmers, der Regisseur Adolfo J. Kolmerer, mit dem er bereits seit seiner ersten Co-Produktion, dem kontemporär-flapsigen Baller-Märchen „Schneeflöckchen“, cineastische Abenteuer ausheckt. Ein anderer fester Bestandteil eines jeden Projekts ist Acars Freundin, die Schauspielerin Xenia Assenza, die sich als Darstellerin und Drehbuchautorin einbringt.

»Es herrscht immer noch die Meinung, dass die ersten Türken, die sich in Mitteleuropa niedergelassen haben, die Gastarbeiter der 1960er Jahre waren.«
Ob sich die private Chemie auch auf die Leinwand projizieren lässt, wird ein breiteres Publikum spätestens im Herbst 2020 entscheiden können. Denn dann soll Acars neuste Eigenproduktion, die historische Liebesgeschichte „The Witch and the Ottoman“, in die Kinos kommen. Falls das Projekt ein Erfolg wird, könnte Acar beweisen, dass er nicht nur gegenwärtige Multikulti-Stoffe mit Kumpel-Slang beherrscht, sondern auch das Fassungsvermögen für einen komplexen Kostümfilm besitzt.
„Es herrscht immer noch die Meinung, dass die ersten Türken, die sich in Mitteleuropa niedergelassen haben, die Gastarbeiter der 1960er Jahre waren“, sagt Acar über seine Motivation. „Aber mich haben immer schon die Schicksale der sogenannten Beutetürken interessiert, die von 1356 bis 1858 im Rahmen der Osmanenkriege versklavt, anschließend aber häufig etabliert wurden.“ Eine dieser vergessenen Geschichtsperspektiven auf türkisch-deutsche Biografien mischt Acar in seinem Historienfilm mit einer feministischen Perspektive auf die letzte Welle der Hexenverfolgung im frühen 18. Jahrhundert.


Der Polizeidienststelle droht die Schließung – wegen mangelnder Kriminalität.
Etwas leichtere Kost ist hingegen das aktuelle Kinoprojekt von Acar, die charmante Polizeikomödie „Faking Bullshit“, ein Remake des schwedischen Erfolgs „Kopps“: Acar spielt darin den Polizisten Deniz, dessen Dienstelle in einem verschlafenen Nest in NRW die Schließung droht – wegen mangelnder Kriminalität. Also stachelt Deniz die Kleinstadtkollegen dazu an, die Seiten zu wechseln und wohl oder übel selbst für das nötige Maß an Straftaten zu sorgen.
Trotz einiger zäher Wendungen und einer etwas verwirrenden Auflösung schafft es die Komödie, eine innige Verbindung zum Zuschauer aufzubauen, in der der Spaß und das subtile Hinterfragen von Geschlechterrollen im Vordergrund stehen. Vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion über Polizeigewalt beleuchtet der Film eine menschelnde Perspektive auf die Beamt*innen in Uniform.

»Große Produktionen trauen sich häufig nicht, ohne superprominente Zugpferde auszukommen.«
Besonders schön: Publikumsliebling Bjarne Mädel, der einen gewieften Obdachlosen spielt, wird mit einem Ensemble aus frischeren Gesichtern gepaart. Das war auch einer der Gründe, warum Acar so begeistert von dem Projekt war: „Ich finde es wahnsinnig schade, dass die Risikobereitschaft in Deutschland noch so gering ist. Große Produktionen trauen sich häufig nicht, ohne superprominente Zugpferde auszukommen. Obwohl wir keinen klassischen Starkult haben, wie das zum Beispiel in der Türkei der Fall ist, sieht man in so vielen Filmen die gleichen Gesichter.“


»Die Fokussierung auf große Namen und klassische Themen führt dazu, dass weniger mutige Filme gemacht werden.«
Ohne dass Acar es aussprechen muss, denkt man gleich an Platzhirschen wie Schweiger, Schweighöfer und M’Barek, die zweifelsohne ihre Berechtigung haben, die aber immer noch hell genug strahlen würden, wenn sie ihr Rampenlicht mit anderen teilen würden. „Die Fokussierung auf große Namen und klassische Themen führt dazu, dass weniger mutige Filme gemacht werden. Ich spüre aber, dass sich hier gerade viel verändert. Und ich hoffe, dass mehr Menschen aus Berlin oder München dem deutschen Kino und den Stoffen in ihrer Sprache eine Chance geben. Es gibt bei uns Projekte, die genauso gut aussehen wie ein vergleichbares amerikanisches Produkt. Vielleicht wäre der eine oder andere überrascht, welche spannenden Filme auf dem deutschen Markt auf ein kritisches und neugieriges Publikum warten.“

#erkanacar #katharinaweiss #stevenluedtke #mypmagazine
Mehr von und über Erkan Acar:
fpberlin.de
17durch2.de
@erk.acar
Text: Katharina Weiß
Fotos: Steven Luedtke
HAL
Editorial — HAL
Flesh Love Returns
The Japanese photo artist HAL packs couples of any kind in vacuum bags for his stunning pictures. Through this, he shows that love can be so strong that one would like to merge with the other person.
13. September 2020 — MYP N° 29 »Vacuum« — Photography & text: HAL

Eike & Melanie

Nobuyuki & Chiemi
I want to express love through my work—because everything in the world is based on love. Everyone loves family and lovers. But I think it is important whether it is directed around us. If it is not directed, it will sometimes create disparities or create conflicts. And only love may have the power to bring all things together, even across races and disparities. So, we should spread the sense of love outward and spread the link of love more and more across the various communities.

Taichi & Kazumi

Jon & Evelyne
People who love each other are instinctively attracted to each other, and they hope to become one. To represent this power of love, I have photographed couples vacuum-sealed—a project that I called “Flesh Love Returns.” For that, I shot the couples at their most important places. They decided on the location and I decided on the best angle there. Some couples chose their own room, some choose the workplace where they first met, and some chose a restaurant where they had their very first date. Two people, perfectly packed in their best place.

Kohmey & Keiko
Through the medium of photography, the couple has become my chosen vehicle to express the principle theme of the world: love. This of course requires a search to find subjects who are willing to participate. So, I use to go to Kabukicho in Shinjuku, underground bars in Shibuya and many other places which are full of activity like luscious nighttime beehives. When I see a couple of interest I start to negotiate. I’m sure that many people initially think of my proposal as unusual or even look through me like I am completely invisible, but I always push forward with my challenge to them. The models appear from all walks of life and individually have included musicians, dancers, strippers, laborers, restaurant and bar managers, photographers, businessmen, and women, unsettled and unemployed, et al.

Eddy & Ashbee

Kenta & Aki
As a couple, I have photographed a wide variety of variables which include being young and old, from the same or opposite sex, of different races, having different styles, girls from the north and men from the south, and many others who have been willing to participate. There have been occasions when the situation has become complicated, for example, if a couple has disagreements, begin to argue or even fight! There are also the inevitable no-shows and the couples who split up before I can complete the images. On one assignment I had to visit a prison later to obtain permission for the final print. Happily though, for the most part, I’ve had many joyful moments with many interesting scenes to capture. There was even a couple who married soon after one event, and it all began in a bathtub!

Johnnie & Kafka

Kaede & Attci

Marijntje & Jaap

Ryo & Tomomi

Ruby & Brian

Sho & Eri

Taiki-Shino

Sae & Kazuma
About HAL:
HAL aka Haruhiko Kawaguchi is a Tokyo-based commercial photographer. He chose his artist name not only because it is easier to remember internationally and differs from his commercial work. The name is also an homage to the HAL on-board computer from Stanley Kubrick’s legendary film “2001: Odysee in Space.”
Born in 1971, Kawaguchi originally studied automotive manufacturing technology in order to develop robots in the automotive industry like his father. On a trip at the end of his studies, however, he got to know the communicative power of photography; The shy Japanese learned to make contact with foreign-speaking people through photography. With this experience, he began to work in and for advertising agencies after completing his studies.
For his series “Flesh Love Returns” the couples were allowed to choose the places where they were photographed. That was often their own homes but also places where they met for the very first time. The series has been created from 2014 in Japan, Hong Kong, the Netherlands, and Belgium.
#HAL #fleshlovereturns #vacuum #mypmagazine
More from and about HAL:
photographerhal.com
instagram.com/photographerhal
facebook.com/photographerhal
FLOSS
Interview — FLOSS
Das Gegenteil von grau
Bombastische Bühnenoutfits und mit Synthie-Krokant überzogene Beats: Die Berliner Künstlerin FLOSS haut visuell und akustisch auf die Zwölf. Dass sie sich selbst dabei nicht allzu ernst nimmt, ist pure Absicht – die junge Frau strebt nach einer Art von Pop, die sie persönlich in der deutschen Musikszene schmerzlich vermisst.
31. Juli 2020 — MYP N° 29 »Vakuum« — Interview & Text: Katharina Weiß, Fotos: Nick Strutsi

Wer dem grauen Shirt- und Basecap-Look der deutschen Pop-Landschaft schon lange nichts mehr abgewinnen kann, sollte den Werdegang dieser Newcomerin verfolgen: Sängerin und Designerin FLOSS. Die Künstlerin steht mit ihrer Selfmade-Kunstfigur zwar noch ganz am Anfang, strotzt dafür aber nur so vor Lebenslust und Experimentierfreude.
Nach dem Studium am Hamburger Modeinstitut HAW verschlug es die gebürtige Braunschweigerin zunächst nach Paris und schließlich nach Berlin. Dort bastelt die 28-Jährige gerade an einer Karriere als wandlungsfähige Pop-Prinzessin.
Der Einstieg in die Branche gelang ihr dabei eher zufällig: Aus familiären Gründen setzte sich die junge Frau für das Thema Organspende ein, das im Januar 2020 unter dem Stichwort Widerspruchsregelung im Deutschen Bundestag zur Abstimmung stand. Dafür dachte sie sich kurzerhand einen spritzigen Xmas-Tune aus und engagierte Starmoderator Joko Winterscheidt als ehrenamtlichen Santa Claus.
Vor kurzem legte sie mit dem humoristisch-mystischen Themensong „Floss Like A Boss“ nach. Dieser Track – in dem sie übrigens erklärt, warum sie sich einen Künstlernamen ausgesucht hat, der ins Deutsche übersetzt Zahnseide bedeutet – hat so gar nichts mit der hierzulande üblichen Bescheidenheit zu tun. Der Song und auch das Video dazu kommen so breitbeinig und selbstbewusst daher, wie man es sonst nur von RnB- und Hip-Hop-Acts aus dem angelsächsischen Raum gewohnt ist.
Wir waren beim Videodreh dabei und konnten unter anderem beobachten, wie sich die junge Künstlerin im glitzernden Latex-Body als menschliche Zahnpasta auf einer Riesenbürste räkelt. Oder wie sie eine Zuckerparty mit krassen Mundspülung-Cocktails feiert. Nicht nur Zahnärzte werden daran ihre helle Freude haben.


»Ich bin eher so die Maximalistin.«
Katharina:
Wenn Du so erfolgreich wie Michael Jackson wärst und Dir ein eigenes Heimparadies einrichten könntest: Wie sähe der FLOSS-Palast aus?
FLOSS:
Ein flossy Vergnügungspark? Ja, bitte! Visuell gibt dafür mein aktuelles „Floss Like A Boss“-Video ja die perfekte Farbpalette vor: Pastelltöne und Art déco-Vibes wie in Miami Beach. Ich bin ja eher so die Maximalistin – wer hätte das gedacht. Darum käme dieser Vergnügungspark einem „Willy Wonka trifft David LaChapelle“-Paradies extrem nahe. Popkultur-Überdosis!
In den Universal Studios in Orlando gibt es eine Achterbahn, die „Rock ’n’ Roller Coaster“ heißt. Dort kann man vor dem Start auswählen, welches Lied man während der Fahrt hören möchte. So eine Achterbahn bräuchte mein Anwesen auch. Ich persönlich hatte mich auf dieser Achterbahn übrigens für „Glamorous“ von Fergie entschieden.
Die Krönung wäre ein pinkfarbener und barock-schnörkeliger Süßwasser-Pool mit Wellenfunktion. So einer wird mir ständig auf Pinterest angezeigt. Wie weit darf ich noch träumen? Achso, und natürlich gäbe es im FLOSS-Vergnügungspark überall Zuckerwatte in Form meines Logos.


»Die Sprache des Pop hat viele Dialekte.«
Katharina:
Warum funktioniert Deine Musik so symbiotisch mit deinen Outfits? Was ist Dir überhaupt wichtiger: Fashion oder Sound?
FLOSS:
Ich mag es, Pop ganzheitlich zu denken. Wenn ich eine Idee für einen Song habe, kommen mir oft sofort Assoziationen für das Musikvideo. In „Floss Like A Boss“ zum Beispiel wollte ich unbedingt einen Lollipop-Soundeffekt haben. Warum? Das wird im Video humoristisch veranschaulicht. Die Sprache des Pop hat viele Dialekte.
Zur Frage, ob Fashion oder Sound: Ich kann mich nicht entscheiden, was mir wichtiger ist. Das ist, wie wenn Du mich fragen würdest, ob ich lieber blind oder taub wäre. Vielleicht würde ich auch nicht unbedingt den Begriff Fashion benutzen, sondern eher Visuals. In meinen Konzepten bedingt sich beides irgendwie gegenseitig – und ich brauche auch beides, um zu kommunizieren. Um mich zu kommunizieren.

»Meine Vision ist schillernder Pop mit einer tieferen Botschaft.«
Katharina:
Welche Vision steckt hinter Deinem Style und dem gesamten Kunstprojekt?
FLOSS:
Ich möchte einfach Musik machen, die ich auch selbst gerne hören würde und von der ich hoffe, dass sich viele andere damit identifizieren können. Und ich will zeigen, dass es wunderbar ist, geilen Kitsch und bunte Farben gut zu finden – or whatever your kink is! Wahrscheinlich ist das so, weil ich mich früher wegen meines Geschmacks oft als Outsider gefühlt habe. Aber diese Art von Kunst muss kein guilty pleasure sein!
Im Modedesign habe ich immer Humor und viele Farben benutzt, um dann mit einem Aha-Effekt eine tiefere Bedeutung zu vermitteln. Alles funktionierte mit einer „auf den zweiten Blick“-Ästhetik, so ein bisschen wie bei Bacon, Kirchner oder Matisse. Bei ihnen nimmt man auf den ersten Blick nur die schönen bunten Farben wahr, aber nach etwas längerer Betrachtung stell sich die Erkenntnis ein: „Moment, die sehen im Detail ja gar nicht so happy aus. Und ist das nicht ein pinkfarbener Totenkopf? Was bedeutet das wohl?“ Das ist ein Mechanismus, den ich unterbewusst immer wieder anwende. Um es in einen Satz zu packen: Meine Vision ist schillernder Pop mit einer tieferen Botschaft, oft angelehnt an female empowerment und zwischenmenschlichen Beziehungsshit, den ich versuche, in wohlklingende Worte und Melodien zu fassen.

»Ich war super aufgeregt, habe es aber irgendwie geschafft mich vorzustellen.«
Katharina:
Mit welcher Geschichte erzeugst Du auf jeder Party offenstehende Münder?
FLOSS:
Na, wenn ich die jetzt erzähle, kann ich sie nicht mehr auf Partys zum Besten geben! Aber eine Story verrate ich: Meinen ersten Job nach dem Studium habe ich bekommen, weil ich nach Paris gefahren bin und dort einfach an die Tür des Büros meines Lieblingsdesigners Jean-Charles de Castelbajac geklopft habe. Die Adresse hatte ich vorher gegoogelt. Er selbst war nicht da, dafür aber sein Sohn Louis-Marie und eine Assistentin. Ich war super aufgeregt, habe es aber irgendwie geschafft mich vorzustellen, ihm mein Portfolio zu zeigen und meinen Praktikumswunsch zu äußern. Ein paar Monate später bin ich hingezogen, wurde nach dem Praktikum übernommen und habe insgesamt zwei Jahre für ihn als kreative Assistentin und Designerin gearbeitet.


»Wir schöpfen aus der Wut neuen Mut.«
Katharina:
In welchem Punkt wirst du am häufigsten unterschätzt?
FLOSS:
Wenn ich mich in Situationen nicht hundertprozentig wohlfühle, wirke ich ziemlich verträumt und auch introvertiert. Ich bin nicht die, die am lautesten schreit, um Aufmerksamkeit zu erhalten.
Katharina:
Ende letzten Jahres wurdest Du durch Deinen Song „Earth To Santa (I Am My Own Gift)“ bekannt, mit dem Du dich für Organspende einsetzt. Welchen persönlichen Bezug hast du zu dem Thema?
FLOSS:
Meine Mutter ist seit Anfang 2019 dialysepflichtig und wartet auf eine Spenderniere. In Deutschland beträgt die durchschnittliche Wartezeit aktuell etwa zehn Jahre – im Gegensatz übrigens zu Ländern wie Spanien, in denen die sogenannte Widerspruchsregelung greift und durch eine relativ kurze Wartezeit von ein bis zwei Jahren viele Leben gerettet werden.
Als der Bundestag im Januar gegen die Widerspruchsregelung gestimmt hat, war das ein schwerer Schlag für alle Wartenden. An diesem Tag waren wir mit „Junge Helden e.V.“, einem Verein, der sich für Organspende-Aufklärung einsetzt, und vielen Betroffenen vor Ort im Bundestag. Das war echt enttäuschend und ernüchternd. Aber gleich danach haben wir mit dem Hashtag #WirBleibenDran weitergemacht. Wir schöpfen aus der Wut neuen Mut und wollen weiterhin etwas bewegen. Wer uns unterstützen möchte, kann mir oder den Jungen Helden gerne schreiben.

»Ich habe immer die Hoffnung, jemanden zu erreichen, der mit seiner Meinung auf der Kippe steht.«
Katharina:
Mit „Earth To Santa (I Am My Own Gift)“ hast Du dich in den damaligen öffentlichen Diskurs eingemischt und wurdest dabei unter anderem von Joko Winterscheidt unterstützt. War dieses Engagement eher etwas Singuläres? Oder hast Du weitreichendere politische Ambitionen?
FLOSS:
Ich finde, man muss sogar politisch sein. Man kann gar nicht laut und oft genug herausschreien, wie Scheiße Nazis sind, und seine Stimme für das einsetzen, was einem wichtig ist, damit es auch alle Leute auf den billigsten Plätzen hören. Vielleicht wissen das manche Menschen ja einfach nicht. Oder sie haben noch nie darüber nachgedacht. Ich habe immer die Hoffnung, jemanden zu erreichen, der mit seiner Meinung auf der Kippe steht. Vielleicht wird ihm dadurch ein guter Gedanke eingepflanzt, aus dem wiederum gute Taten erwachsen können.
Ich persönlich war zwar nie eine große Rebellin, aber ich setze mich immer für Dinge ein, die mir wichtig sind. Ich versuche, mich so gut es geht zu informieren und nicht gleich zu urteilen – sondern zu beobachten und zu verstehen. Ich brauche immer etwas Konkretes, wenn ich mir eine Meinung zu verschiedenen Themen bilden möchte. Dabei hilft mir unter anderem mein Engagement im Team von „Curated by GIRLS“, eine Online-Plattform, die sich für Gleichberechtigung, Diversität und Inklusion starkmacht. Hier werden Künstlerinnen ins Scheinwerferlicht gerückt, die sonst oft übersehen werden.

»Wenn ich für ein paar Tage nach Saarbrücken fahre, ist das immer ein bisschen wie Arbeitsurlaub.«
Katharina:
Wie entsteht Deine Musik? Welche kreativen Köpfe sind daran noch beteiligt?
FLOSS:
Bei mir beginnt es meistens mit einzelnen Textzeilen, die sich dann zu Konzepten entwickeln. Aus einem Satz, der mir lange im Kopf herumschwirrt, entsteht in der Regel eine Geschichte, die entweder von meinen Erlebnissen inspiriert ist oder die ich mir ausdenke – einfach, weil es Spaß macht. Bei meinem Song „WIFI“ zum Beispiel stand zuerst der Satz: „Strong connection but no service“. Bei „Floss like a boss“ war es tatsächlich der Titel, der sich dann mit meiner Liebe zu Bildern von pinkfarbenen Süßigkeiten gepaart hat.
Manchmal tagträume ich auf dem Fahrrad und dann muss ich anhalten, um eine Zeile schnell in meinen Notizen festzuhalten. Vielleicht brauche ich deshalb immer etwas länger, um mein Ziel zu erreichen, wer weiß? Meist habe ich dann auch schon eine Melodie im Kopf und spiele sie meinen Produzenten vor, zu denen zum Beispiel das Duo „Tim & Matteo“ gehören. Wir sind da total auf einer Wellenlänge und können ohne große Egos, die uns im Weg stehen, zusammenarbeiten. Auf diese Weise ergeben sich die besten Sachen. Mit den beiden arbeite ich entweder in Fernbeziehung und nehme in Berlin auf, oder ich fahre für ein paar Tage zu ihnen nach Saarbrücken. Das ist dann immer ein bisschen wie Arbeitsurlaub, wenn man aus Berlin kommt. So etwas tut total gut.
In Berlin wird das FLOSS-Team auch langsam, aber sicher immer größer. Ich habe fantastische Unterstützung gefunden. Oder vielleicht haben wir uns gegenseitig gefunden? Egal, ob es um Hilfe beim Styling, bei Shootings oder um den musikalischen Feinschliff geht: Ich habe das große Glück, mit vielen Künstlern und Medienschaffenden zusammenzuarbeiten, die auch noch meine Freunde sind – und die an meine Visionen glauben.
#floss #katharinaweiss #nickstrusi #vakuum #mypmagazine
Mehr von und über FLOSS:
Interview & Text: Katharina Weiß
Fotografie: Nick Strutsi
Die Orsons
Interview — Die Orsons
Mit Schnaps, Stinkefinger und Schopenhauer
Mit »Tourlife4Life« präsentieren Die Orsons ein Album, das nicht weniger ist als eine Hommage an das gemeinsame Touren als Band, auch wenn das zurzeit etwas schwierig ist. Im Interview verraten die vier Rapper, welche Schnaps-Rituale sie hinter der Bühne zelebrieren, was das Tolle an Eisenbahnvideos ist und warum es nicht nur den Stinkefinger braucht, um sich gegen Rechts zu positionieren, sondern auch gute Argumente – wie etwa die des Philosophen Arthur Schopenhauer.
21. Juli 2020 — MYP N° 29 »Vakuum« — Interview & Text: Jonas Meyer, Fotos: Steven Lüdtke

Mit der Definition von Glück ist es so eine Sache. Mathematisch kann man es versuchen, biochemisch sicher auch. Und philosophisch sowieso. Doch am Ende ist und bleibt es eine ganz persönliche Betrachtung, was man unter Glück versteht. Macht bei knapp 7,8 Milliarden Menschen, die sich auf der Erde tummeln, genauso viele Definitionsversuche.
Doch keine Panik, ein kleines bisschen lässt sich diese Anzahl reduzieren. Denn zumindest bei vier Personen, alle Musiker von Beruf, lässt sich Glück als etwas beschreiben, das entsteht, wenn man zusammen in einem Doppeldeckerbus von Stadt zu Stadt fährt, Konzerte spielt und ab und zu mal einen Kurzen trinkt. Die Rede ist von den Orsons, jener illustren deutschen Hip-Hop-Gruppe, die aus den Rappern Tua, Kaas, Maeckes und Bartek besteht.
Ihr neues Album „Tourlife4Life“ – der Name lässt es schon erahnen – haben Die Orsons dem Leben auf Tour gewidmet, für das die vier Jungs gerne den Begriff Paradies bemühen. Doch damit nicht genug: Entstanden ist die neue Platte ebenfalls on the road, genauer gesagt während der Festival-Tour der Band im Sommer 2019 und wenig später, im Oktober, auf ihrer großen Tour zum Album „Orsons Island“, das im August des letzten Jahres erschien.
Am 17. Juli 2020 nun, keine zwölf Monate später, ist „Tourlife4Life“ gestartet. Und ja, auch dieses Album macht wieder sehr viel Spaß. Wie auf „Orsons Island“ gibt es etliche Hooklines und Melodien, die sich schnell ins Ohr bohren, wie etwa in den Songs „Leb schnell“ oder „Lovelocks“. Insgesamt bewegen sich die 14 Tracks des neuen Albums zwischen energetisch und relaxt, zwischen sorglos und nachdenklich, zwischen cool und noch cooler. Wir prognostizieren mal, dass nicht nur die treuen Orsons-Fans frohlocken werden.
Doch da ist noch was. Auf „Tourlife4Life“ feiern die vier Rapper nicht nur sich selbst und ihre Trips von Stadt zu Stadt im Doppeldecker. Sie skizzieren auch ihren ganz persönlichen Blick auf Deutschland, Europa und die Welt – und das ziemlich unverblümt. Dass sie beispielsweise im Song „Energie“ allen Nazis den Mittelfinger entgegenstrecken, war zu erwarten. Doch dass sie wie im Stück „Oioioiropa“ nicht nur ihr eigenes Privileg als gefeierte Band hinterfragen, sondern auch eine schonungslose Momentaufnahme der aktuellen gesellschaftspolitischen Situation beschreiben, macht einen irgendwie ein bisschen stolz auf diese Orsons.
So lassen sie es sich auch nicht nehmen, in jenem Song den berühmten Philosophen Arthur Schopenhauer zu zitieren, der sich schon im 19. Jahrhundert wie folgt zum Phänomen des Nationalismus geäußert hatte:
„Die wohlfeilste Art des Stolzes hingegen ist der Nationalstolz, denn er verrät in dem damit Behafteten den Mangel an individuellen Eigenschaften, auf die er stolz sein könnte. Wer bedeutende persönliche Vorzüge besitzt, wird vielmehr die Fehler seiner eigenen Nation, da er sie beständig vor Augen hat, am deutlichsten erkennen. Aber jeder erbärmliche Tropf, der nichts in der Welt hat, darauf er stolz sein könnte, ergreift das letzte Mittel, auf die Nation, der er angehört, stolz zu sein. Übrigens überwiegt die Individualität bei weitem die Nationalität, und in einem gegebenen Menschen verdient jene tausend Mal mehr Berücksichtigung als diese. Dem Nationalcharakter wird, da er von der Menge redet, nie viel Gutes ehrlicherweise nachzurühmen sein. Jede Nation spottet über die andere und alle haben recht.“
Wenige Wochen vor der Veröffentlichung ihres neuen Albums treffen wir Tua, Kaas, Maeckes und Bartek im Berliner Volkspark Friedrichshain.

»Wir drücken unseren Dank dafür aus, dass wir uns gegenseitig lieben, achten, ehren und auf Händen tragen.«
Jonas:
Euer neues Album startet mit einem Intro, in dem Ihr beschreibt, wie Ihr vor einem Auftritt einen großen Kreis bildet und allen Leuten dankt, die Euch auf Tour begleiten. Zelebriert Ihr dieses Ritual grundsätzlich vor jeder Show?
Bartek:
Ja, das könnte man so sagen. Auf diese Weise drücken wir unseren Dank aus – dafür, dass wir das alles überhaupt machen dürfen. Und dass wir uns gegenseitig lieben, achten, ehren und auf Händen tragen. (grinst)
Maeckes:
Andere Stimmen behaupten, dieser große Kreis sei nur dafür da, dass wir zusammen noch einen Schnaps trinken können, bevor die Show losgeht…
Tua:
… und einer von uns hält meistens eine richtig dämliche Rede.
Bartek:
Aber auch darin ist ja der Hinweis versteckt, dass wir um unser Privileg wissen und für alles eine große Dankbarkeit zeigen.

»Tua kann technisch aus allem etwas zaubern – sogar, wenn jemand mal in eine Socke aufnimmt.«
Jonas:
„Tourlife4Life“ erzählt nicht nur vom gemeinsamen Unterwegssein als Band, das Album ist auch weitestgehend auf Eurer letzten großen Tour entstanden. Dabei gibt es Menschen wie den berühmten Produzenten Rick Rubin, die behaupten, man könne kein gutes Album machen, wenn man auf Tour ist…
Bartek:
Bezogen auf uns hat das erstaunlicherweise sehr gut geklappt.
Jonas:
Wie hat das in Eurem Tour-Alltag rein praktisch funktioniert?
Bartek:
Wir hatten ja schon immer einiges an Produktionsequipment dabei, wenn wir auf Tour waren. Aber dieses Equipment hatten wir nie permanent genutzt. Klar, an einem Offday hatte man mal einen Beat gebaut oder so, aber das war’s auch. Bei unserer letzten Tour dagegen hatten alle so Bock, Musik zu machen, dass sich jeder eine eigene Workstation aufgebaut und Musik geschrieben hat. Außerdem hatten wir unsere Geheimwaffe Tua dabei, der technisch aus allem irgendwie was zaubern kann – sogar, wenn jemand mal in eine Socke aufnimmt. Am Ende waren wir selbst überrascht, wie gut das alles funktioniert hat.

»Es gibt nichts Besseres, als sich auf YouTube Eisenbahnromantik-Videos anzuschauen.«
Jonas:
Ist es richtig, dass Ihr euch im Tourbus über der Fahrerkabine ein kleines Studio eingerichtet hattet?
Tua:
Ja, das hatten wir tatsächlich. Diese Doppeldeckerbusse haben verschiedene Aufenthaltsbereiche, zum Beispiel gibt es oben sowohl vorne als auch hinten eine Lounge. Die vordere ist mit zwei Sofaecken ausgestattet, auf denen man sehr, sehr schön chillen kann – vor allem, wenn man nachts die Straße an sich vorbeifliegen sieht. Es gibt eigentlich keinen geileren Ort, um sich gedanklich treiben zu lassen und Musik zu machen. Vor allem Kaas hat dort sehr viel Zeit verbracht und geschrieben.
Jonas:
So, wie Du das beschreibst, erinnert das ein wenig an diese Eisenbahnromantik-Videos, die nachts im TV laufen.
Bartek:
Ich liebe diese Clips! Beste Strecke: Frankfurt – Köln. Es gibt wirklich nichts Besseres, als sich auf YouTube solche Videos anzuschauen, um besser einschlafen zu können.

»Wenn ein Typ mit der falschen Energie zur Tür reinkommt, kann das alles zerstören.«
Jonas:
Im Pressetext zu Eurem neuen Album sagt Ihr, dass Ihr „selten zuvor so instinktiv zusammen Musik gemacht“ habt. Was meint Ihr damit?
Bartek:
Die gesamte Produktion ist so harmonisch und reibungslos vonstattengegangen, wie es vorher nie der Fall gewesen war. Ich glaube, das liegt daran, dass wir uns spätestens mit unserem Vorgängeralbum „Orsons Island“ ein anderes Bewusstsein freigespielt haben, bei dem es in erster Linie darum geht, das Beste für den jeweiligen Song herauszuholen. Dadurch gibt es automatisch weniger Reibereien untereinander – während gleichzeitig natürlich jeder genau das ausspielen darf, worin er gut ist.
Tua:
Ich habe das Gefühl, dass wir ganz allgemein auch in dem Prozess besser geworden sind, wie Musik bei uns entsteht. Damit meine ich zum einen den kreativen Prozess, bei dem es darum geht, für einen Song eine Idee zu entwickeln und diese auch zu Ende zu bringen. Zum anderen denke ich da an das Operative, also die konkrete Zusammenarbeit untereinander, etwa wenn es um das gemeinsame Schreiben geht. Auf „Orsons Island“ haben wir das unterwegs Musikmachen für uns entdeckt – als Gegenentwurf zum im Studio sitzen und auf Knopfdruck Ideen ausspucken müssen. Wir haben uns dafür entschieden, Musik zu machen, wann und wo wir darauf Bock haben.
Bartek:
Wie oft wir uns früher auch Songs kaputtgemacht haben!
Maeckes:
Stimmt. Einfach nur durch falsches Timing und ohne jede Absicht, die Ideen eines anderen zu zerschießen… Beim Musikmachen gibt es manchmal Phasen, die so inspiriert sind, dass alles aus einem herausquillt. Dann wiederum erlebt man Phasen, die eher etwas ruhiger und nachdenklicher sind. In diesen Momenten braucht man immer den richtigen Vibe, um weiterzukommen – das ist wie klassisches Rätsellösen. Wenn da ein Typ mit der falschen Energie zur Tür reinkommt, kann das alles zerstören. Zumindest wir haben uns dadurch schon viele, viele Lieder kaputtgemacht. (lacht)
Tua:
Früher haben wir oft unwissentlich darauf gewartet, dass sich alle vier Bandmitglieder gleichzeitig in demselben Vibe befinden. Das kam zwar ab und zu mal vor, aber meistens war es doch so, dass mindestens einer eine andere Stimmung hatte. Das machen wir heutzutage sehr viel besser.

»Wir waren von Anfang an ziemlich dicke – aber auch ziemlich beste Feinde.«
Jonas:
Dieser Vibe, von dem Du sprichst, ist etwas, das man direkt spürt, wenn man Euch zum ersten Mal begegnet – eine eingeschworene Gemeinschaft, die man als Außenstehender erst mal nicht decodieren kann. War dieser spezielle Orsons-Vibe von Stunde Null an existent? Oder ist er über die Jahre erst gewachsen?
Maeckes:
Ganz ehrlich, wir alle waren von Anfang an ziemlich dicke miteinander – allerdings auf eine andere Art und Weise als heute. Ich würde sagen, dass wir uns mittlerweile sehr viel besser checken, einfach weil wir schon seit so vielen Jahren Zeit miteinander verbringen.
Tua:
Stimmt, wir waren von Anfang an ziemlich dicke – aber auch ziemlich beste Feinde…
Bartek:
… eben ein sehr lebendiges Ding. Oder eher vibrant, um es auf Englisch zu sagen. Stets vibrant.


»Am Anfang einer Tour ist man noch etwas nervöser und will dementsprechend nüchterner sein – wie bei einem ersten Date.«
Jonas:
Euer neues Album wird sehr stark gefüttert von den Geschichten, die Ihr zusammen auf Tour erlebt habt. An welche ganz besonderen Momente erinnert Ihr euch?
Maeckes:
Genauso, wie es bei uns das Ritual gibt, vor einem Auftritt einen großen Kreis zu bilden, so pflegen wir auch direkt nach einer Show immer die Tradition, hinter der Bühne einen Schnaps zu trinken. Am Anfang einer Tour ist man noch etwas nervöser und will dementsprechend nüchterner sein – wie bei einem ersten Date. Aber von Gig zu Gig wird man entspannter. Konkret läuft das so ab, dass man sich nach dem Bühnenabgang irgendwen schnappt, der da gerade rumsteht, und mit dieser Person einen Kurzen trinkt. Dummerweise war unser Tourmanager immer der, der direkt hinter der Bühne wartete – das war sein Pech. Wie wir den kaputtgetrunken haben bei den Gigs, weil er mit jedem von uns mit Schnaps anstoßen musste! Wir haben zwei Kurze getrunken und er zehn – dabei hatten wir schon Feierabend und er musste noch funktionieren. Das ist die erste Erinnerung, die mir in den Kopf schießt, wenn ich an die Tour zurückdenke.
Tua:
Ich persönlich habe mittlerweile gar nicht mehr den Eindruck, dass sich dieses Album um eine ganz spezielle Tour dreht. Es erzählt eher ein generelles Tour-Gefühl, wie es sich in den letzten zehn Jahren unserer Bandgeschichte entwickelt hat. Für mich ist dabei übrigens nicht nur die psychische Komponente interessant, die das viele Touren mit sich bringt. Es geht mir auch um die Metapher des Ganzen: tourlife for life – im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist immer wieder spannend zu beobachten, wo sich dabei eine Schnittmenge zum normalen Leben auftut – und wo sie damit radikal bricht.

»In diesem klassenfahrtmäßigen Tour-Gefühl erleben wir auch immer wieder Momente, in denen wir darüber sprechen, was gerade in der Welt passiert.«
Jonas:
Ihr wart zuletzt im Oktober 2019 gemeinsam unterwegs. Das ist gerade einmal neun Monate her, doch gerade in diesen neun Monaten haben wir in Deutschland, Europa und der Welt viele einschneidende Ereignisse und Entwicklungen erlebt. Hat dies in irgendeiner Weise Euren Blick auf die zurückliegende Tour verändert – und in der Konsequenz auf das Album, das dabei entstanden ist?
Tua:
Absolut. Im letzten Jahr haben sich das Musikmachen und das gemeinsam unterwegs sein noch nicht ansatzweise nach etwas Extravagantem angefühlt. Das stellt sich jetzt natürlich völlig anders da – einfach deshalb, weil es nicht mehr möglich ist. Als wir das Album im Frühjahr 2020 fertiggestellt haben, waren wir in der Hochphase des Lockdowns. Nichts ging mehr. Wirklich nichts. Durch diese Ereignisse hat „Tourlife4Life“ nochmal eine ganz andere Bedeutung bekommen. Und das nicht nur wegen Corona, sondern auch wegen des ganzen Rechtsrucks und der sich weiter verschärfenden Flüchtlingskrise.
Wenn man es genau nimmt, haben wir nicht erst auf der Oktober-Tour damit angefangen, an unserem neuen Album zu schreiben, sondern bereits auf der Festival-Tour im Sommer. In dieser Zeit waren die Nachrichten voll von Meldungen, wie quasi jeden Tag Menschen im Mittelmeer ertrunken sind. Aus dieser Situation heraus ist der Song „Oioioiropa“ entstanden. Darin beschreiben wir, wie wir in diesem klassenfahrtmäßigen Gefühl, das wir auf Tour generell haben, auch immer wieder Momente erleben, in denen wir darüber sprechen, was gerade in der Welt passiert – sprich außerhalb der Blase, in der wir tagtäglich unterwegs sind. Dadurch wissen wir auf jeden Fall unsere Privilegien nochmal mehr zu schätzen.

»Wir mussten uns kurzerhand überlegen, wie wir aus der Not eine Tugend machen können.«
Jonas:
Ohne den Corona-Lockdown wäre „Tourlife4Life“ wahrscheinlich etwas früher erschienen. Kann so eine Zwangsverzögerung auch Vorteile mit sich bringen, die man vorher nicht vermutet hätte?
Tua:
Ne, bei uns wird’s nur schlechter. (alle lachen) Aber im Ernst: Corona hat vieles erschwert und wir mussten uns kurzerhand überlegen, wie wir aus der Not eine Tugend machen können. Das betrifft in erster Linie Dinge wie Promotion, Videodrehs oder Fotoshootings – das war ja plötzlich alles nicht mehr möglich. Zu der Zeit, als wir all das gebraucht hätten, war absoluter Stillstand. Dabei hatten wir schon diverse Videoideen und entsprechende Drehs geplant. Aber diese Vorhaben sind von heute auf morgen geplatzt. Aus diesem Grund haben wir unter anderem beschlossen, für das Artwork unseres neuen Albums diese Aufblasästhetik, wie wir sie schon bei „Orsons Island“ verwendet hatten, einfach weiterzuführen.
Maeckes (grinst):
Dadurch hatte ich auf jeden Fall viiiel mehr Arbeit…
Tua:
Jaja. Maeckes ist bei uns normalerweise der, der sich federführend um die visuelle Komponente kümmert. Diesmal hat er wegen Corona nichts machen können – und dementsprechend auch nichts machen müssen.
Bartek:
Trotzdem sind wir immer noch sehr schnell mit unserem Release. Ob Corona oder kein Corona, wir haben noch nie in so kurzer Zeit nach einer vorherigen Albumveröffentlichung wieder eine neue Platte an den Start gebracht. Zwischen „Orsons Island“ und „Tourlife4Life“ liegen noch nicht einmal zwölf Monate.




Jonas:
Apropos Artwork: Das Design Eures neuen Albums wirkt mit seinen knalligen Farben wie eine Kaugummiwerbung und erinnert ein wenig an die Fotografie von David LaChapelle. Haben Euch seine Arbeiten in irgendeiner Form inspiriert?
Maekes:
Wir sind jetzt nicht die größten LaChapelle-Fans. Ich glaube, diesen Bezug stellen eher Leute von außen her.
Tua:
An der Stelle übrigens liebe Grüße an unseren Grafiker Daniel Wenhardt von Chimperator, der diese Kampagne für uns realisiert hat.
Bartek:
Ja, liebe Grüße an Dani. Ein schöner Mann, ein schöner Mann!


»Die Zeile solidarisiert sich mit einer Gruppe von Menschen, die ständig unterwegs ist und überall aufs Neue einen Platz findet – und gleichzeitig auch nicht.«
Jonas:
Zu den ersten Singles, die Ihr aus Eurem neuen Album veröffentlicht habt, gehört der Song „Leb schnell“. Darin singt Tua: „Meine Crew ist jenisch / Irgendwann ist jede Stadt ähnlich“. Bezieht Ihr euch damit inhaltlich auf das Nomadentum, das man mit der Volksgruppe der Jenischen verbindet? Oder geht es in der Zeile auch ein wenig um den Umstand, dass es sich bei Jenischen um Menschen handelt, die von der Mehrheitsbevölkerung schon immer mehr oder weniger ausgeschlossen wurden?
Tua:
Ich habe die Sorge, dass ich mich mit dieser Textzeile ein wenig aus dem Fenster gelehnt habe. Dabei fand ich einfach die Idee des Fahrenden Volks gut – und der Begriff jenisch erschien mir da am sympathischsten. Vielleicht hätte Fahrendes Volk doch besser gepasst, weil das Wort jenisch fast schon eine Etno-Komponente besitzt. Auf jeden Fall ist es null despektierlich gemeint, sondern vielmehr bewundernd und solidarisierend mit einer Gruppe von Menschen, die ständig unterwegs ist und überall aufs Neue einen Platz, ihren Platz, findet – und gleichzeitig auch nicht. Also: ein freundliches Rüberwinken an alle Jenischen! Ich fühle Euch!
»Ich habe eine große Faszination für sogenannte Randgruppen.«
Jonas:
Ich wollte Dich auch gar nicht in die Defensive drängen, ganz im Gegenteil: Ich kann mir vorstellen, dass spätestens nach der Veröffentlichung Eures Albums am 17. Juli viele Leute erstmal googeln werden, was es mit dem Begriff auf sich hat. Und vielleicht setzen sie sich dadurch auch etwas ausführlicher mit einer Gruppe von Menschen auseinander, die mehr oder weniger aus dem gesellschaftlichen Blickfeld geraten ist.
Maeckes:
Absolut! Ich muss gestehen, dass ich selbst bis zu diesem Interview nicht wusste, was der Begriff bedeutet. Ich dachte immer, das sei eine Zeiteinheit.
Bartek:
Oder Leute, die aus Jena kommen.
Tua:
Jenische sind eine nationalitätenunabhängige, „fahrende“ Bevölkerungsgruppe, die man hauptsächlich in Süddeutschland, Österreich und der Schweiz findet. Korrekterweise würde man sie als transnationale europäische Minderheit bezeichnen. Irgendwann bin ich mal über die Geschichte dieser Menschen gestolpert und fand das alles sehr spannend. Ich habe eh eine große Faszination für sogenannte Randgruppen und hatte diese Gedanken lange im Kopf. Der Titel unseres Albums – „Tourlife4Life“ – klingt für mich ein bisschen wie der Slogan für einen solchen Lebenswandel. Deswegen kam ich auf die Zeile.

»Entweder man kommt mit unseren Kindsköpfen klar oder eben nicht. Aber grundsätzlich machen wir an andere erst mal eine Einladung.«
Jonas:
Ihr habt im Laufe der Jahre eine recht spezifische Art und Weise entwickelt, wie Ihr miteinander umgeht. Das merkt man alleine an Eurer Sprache, die für Außenstehende wie ein Code wirkt. Wie schwer ist es, als Neuling in dieser eingeschworenen Gemeinschaft aufgenommen zu werden? Wie offen seid Ihr gegenüber anderen?
Bartek (lacht):
Fast unmöglich! Wir sind erst mal ganz schlimm. Nein, im Ernst: Wir sind eigentlich supernett.
Tua:
Davon abgesehen haben wir in der gesamten Crew die unterschiedlichsten Menschen und Charaktere, da ist von A bis Z alles dabei. Ein wichtiger Punkt ist allerdings immer der Humor – und eine gewisse Offenheit. Ich finde, man merkt als Außenstehender relativ schnell, ob man mit uns auf einer Wellenlänge ist oder nicht. Davon abgesehen gibt es echt schlimmere Gruppen, mit denen man unterwegs sein kann. Und mit Leuten, die nicht gerade Teil des innersten Kreises sind, gehen wir auch nicht so ellenbogig um wie untereinander. Da sind wir eher respektvoll.
Bartek (grinst):
Zu allen anderen sind wir höflich. Nur nicht zu uns.
Maeckes:
Es passiert tatsächlich relativ schnell, dass wir alle Türen aufmachen und sagen: Lasst uns eine gute Zeit zusammen haben – und dabei so normal und unaffektiert sein, wie es nur irgendwie geht.
Tua:
Entweder man vibet mit und kommt mit unseren Kindsköpfen klar oder eben nicht. Aber grundsätzlich machen wir an andere erst mal eine Einladung.
Maeckes (lacht):
Und dann schlagen wir die Tür zu und fahren weiter in die nächste Stadt!

»Wir sehen die Welt als Ganzes und merken, dass außerhalb unserer hedonistischen Bubble die Hölle los ist.«
Jonas:
Ebenfalls im Song „Leb schnell“ singt Kaas folgende Zeilen: „Womit hab‘ ich das verdient? / Leben wie im Paradies“. Ist für Euch das gemeinsame Touren tatsächlich die höchste Form von Glück?
Kaas:
Ja, auch. Es ist ein riesiger Segen, auf diese Art und Weise leben zu dürfen. Und mit Musik so viel Erfolg haben zu dürfen. Das ist alles andere als selbstverständlich. Daher ist der Begriff Paradies in erster Linie als Wertschätzung gemeint.
Tua:
Uns war es auf dem neuen Album wichtig, die Zeilen „Leb schnell, stirb jung / Womit hab‘ ich das verdient / Leben wie im Paradies“ nicht so unreflektiert stehenzulassen. Wir sehen die Welt schon als Ganzes und merken, dass außerhalb unserer hedonistischen Bubble die Hölle los ist. Daher reicht es uns als Band auch nicht mehr, einfach nur abzufeiern, wie gut es uns geht. Wir wissen das alles echt zu schätzen und fragen uns immer wieder, ob wir dieses Leben überhaupt verdient haben. Aus diesem Grund machen wir uns auch so viele Gedanken darum, wie wir etwas zurückgeben können. Oder sehe ich das falsch? (dreht sich zu den anderen)
Maeckes:
Wir tun das seit über zehn Jahren – seit es Die Orsons gibt.

»Schopenhauers Text bricht auf ganz nüchterne Art und Weise herunter, warum Nationalismus Quatsch ist.«
Jonas:
Diese Ambivalenz thematisiert Ihr auch im Song „Oioioiropa“. Dabei ist der Track auch auf eine ganz andere Weise interessant, weil er demonstriert, wie Ihr auf der Platte auf verschiedenen Wegen Position gegen rechts bezieht. Während Ihr beispielsweise im Song „Energie“ allen Nazis wortwörtlich den Mittelfinger entgegenstreckt, bemüht Ihr in „Oioioiropa“ Zitate des Philosophen Arthur Schopenhauer zum Thema Nationalismus – womit Ihr den Mittelfinger intellektuell unterfüttert. Wie seid Ihr auf diese Schopenhauer-Stelle gestoßen?
Tua:
Ich mag Schopenhauer. Und da gibt es im Internet wunderschöne Lesungen. Eines Tages bin ich auf jene Stelle gestoßen, die wir in den Song eingebaut haben. Der Text stammt aus dem Buch „Aphorismen zur Lebensweisheit“ und bricht auf ganz nüchterne Art und Weise herunter, warum Nationalismus Quatsch ist. Ich mochte einfach, wie das sprachlich klingt. Und wir fanden es wesentlich klüger ausgedrückt, als wir selbst das hätten tun können.

»Der Stinkefinger ist zwar wichtig, aber gegen Rechts braucht es eher Argumente – und vor allem die richtigen Taten.«
Jonas:
Ist „Mittelfinger und Schopenhauer“ die einzig wirksame Strategie, um gegen Rechts erfolgreich anzukommen?
Tua:
Was die Kombination aus dem Stinkefinger und den klugen Argumenten angeht, braucht es meines Erachtens eher die Argumente – und vor allem die richtigen Taten. Der Stinkefinger ist zwar ebenfalls wichtig, aber er allein löst das Problem des rechten Gedankenguts nicht. Was dieses Problem letztendlich lösen kann, dafür bin ich selbst nicht weise genug. Aber ich finde es zum Beispiel sehr schön, was Kaas in seinem Part auf simple Art und Weise zur Sprache bringt – im Sinne von: Hey, wir sind auch nicht die, die dieses traurige Phänomen erklären können. Aber zwischenmenschliche Nähe, Empathie, Toleranz und aufeinander zugehen sind für uns auf jeden Fall die richtigen Werkzeuge, auch wenn das jetzt floskelhaft klingt. So leben wir das privat, so leben wir das auf der Bühne, so werden wir das immer von uns geben.
Außerdem wünschen wir uns, dass diese Haltung in Europa wieder mehr zum Standard wird. Zumindest mehr, als es gerade jetzt zu sein scheint. Seit einiger Zeit hat man ja das Gefühl, dass die Angst regiert. Und dass viele Leute lieber die Türe zumachen wollen statt auf. Vielen Menschen erscheint die völlige Abschottung plötzlich wie eine Zuflucht, obwohl sie eigentlich wissen müssten, dass das so nicht funktionieren kann.

»Wir wollten aufzeigen, wie wir uns fühlen: links, tolerant und als Europäer.«
Jonas:
Vielleicht sollten sich diese Menschen mal Euren Song anhören.
Tua:
Wir haben wirklich lange darüber geredet, was man in dem Lied überhaupt sagen kann, sagen soll. Ich meine, wer sind wir, dass wir irgendjemandem sagen können, wie was zu funktionieren hat oder was eventuelle Lösungen sind? Wir selbst können ja auch nicht wirklich etwas erklären. Aus diesem Grund wollten wir lediglich unsere Verwirrung zum Ausdruck bringen und aufzeigen, wie wir uns fühlen: links, tolerant und als Europäer – in der Hoffnung, dass die Geisteshaltung, in der wir Europa als einen offenen Ort verstehen, wieder erstarkt und in die Köpfe zurückkehrt. Momentan gibt es einfach zu viele Stimmen und zu viel Geschrei. Und wenn man nicht aufpasst, droht sich die Geschichte in gewisser Weise zu wiederholen. So etwas wie jetzt gab es in den 1930er Jahren ja schon einmal.

»Am Ende geht es nur darum, die richtige Haltung zu haben.«
Jonas:
Findet Ihr selbst bei anderen Bands und Musikern einen ähnlichen Mehrwert, den Ihr als Die Orsons für Eure Fans schafft?
Tua:
Welchen Mehrwert meinst Du?
Jonas:
Den Mehrwert, dass mir ein Künstler auf der einen Seite mit seiner Musik tatsächlich etwas Sinnhaftes sagt und ich dabei gleichzeitig wahnsinnig viel Spaß und Energie erfahren kann.
Maeckes:
Ich finde, beides kann auch zusammen funktionieren, wenn die Lieder nicht per se politisch sind oder eine klare Agenda haben. In meiner Twitter-Timeline beispielsweise bekomme ich viele kluge Anstöße von Musikerkollegen, die sich öffentlich ganz klar aussprechen und positionieren. Diese Haltung muss jetzt nicht zwanghaft in einem Liedtext stattfinden. Mir reicht es auch schon, wenn jemand etwas Sinnhaftes retweetet, was mich persönlich in irgendeiner Form aufklärt. Am Ende geht es nur darum, die richtige Haltung zu haben. Und die kann man auch auf der Bühne zwischen zwei Tracks kundtun – und danach zehn Lieder lang tanzen.

#dieorsons #tourlife4life #maeckes #tua #bartek #kaas #mypmagazine
Mehr von und über die Orsons:
dieorsons.de
instagram.com/orsonsdie
facebook.com/dieorsons
twitter.com/dieorsons
Interview & Text: Jonas Meyer
Fotos: Steven Luedtke
Alexis Maçon-Dauxerre
Editorial — Alexis Maçon‐Dauxerre
Camargue
In Camargue, a vast and thinly populated natural region in the South of France, photographer Alexis Maçon-Dauxerre wanted to capture the influence of humans on nature. Thereby he got into a big gathering of horse breeders.
29. Juni 2020 — MYP N° 29 »Vacuum« — Photography & Text: Alexis Maçon-Dauxerre

I shot this series just before the confinement, end of February.
I’ve always been fascinated by wilderness, primeval forests, deserts, wastelands. I am interested in places where you can find very few people, that have been abandoned or have always been wild. And I knew that Camargue would be that kind of place.
Furthermore, I heard about an event which took place in the village of Aimargues. Each year, horse breeders gather up and pay tribute to the memory of Fanfonne Guillierme, the first female horse breeder. I went there to meet these people and to take pictures of the ceremonies.
The longer time goes on, the more I try to question myself on the relationship between humankind and its environment. In Camargue, I’ve been trying to highlight the influence of humans on nature. I also wanted to enhance the Camargue’s culture, which is unique and out of time.
Driving and walking alone on the trails of Camargue made me feel peaceful. Time passes slowly and each meeting, each discovery becomes an important moment.






























#alexismacondauxerre #france #camargue #vacuum #mypmagazine
Photography & text: Alexis Maçon-Dauxerre
amd-photo.com
instagram.com/alexis.macon.dauxerre
instagram.com/alexismd.studio
Milk.
Interview — Milk.
A Lack of Fear
In early 2019, Milk., a four-piece pop band from Dublin, Ireland, arrived on the scene with their debut single, »Drama Queen.« A couple more catchy songs later and they now find themselves ready to release their first EP. An interview about the meaning of pop, the importance of having no fear, and the charm of a glass of milk full of drugs.
17. Juni 2020 — MYP N° 29 »Vacuum« — Interview & text: Jonas Meyer, Photography: Gerry Balfe Smyth

Imagine you had fallen in love with someone and you had to describe that person to someone else—but not based on their own individual attributes, but only in comparison with others: hair like friend X, smile like friend Y, humor like friend Z. The more you compare, the closer you get to the result. But in the end, it remains an approximation that cannot really describe the human as they truly are.
This is a problem that young bands face, at least since music journalism began. As soon as new talents enter the stage, the Great Book of Comparisons is opened, and equivalencies are trotted out. Milk., a self-described “four-piece pop band based in Dublin,” also went through that very experience. As soon as they released their debut single “Drama Queen” in early 2019, the first references to major bands placed upon them (at this point we do not mention them by name).
But these comparisons are not necessary at all. The music that Mark McKenna, Conor “Gormy” Gorman, Conor King, and Morgan Wilson have created stands on its own—because it thrives on duality. Their songs sound dreamy but determined, with melodies both light-hearted and sticky, and a language both sloppy and honest. “Opposites attract”—there seems to be something in this saying.
Anyone who hasn’t stumbled across Milk. on one of the numerous music reviews or official Spotify playlists may have found the band by following Gerry Balfe Smyth on Instagram, a Dublin-based photo artist with a talent for portraying people, among them the four members of Milk. Or one may have watched Wayne, a YouTube Originals series in which Mark McKenna—who is also an actor—plays the main character.
Mark has spent the last few months in Los Angeles, but not entirely voluntarily. He was only in the city for short filming, and would have flown back long ago, were it not for a sudden pandemic that put the whole world in lockdown. With no flights going back to Dublin, he was suddenly stuck in LA. But since the four guys are very easygoing, we managed to have a virtual interview across three time zones while Gerry has agreed to contribute some of his photos.
Irish helpfulness at its best. Meanwhile, Mark has made it back to Dublin, last we heard.

»We’ve had to figure out a lot of stuff on our own.«
Jonas:
In early 2019, you guys released your very first song, “Drama Queen,” followed by three other song releases and lots of live gigs. How do you look back on the last 15 months?
Mark:
It’s kind of strange. By the time we released “Drama Queen” we had been a band for a while, but we also had been waiting until we were actually ready to go. We didn’t just want to release that single and then sit around, waiting for the next move. We kind of planned ahead fairly noisily because we really wanted to catch the momentum—a momentum which is luckily still going on right now. From today’s perspective, having four singles in the air and our first EP coming out, it was such a gradual thing and, when the change did come along, it was kind of what we were planning to happen.
Conor K:
I would say there’s been a lot of learning curves in the last 15 months. It’s just the four of us plus Adam Redmond who produces all the songs. There’s no others, no manager, no agents. We’ve had to figure out a lot of stuff on our own which I think will help us in the future. That’s why I’m very glad we did that.

»Let’s be honest, some of these compliments are just numbers.«
Jonas:
What is it exactly that you’ve learned?
Conor K:
For example, when we released “Drama Queen,” Gormy physically uploaded it to CD Baby and then it was on Spotify. All of us were emailing to each other, asking “Do you have to log in for this?” or “How do we do this?” It was really DIY-kind of stuff…
Morgan:
… and a lot of it got easier with each single we put out. I feel we became more and more familiar with the process each time. Like Conor was saying, we all gain from doing it by ourselves.
Jonas:
And suddenly you have to deal with lots of compliments from all sides: excited audiences, benevolent reviews, features on Spotify and other platforms. Is it hard to keep a clear head when you’re surrounded by all these voices elevating and celebrating you?
Conor K:
Let’s be honest, some of these compliments are just numbers, like views on YouTube or streams on Spotify. And these numbers are something that can easily distract you. You never know how they refer to people who are actually into action, who are actually into our music. I would rather have a thousand people who are really into a song than ten thousand people who stream it casually and don’t listen to it again.

»I have to confess that I made the story more dramatic for the song.«
Jonas:
Let’s stay with your first single for a moment. What’s the origin story behind “Drama Queen?” Did you have someone specific in mind when you were writing it? Or is it simply a musical answer to Lesley Gore or The Chiffons from the 1960s?
Mark (smiles):
No, it was basically an answer to my first relationship and referring to my ex-girlfriend’s birthday party. We broke up just before that party, the song is dealing with my experience of how weird it was trying to stay friends while apparently not really being friends at that time. But I have to confess that I made the story more dramatic for the song, there was no screaming or crying at all. It’s still one of the coolest parties I’ve ever been to, and we’ve become real friends later.

»One of the hardest things is to write a good pop song.«
Jonas:
You guys describe yourself as a “four-piece pop band based in Dublin.” What is your personal definition of pop music?
Mark:
For me, pop is a sort of music that anyone on the planet can sit down and hop on—unless you’re some sort of musical snob. It’s music that is the least esoteric it can be to the point that literally anybody can relate to it or just find it nice to listen to, even if they’re not paying attention to what occurs in the song and what it’s saying.
Conor K:
I agree. Years ago, we all went to music college. People there think sometimes that pop is a dirty word and you rather should spend four years being dedicated to learning bebop jazz. But in my opinion, one of the hardest things is to write a good pop song. Besides that, pop music is a cultural thing as well. Earlier today I was looking at the charts—the viral charts. And guess what? It’s all songs around TikTok which is now a totally new thing. It seems that we’re moving into that era of pop music now and that feels very exciting. Even if you don’t like the music, it’s taking on a new sort of medium. It’s extremely interesting to see how we consume songs on that platform, how we consume music—pop music—in general.
Mark:
When you look at the charts, you even stumble across a country song sometimes. I think, today, the genre of pop isn’t an actual genre of music anymore like it was in the 90s, for example. Now it’s more a term for anything that anybody can enjoy and listen to.

»Dublin’s like a small town that you can’t escape, but in a good way.«
Jonas:
Would you say that the fact that you’re located in Dublin, Ireland has a special impact on your sound and the way you make music?
Mark:
I think so. Dublin has a very strong culture among music anyway, and in addition to that, the city itself gives us a very specific feeling to grow up in, meeting all kinds of people very easily. It’s like a small town that you can’t escape but in a good way. I don’t think we have, but sometimes there are people from Ireland who maybe feel obligated to be artistic because of the history of our culture. There are probably a lot of bands in Dublin and around the city who definitely feel an impact on their music in that way.
Conor K:
Even from an outside perspective, if you want to make music in Ireland, you have to be based in Dublin. The city plays such an important role in terms of art, the Dublin scene is quite the Irish scene. I’m not saying I agree with that, but that’s just the way it is. It would be a very big waste of time when you’re actually based in rural Ireland and trying to do things that you can only do in Dublin.
Morgan:
In my opinion, another big factor is that the music scene in Dublin with all of its artists, promoters, or bookers involved is quite a small group of people. I think it really helps that it is so small and personal because it feels very attainable from very early on. And it’s a lot less haunting because you always have the right people around. Playing shows in the right places isn’t going to take very long. Being a young musician in Dublin, it seems that there’s a community developed just for you. That environment has been very helpful to us—and it may not have gone that way in another city.

»We also wonder how it would be as a band to just exist online in the future.«
Jonas:
How do you perceive this Dublin community in the current time, facing a worldwide pandemic crisis?
Conor K:
It’s a very welcoming community, right now it feels that everyone wants everyone else to do well. I spoke to other people who live in London, for example, they said that it’s a very different atmosphere there at the moment.
Mark:
Yeah, but that doesn’t change the fact that the music scene is struggling all around the world in these times. People are looking for other ways and strategies, essentially trying to find out what works online. We also wonder how it would be as a band to just exist online in the future. We don’t know how things are going to be after this crisis, we don’t have any idea if live music is going to be as popular as it was before. So, we definitely are preparing for being an internet band anyway (smiles).

»Having no fear was—straight from the beginning—a big part of Milk.«
Jonas:
You guys have created a very distinctive and individual musical fingerprint, something that you immediately recognize when you listen to it. Was it a conscious decision to form a sound like that? Or was it more a random product of hanging around and making music together?
Mark:
It all started with Gormy and me who made a lot of demos and kind of ran into Adam, our current producer. With him, we created more demos, recreated specific sounds, and so everything just came together when we did “Drama Queen.” We decided that we wanted to have certain guitar and ambient sounds that we kind of stick in the background, that was a style we liked. So, yes, there’s definitely a specific sound, but I do think that in the future we will be open to change and progress it.
Conor K:
Morgan and I came a bit later to the band. It was at a time when a lot of demos had already been bashed out and there were different ideas in place. But with us also being a part of the band now, I could tell that there was still a big willingness to just try things—with a lack of fear. I think a lot of people can fall into a trap in such a situation, but Mark and Gormy were very embracing and open to our ideas. Having no fear was—straight from the beginning—a big part of Milk., I would say.

»Nowadays, if your sound is poppy and you’re performing live, you’re gonna get admired too much.«
Jonas:
I found a couple of reviews that compare your music with The 1975. Are you annoyed by such comparisons? Or is it something you can embrace and appreciate?
Mark (laughs):
I think that’s typical art stuff. Nowadays, if your sound is poppy and you’re performing live, you’re gonna get admired too much…
Conor K (also laughing):
It’s an easy decision to come to an artist, saying “You sound like that.” And with The 1975, it’s an easy comparison because the band is very well-known. But to be honest, I never really had a deep dive into reviews of that kind. I think they just take a lot of inferences from different things—and we do the same.
Conor G:
But isn’t that the way music works in general? As a musician, you’re permanently influenced by so much other stuff that—in the end—gets you to progress your own sound. So do we, so did other bands before us, so will others do in the future.

»You can always turn it into something totally different and simultaneously stay true to yourself.«
Jonas:
Last year Missy titled an article about you with the headline “Meet your new music obsession, Milk.” Do you have a personal music obsession, each one of you?
Mark:
For me, probably it’s Bon Iver. I think he is very progressive and everything he does just sounds fabulous. He is never disappointing. And he is never afraid to put out something that wouldn’t be liked by the masses. It seems to me that he’s very experimental and just making songs, no matter if it hits a certain group or not. If you think about his first album and his much more recent release, it’s a massive change sonically. It’s important to take that on board with your own music, wherever you start. You can always turn it into something totally different and simultaneously stay true to yourself. And no matter if it’s good or bad, in the end you will maybe be the first person who created that.
Morgan:
It’s that kind of distinct sound that Bon Iver has, but also with the obvious kind of emphasis and risk-taking to push the envelope and try something new. He always has a sonic fingerprint embed in his songs, so you directly know that it’s him. But he also has a great freedom to make all kinds of different sounds—and I guess that’s a similar kind of aspiration to what we do. I mean, I would never compare myself to such a huge monolith, but he’s definitely someone we really enjoy listening to. Besides that, we all have really varied tastes and listen to very different music. I think that’s one of the main reasons why our own songs have become so varied and we have so many different avenues we can take. We make what we like listening to. So, the entire process is as fun as it can be. And I’m sure Bon Iver has a similar spirit.


»We’re inspired by artists who are not afraid.«
Jonas:
Conor and Gormy, what about you? Do you have a special musical obsession?
Conor K:
I consider myself a big fan of hip-hop, so it’s kind of funny to echo what Mark and Morgan are talking about. When you take the first records of Childish Gambino and probably Tyler, the Creator, for example, they also sound like they’re from different artists. I think Mark, Morgan, and I are totally on the same page because we’re inspired by artists who are not afraid. That might also be the reason why The Beatles are one of my all-time favorite bands—all of their songs are totally different.
Conor G:
I would say my obsession has shifted from listening to production. It’s all about making something, that’s why I would say I listen to songs or albums in a different way. It’s not only the lyrics and the melody, I’m pretty into what’s lying underneath and what matches the text and the tones to accentuate them. That’s what I connect with and where a lot of my ideas start.


»It’s totally fascinating how a glass of milk is turned into something that dangerous.«
Jonas:
Your band name is inspired by the book and movie Clockwork Orange, especially by its main character Alex who drinks milk with a lot of drugs in it. What exactly attracted you to that very special habit?
Mark:
It’s totally fascinating how a glass of milk—which is generally seen as a symbol of innocence that is so prevalent and common in the everyday life of a child—is turned into something that dangerous. What a dark twist! It’s amazing how much story and character you can put to a simple picture like that, everything that happens in the book and in the movie can be literally drawn back to that milk.
Jonas:
Have you already tried to “enrich” a glass of milk like that?
Mark (laughs):
Never! I don’t think I could do that.
Jonas:
In the event that someone would use your music for a film, what kind of film could it be?
Mark:
I think it could fit in any movie, but definitely in some kind of heartfelt teen coming-of-age film like Nick & Norah’s Infinite Playlist or whatever. It definitely wouldn’t be in Requiem for a Dream kind of stuff.
Conor K (laughs):
No, we would never do that!

»When it comes to acting and music, for me it’s more of what seems more promising in the moment.«
Jonas:
Let’s stick to the movies. Mark, you’re also an actor and, looking at your Instagram profile, kind of a photographer too. Would you say that there is more than one heart beating in your chest? Or are these artistic fields merged inside of you, complementing and supporting each other?
Mark:
Definitely the latter! But first of all, I don’t consider myself a photographer, that’s just a hobby and I feel I offend professional photographers calling myself one (smiles). I think when it comes to acting and music, for me it’s less than taking the one or the other, it’s more of what seems more promising in the moment. That’s what I’ll do, wherever that goes for me in the future. Any exposure from acting is going to help me with the band. And any exposure from the band might help me with my acting. I never really thought that I have to choose between those two worlds, I just go with it day by day and see what happens. And whatever comes along, comes along.

»Without such a big amount of help it may not have gone this well.«
Jonas:
Your band’s entire artwork and visual presentation are strongly connected to the photography of Gerry Balfe Smyth. Why did you choose him? What does his photographic style stand for and mean to you?
Mark:
Gerry does a lot of very red-brick Dublin kind of photography. He has a very unique style, nothing is posed or staged, he just goes out and finds interesting people.
Morgan:
And he has a very big heart. The shoot that he did with us was our first professional shoot ever, his experience and empathy helped us a lot, that can’t be overstated. We went in with very little information and he came to us with lots of ideas for locations and how the whole thing could go. I think without such a big amount of help it may not have gone this well.

»That EP is a labor of love.«
Jonas:
You will be releasing your new EP shortly. What does this event mean to you, especially in times like these?
Conor K:
Releasing that EP is great because it’s a labor of love. It’s a big achievement for us because we’re not a band that goes in every Sunday, jams out and looks what happens…
Mark:
… yeah, it indeed took a very long time to record this EP, that’s why I’m just happy that we’re actually getting to put it out now. I wish we could perform it also on stage right now, but as long as people actually get to hear it in any way, that’s all that we made it for.
Morgan:
And it’s been really cool as well that, for the most part of this process, we haven’t had any support from others like I was saying before. That’s what really helped us as a group. I mean, we were all very good friends in the first place, but being able to create something like this in such a strange time with people who care about each other so much, that’s something very hopeful that has been reflected in the work and that people actually can understand and relate to. It’s just the four of us playing songs together and I’m pretty happy that I’m a part of it. It would be cool if I could do that forever.
»It’s better to focus on what we can control than focusing on what we can’t.«
Jonas:
As I mentioned in my first question, it’s been 15 months since you guys released your first song. If you look another 15 months into the future, what do you see? How are you going to do? What will have happened?
Mark (smiles):
Hopefully we will be fine, have another EP or even an album out—and will be no longer locked in the house.
Conor K:
As much as we’d like to play at many different places and do other stuff, we also want to focus on our music at the minute. I don’t think we’ve done enough to warrant saying, “Oh well, in 15 months I’m not going to be happy unless x, y, z happens.” It’s still important for us to try things out—and I personally just love to continue doing that.
Mark:
Yeah, I think it’s better to focus on what we can control than focusing on what we can’t. Whatever happens, happens.
Conor K:
What an end! (All laugh)
#milkthemusic #vacuum #jonasmeyer #gerrybalfesmyth #mypmagazine
More from and about Milk.:
milkthemusic.com
instagram.com/milkthemusic
facebook.com/milkthemusic
Interview & text: Jonas Meyer
Photography: Gerry Balfe Smyth
Editing: Ben Overton
Harry G
Interview — Harry G
Melancholie mit Sarkasmus
Bayerische Alltagskultur statt Münchner Schickeria: Die Amazon-Serie »Der Beischläfer« versucht, mit jeder Menge Augenzwinkern die Mundartkomödie ins Streaming-Zeitalter zu übersetzen. Ein Interview mit Comedian Markus Stoll alias Harry G, der eine der Hauptrollen spielt.
13. Juni 2020 — MYP N° 29 »Vakuum« — Interview & Text: Katharina Weiß, Fotos: Christian Brecheis

In Bayern kennt ihn jeder, der Rest Deutschlands wird ihn spätestens jetzt kennenlernen: Comedian Markus Stoll alias Harry G gewährt in der Amazon-Prime-Serie „Der Beischläfer“ neue Einblicke in das Seelenleben der Süddeutschen. Als Sympathieträger Charlie Menzinger bringt er als unfreiwilliger Schöffe ordentlich Schwung in ein Gericht an der Isar – und in das Leben einer Berliner Richterin, der stellvertretend für alle Zugezogenen die bajuwarischen Gewohnheiten nähergebracht werden.
„Der Beischläfer“ ist ein Format, das im Stil klassischer Vorabendserien wie „Die Rosenheim Cops“ daherkommt. Das mag für einen Streamingdienst im ersten Moment ungewöhnlich erscheinen. Tatsächlich gelingt es der Serie damit aber, eine ungewöhnliche Brücke zu schlagen: zwischen jener Welt des linearen Fernsehens, das in Deutschland immer noch ein Millionenpublikum erreicht, und der des immer größer werdenden Kosmos digitaler Inhalte.
Wir treffen Markus Stoll, der selbst vor allem über die Sozialen Netzwerke bekannt wurde, an einem der ersten Tage nach dem Lockdown im Münchener „Baader Café“.


»Manchmal tut es ganz gut, wenn man die Chance hat, die Karten neu zu mischen.«
Katharina Weiß:
Durch die Corona-Krise wurden bei vielen Menschen die Karten ganz neu gemischt. Auch Du hast vor Deinem künstlerischen Erfolg eine berufliche Umbruchsphase erlebt: Deinen Job als BWLer hast du hingeschmissen, danach ein erfolgloses Start-Up gegründet. In einem Interview hast Du über diese Zeit gesagt, dass Du „relativ weit unten“ warst. Mit welchen Gefühlen erinnerst Du dich an diese Zeit, in der Du plötzlich kreativ umdenken musstest?
Markus Stoll:
Meine Entscheidung zur Veränderung war eine freie, die Situation war also eine andere als für viele Menschen in der Corona-Krise. Doch zum Punkt Veränderung kann ich sagen: Manchmal tut es ganz gut, wenn man die Chance hat, die Karten neu zu mischen. Ich hoffe, dass einige Menschen durch die Fokussierung auf das Wesentliche zu neuen Zielsetzungen gelangt sind. Wie sagt man so schön: Downsizing in allen Lebenslagen. Und danach, aufbauend auf den neuen Erkenntnissen, mit einer geraden Linie nach vorne durchstarten.


»In meinem vorherigen Job konnte ich mich an Powerpoint-Präsentationen festhalten.«
Katharina Weiß:
Wann hast Du gemerkt, dass Du ein rhetorisches Talent hast?
Markus Stoll:
Ich habe schon in meinem vorherigen Job im Investmentbereich sehr gerne Vorträge gehalten, auch wenn der Inhalt eher trocken war. Damals konnte ich mich aber an Powerpoint-Präsentationen festhalten. Auf der Bühne ist das etwas ganz anderes, da steht man erstens ohne Hilfsmittel – zumindest ich – und ist zweitens viel größeren Menschenmengen regelrecht ausgeliefert. Davor habe ich auch heute noch großen Respekt. Ich habe auch jedes Mal aufs Neue den Anspruch, perfekt abzuliefern. Was mir leichter fällt als früher, weil heute die Themen wesentlich interessanter und witziger sind. (lacht)

»Meine berufliche Planung war mit 30 quasi abgeschlossen.«
Katharina Weiß:
Die Öffentlichkeit wurde durch Deine raffinierten Social-Media-Clips auf Dich aufmerksam. Im Gegensatz zu vielen Digital-Stars, die noch nicht einmal volljährig sind, warst Du bei deinem Durchbruch schon Anfang 30.
Markus Stoll:
Du meinst, ich war in den besten Jahren, oder? Na ja, gerade auf Facebook, wo ich damals die größten Erfolge hatte, ist das ein durchaus akzeptables Alter. Im Gegensatz zu vielen jungen Influencern von heute hatte ich ja vorher schon ein anderes Berufsleben, habe studiert und ein Jahr in Argentinien verbracht. Im Anschluss habe ich als Investment Manager gearbeitet und ein eigenes ein Startup gegründet, das auch mit Social Media zu tun hatte. Ich habe dann meine damals noch private Leidenschaft – lustige Clips drehen – mit meinen beruflichen Kenntnissen verknüpft und schließlich ganz rübergemacht in die digitale Welt. Dabei habe ich aber auch ziemlich schnell die Bühne für mich entdeckt. Damit war meine berufliche Planung quasi mit 30 abgeschlossen – ich habe nicht vor, nochmal was Neues zu machen. Die Erkenntnis: Es ist nie zu spät, aus einem zufriedenstellenden (Berufs)leben ein wunderbares zu machen!

»Um den Charlie gut zu spielen, musste ich den Zuschauer viel näher an mich heranlassen.«
Katharina Weiß:
Gleich in der ersten Folge Deiner neuen Serie „Der Beischläfer“ wird ein ernstes Thema angeschnitten, nämlich Suizid. Wie kam es zu der Idee?
Markus Stoll:
Das müsste man eigentlich die Autoren Murmel Clausen und Mike Viebrock fragen, die das Drehbuch geschrieben haben. Ich hatte nur die Ehre, mich an dieser Stimmung als Schauspieler abzuarbeiten, was eine ganz schöne Herausforderung für mich war, da ich ein Schauspielneuling bin. Wenn ich den Isarpreußen granteln lasse, dann ist das immer humoristisch überzeichnet. Aber um den Charlie gut zu spielen, musste ich den Zuschauer viel näher an mich heranlassen. Ich war zwar schon bei größeren Produktionen dabei, etwa in den Eberhofer-Krimis in kleinen Nebenrollen, aber Hauptdarsteller ist dann schon ein paar Schippen draufgelegt. Da haben sich Ton, Licht und alle anderen Schauspieler um mich herumgedreht. Ich war sehr glücklich, Lisa, Daniel und Helmfried in meiner Nähe zu haben, die haben mich bei diesem ersten großen Schauspielprojekt großartig unterstützt.

»Wenns’t jetzt noamoal in die Einfahrt neifahrst, dann komm i nunter und dann hau I dir a Fotzn abe.«
Katharina Weiß:
In den Nebenrollen sind viele bekannte Fernsehgesichter zu sehen, zum Beispiel Laura Osswald aus „Verliebt in Berlin“ oder Michael Grimm aus der BR-Serie „Dahoam is Dahoahm“. Gab es eine Zusammenarbeit, die du besonders spannend fandest?
Markus Stoll:
Ja, die mit Heino Ferch, den ich als Schauspieler sehr bewundere. Hier eine kleine Anekdote: Wir drehten gerade die Szene, in der er bekifft mit Cowboyhut, langem Ledermantel und Stiefeln aus einem geklauten Alfa Romeo steigen sollte. Dazu brauchte es einige Anläufe, und so tauchte er immer wieder trunken aus dem Wagen auf und lallte: „Euer Wagen, euer Wagen, der ist wirklich…“ Schnitt. Nach dem gefühlt hundertsten Versuch schrie plötzlich ein Anwohner aus dem Fenster: „Du Trottel mit dem Cowboyhut, wenns’t jetzt noamoal in die Einfahrt neifahrst, dann komm i nunter und dann hau I dir a Fotzn abe.“ Die Übersetzung gibt es auf Nachfrage.


»Humor ist beliebt, vor allem in Zeiten, in denen es nicht so witzig zugeht.«
Katharina Weiß:
Zwischen Deiner Figur und der Berliner Richterin entsteht ein humorvolles Wechselspiel: Kantiger Ehrenbayern versus genervte Großstadtpreußin. Warum ist dieses Erfolgsrezept immer noch so aktuell?
Markus Stoll:
Der Bayer ist für seine grantige Art bekannt und beliebt. Und der Berliner – in diesem Fall die Berlinerin – für die freche Schnauze. Das hat Potenzial, fanden wir. Die Leute lieben es, aus ihrer Komfortzone heraus anzuschauen, wie sich die Menschen auf dem Bildschirm die Köpfe einschlagen. Nicht nur im wörtlichen Sinne, sondern auf alle möglichen Arten. Und wir tun das eben auf die humorvolle und witzige Art und Weise. Humor ist beliebt, vor allem in Zeiten, in denen es wie gerade nicht so witzig zugeht.

»Bei mir ist die Melancholie mit Sarkasmus gemischt.«
Katharina Weiß:
In Interviews wirst Du sehr oft auf den Kern des „bayerischen Grants“ angesprochen. Zum einen sagte zum Beispiel, dass er vererbt wird. Der bayerische Grant bezeichnet ein Stadium, in dem sich jemand aufregt, dabei aber nicht schimpft. Findest Du, dass dieser Kunst noch immer eine gewisse Melancholie innewohnt?
Markus Stoll:
Wenn man Dinge beobachtet, die man nicht mag, neigt man dazu, sich kurz aufzuregen und dann resigniert abzuwinken. Das Abwinken ist die melancholische Komponente, die dabei mitschwingt. Bei mir ist es ein wenig anders. Auf meinen Social-Media-Kanälen und auf der Bühne, wo ich relativ viele Menschen erreiche, regen wir uns eher gemeinschaftlich auf – und resignieren dann auch gemeinschaftlich. Bei mir ist die Melancholie mit Sarkasmus gemischt, der uns gemeinsam zum Lachen bringt. Es entsteht ein Wir-Gefühl. Der Münchner-Mietwahnsinn beispielsweise geht da durch einen Katalysator, der uns am Ende lachen lässt, obwohl der Quadratmeterpreis in München eigentlich zum Heulen ist.

»Jeder negative Kommentar beschäftigt mich irgendwie.«
Katharina Weiß:
Du schneidest oft gesellschaftliche und politische Themen an. Natürlich gerätst Du da auch manchmal in die Schusslinie, nicht alle Kommentare sind positiv. Wann hast Du aufgehört, Dich mit dem Negativen zu beschäftigen?
Markus Stoll:
Nie, jeder negative Kommentar beschäftigt mich irgendwie. Als ich vor kurzem ein Video veröffentlicht habe, in dem ich mich über die wilden Verschwörungstheorien zur Corona-Krise geäußert habe, kamen besonders viele kontroverse Kommentare unter meinem Post auf. Die meisten waren so skurril, dass ich einfach auf Durchzug schalten konnte. Aber es gab auch Kommentare, die unter die Haut gingen, weil sie unheimlich gemein und abwertend waren. Die trägt man schon eine Weile mit sich rum.

»Wir werden in diesem Land versorgt und umsorgt.«
Katharina Weiß:
Neben Verschwörungstheorien haben sich viele Menschen auch über das Thema Glück Gedanken gemacht. Was hast Du zum Beispiel über Dein privates Glück in den letzten Monaten der erzwungenen Ruhe gelernt?
Markus Stoll:
Was ich gelernt habe beziehungsweise was sich mir einmal mehr bestätigt hat, ist, dass es uns wahnsinnig gut geht. Wir werden in diesem Land versorgt und umsorgt. Für mich dieses Gefühl der Sicherheit eine unglaubliche Erkenntnis. Ich hoffe, dass wir aus dieser Rückbesinnung auf das Wesentliche etwas ins „normale“ Leben mitnehmen werden, das irgendwann ja wiederkommen wird.

#harryg #markusstoll #vakuum #katharinaweiss #christianbrecheis #mypmagazine
Mehr von und über Harry G:
harry-g.com
instagram.com/harry_g_offiziell
facebook.com/harrygueber
Interview & Text: Katharina Weiß
Fotografie: Christian Brecheis









